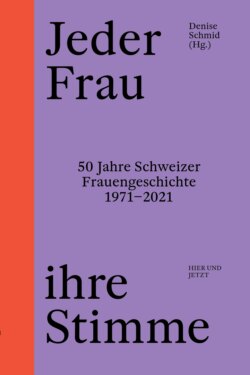Читать книгу Jeder Frau ihre Stimme - Группа авторов - Страница 10
Mehr als das Stimmrecht
ОглавлениеBevor Frauen in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts Vereine gründen, um das Stimmrecht für sich einzufordern, ist also etwas anderes dringlicher. Julie von May bringt es 1872 mit Blick auf die anstehende Totalrevision der Bundesverfassung auf den Punkt: «die unbedingte Gleichstellung der Frau mit dem Manne in allen sozialen und privatrechtlichen Verhältnissen». Ausformuliert heisst das: gleiche Ausbildung, gleicher Lohn bei gleicher Arbeit, gleiches Erbrecht, gleiches Eigentums-, Verwaltungs- und Verfügungsrecht, Vermögensunabhängigkeit der Ehefrau vom Ehemann, Gleichheit im ehelichen Erbrecht und gleiche elterliche Rechte für die Mütter. Die «politischen Rechte» nimmt von May explizit aus. Stattdessen: «Alles was uns fehlt und […] Alles was uns bis jetzt verweigert worden ist.»18
In einem gewissen Sinn ging es hier tatsächlich um alles. Ohne zivile – also ökonomische und soziale – Rechte wurden die Frauen zu Wesen erklärt, die ohne Männer nichts sind, weil sie nicht mal über ihr Eigenes verfügten. Nicht über ihre Güter, nicht über ihr Handeln. Von hier ging alles aus, und hier war alles verkehrt. Denn Frauen trugen ja doch bei zum Lebensunterhalt einer Familie, als Heimarbeiterinnen, bestritten ihn manchmal auch allein, als Ledige oder Witwen, sie erbten Bauerngüter, betrieben Gewerbe. Überall war ihre Arbeit und waren ihre Vermögen die ihren, und doch waren sie es nicht: Für Verheiratete handelte der Ehemann, für Unverheiratete ein behördlicher Vormund. 1846 und 1847 schon haben Bernerinnen zwei Petitionen zur Abschaffung der sogenannten Geschlechtsbeistandschaft vorgebracht, die erste zurückhaltend, die zweite, aus dem Emmental, spricht von «Freiheit» und «Emancipation».19 Sie erhielten Recht, andere Kantone folgten, aber erst 1881 verfügte der Bund für alle Kantone die «persönliche Handlungsfähigkeit» der unverheirateten Frauen.
Nur der unverheirateten. Den verheirateten Frauen bescheidet Eugen Huber 1881 im Vorgriff auf das Schweizerische Zivilgesetzbuch, das 1907 verabschiedet und 1912 in Kraft treten wird, sie sollen zwar wie die ledigen Frauen «handlungsfähig sein, aber gewisse Handlungen nicht vornehmen dürfen». Vor allem ihre Erwerbstätigkeit untersteht der Einwilligung des Ehemannes.20 Fast überall in Europa werden zu diesem Zeitpunkt neue Privatrechtskodifikationen geschaffen oder bestehende revidiert, und die Frauen wissen, wo es um alles geht. Sie lassen sich ausbilden in den Rechtswissenschaften, mischen sich ein, schreiben und argumentieren. In der Schweiz verlangen sie Einsitz in die vorbereitende Kommission, wo manche Mitglieder schon Hubers Entwurf zum neuen Zivilgesetzbuch «zu feministisch» finden.21 Man lässt die Frauen nicht an den Tisch, und am Schluss entscheidet das Bundesparlament, zusammengesetzt aus Männern. Für die Ehe gilt bis auf Weiteres: «Der Ehemann ist das Haupt der Gemeinschaft.»22