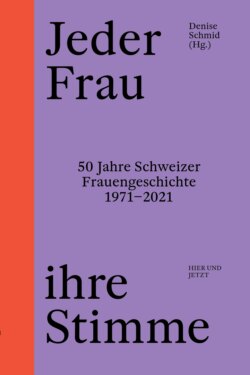Читать книгу Jeder Frau ihre Stimme - Группа авторов - Страница 8
Immer schon …
ОглавлениеEs gibt auch eine Ausflucht: die Idee vom geschichtlichen Fortschritt. Sie gewährt Aufschub. Man kann in Aussicht stellen, dass diejenigen, denen das Recht wegen Unfähigkeit verweigert wird, fähiger werden. Nicht alle können auf einmal berücksichtigt werden, heisst das, nur die einen nach den andern, nach Massgabe ihrer Reife. Oder: Es gibt verschiedene Sorten von Rechten, nicht alle können auf einmal wahrgenommen werden, nur eines nach dem andern, und das politische Recht ist die Krönung. Man kann auch den Kreis der Befugnisse schrittweise weiter ziehen: zuerst im Kirchen-, Schul- und Armenwesen, dann in allen Belangen der Gemeinde, dann im Kanton, dann auf Bundesebene. Dereinst das Ganze, aber zuerst die «Schulsachen», findet Carl Hilty 1897.6
Doch Demokratie wächst nicht wie ein einmal gesetzter und dann sich selbst überlassener Keimling in die Höhe und Breite. Sie ist ein umkämpftes Gut, wird verweigert und erstritten. Müssen sich die Frauen, fragt Iris von Roten 1959, wirklich sagen lassen, sie seien «für die politischen Rechte nicht reif genug»? Eine «Argumentiererei» sei das. Sie gleiche «aufs i-Tüpfchen der Bekämpfung der Volksrechte» im 19. Jahrhundert und sei auch nicht mehr wert: eine «ölige Mahnerei der Frauen zur Geduld», die nur schlecht puren Unwillen verbirgt.7 Also ist es umgekehrt: Die Männer sind nicht reif genug, die Rechte zu teilen, die ihnen doch nicht allein gehören.
Und wie passt die Idee des geschichtlichen Fortschritts überhaupt zur Schweiz? Hat nicht der neue Bundesstaat von sich behauptet, immer schon die alte Landsgemeinde gewesen zu sein?8 Auf dem Gedenkblatt, das die Einführung der Bundesverfassung vom 12. September 1848 visuell flankiert, überreicht wohl die Helvetia dem Volk die Verfassung. Aber hinter – und über – ihr steht der alte Eidgenosse, in seiner Hand den Lorbeerkranz, der über ihrem Kopf nur schwebt. In der modernen Schweiz ist das Neue auch das Alte. Und so wird der Bundesstaat männlich, wie es auch die alte Eidgenossenschaft war, als Mitsprache und Mitbestimmung nicht an das Individuum, sondern an Stand und Haus geknüpft waren.9 Hätte es jetzt anders kommen können, da Rechte nun an den einzelnen Menschen vergeben werden – und die Weiber auch Menschen sind?
Als Emilie Kempin-Spyri, Jura-Studentin im fünften Semester, 1886 dem Bundesgericht die Frage stellt, wie das gehen soll, dass die Frauen mitgemeint sind, wenn in den Gesetzen von den Pflichten des Staatsbürgers die Rede ist, nicht aber, wenn es um die politischen Rechte geht; wie es also sein kann, dass unversehens aus einem generischen ein spezifisches Maskulinum werden kann (und wie man dann eigentlich wissen soll, wann was der Fall ist), lautet die Antwort: Wenn die Frau Kempin-Spyri aus der Verfügung der Bundesverfassung, es gebe in der Schweiz keine Untertanenverhältnisse, die «volle rechtliche Gleichstellung der Geschlechter» folgern wolle, so sei das eine Auffassung «ebenso neu als kühn» und genau deshalb nicht zu billigen: Sie verstosse gegen nichts weniger als die «gesammte geschichtliche Entwicklung».10