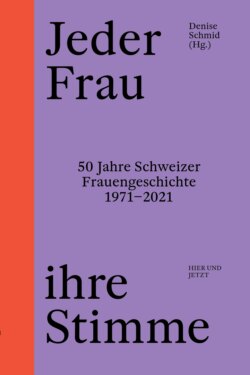Читать книгу Jeder Frau ihre Stimme - Группа авторов - Страница 9
… und immerdar
ОглавлениеNicht nur in der Schweiz wird weibliche Unfähigkeit behauptet, um damit den Ausschluss der Frauen zu begründen. Aber hier ist dieser überdies historisch beglaubigt. So alt wie das republikanische Prinzip der «Gleichen unter Gleichen» ist in der Schweizer Geschichte dessen Verkörperung durch die Männer. Die Entwicklung, von der das Bundesgericht spricht, verbindet also Herkömmliches und Neues miteinander. Sie meint nämlich: immer mehr Männer. Und je weiter die Kreise unter diesen gezogen werden (von den Gemeindebürgern auf die Hintersassen und Zugezogenen, von den Stadtbürgern auf die Landbewohner, von den Hablichen auf die wenig Bemittelten, von den Christen auf die Juden), desto schwieriger wird es für die Frauen.
Jedes Mal, wenn sich berufen wird auf Urkunden oder das natürliche Recht, wenn die Hebel angesetzt werden zu mehr Freiheit, die allen gehören soll, damit daraus mehr Gleichheit erwachse, jedes Mal haben Frauen Anlass zur Frage: «Und wir?»11 Und jedes Mal, wenn mehr Demokratie unter Männern gelingt, verlieren sie mögliche Verbündete.12 Immer grösser wird das Paradox, das Julie von May 1872 auf den Punkt bringt: «[D]as mündigste Volk Europa's [sic] betrachtet und behandelt seinen weiblichen Bestandtheil, wenn nicht völlig konsequent im Leben, doch vor dem Gesetz und in der Sitte, als das unmündigste Kind.»13
Auch in den 1860er-Jahren melden sich Frauen zu Wort. Eine Bewegung – die Historiker werden sie die «demokratische Bewegung» nennen – verlangt im Namen des «Volkes» mehr Mitsprache, eine direkte, nicht nur eine repräsentative Demokratie. Blitzschnell werfen die Sissacherinnen ein: «Die Frauen werden ja wohl auch zum Volke gezählt werden.»14 Einige Jahre später unterzeichnen im Zürcher Oberland «mehrere Frauen aus dem Volk» ihrerseits eine Petition. Sie klagen an: Eine «allseitige Erweiterung der Volksrechte» werde verkündet, gross täten die «grossen Männer der Schöpfung», und keiner spreche von den Frauen, «niemand gedenkt ihrer verkümmerten und unterdrückten Menschenrechte».15
Zu hoffen wagen sie nicht, die Zürcherinnen, dass die Männer zur Einsicht kämen oder doch wenigstens «etwas mehr Bescheidenheit in ihren privaten und öffentlichen Freiheitsmanifestationen» an den Tag legen möchten. Denn sie halten die Menschenrechte für unteilbar und verlangen «Wahlberechtigung und Wahlfähigkeit für das weibliche Geschlecht in allen sozialen und politischen Angelegenheiten und Beziehungen». Fast hätten die Sissacherinnen ein paar Jahre früher dasselbe gefordert. Zumindest gingen so damals die Gerüchte im Baselbiet, weshalb die aus dem Waldenburgertal verlauten liessen: «Zwar verlangen wir nicht allgemeines Stimmrecht, statt dessen aber: 1) dass unsere Unterschrift gesetzliche Gültigkeit habe ohne Beistand, 2) gleichmässige Teilung der Hinterlassenschaft; 3) dass wir leichter freie Mittelverwaltung erlangen können.»16
Wenn es also Menschenrechte gibt, dann gibt es auch Frauenrechte. Sie sind unteilbar, und dennoch wird nicht immer alles gefordert. Nicht das eine, aber das andere, nicht das Stimmrecht, aber Mündigkeit und Gleichbehandlung in ökonomischen Belangen. Aus welchen Gründen? Ist das Resignation? Taktik? Vorsicht? Oder aber: Jede Forderung in der Geschichte der Frauen ist auch eine Analyse. Sie bringt eine Situation zur Sprache und deckt Zusammenhänge auf. Niemand behauptet ja, die Frauen seien keine Menschen – also Tiere zum Beispiel oder Pflanzen. Allerdings seien sie etwas weniger fähige Menschen, unmündig, das wird behauptet. Und diese Unmündigkeit wird genau dort verfügt, wo es um Unterschriften, das Erben und die Mittel geht.
Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts stellt sich nämlich die Frage, ob auch die Frauen als individuelle Rechtssubjekte anzusehen sind. Hier wird es zu Änderungen kommen. Ausser in genau einem Fall, für den, wie der Rechtsgelehrte Eugen Huber 1886 schreibt, gilt, dass der Mann «immerdar das entscheidende Wort zu sprechen haben» wird – dieser Fall ist die Ehe.17