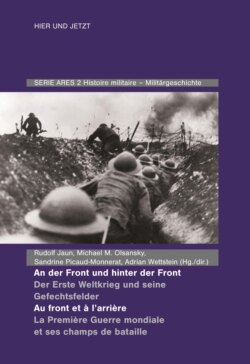Читать книгу An der Front und Hinter der Front - Au front et à l'arrière - Группа авторов - Страница 8
Einleitung
ОглавлениеMit Chiffren wie Verdun und Somme steht der Erste Weltkrieg noch immer für ein jahrelanges industrielles Verheizen von Hunderttausenden Soldaten an der Westfront. Mögen die grossen Schlachten der Westfront auch künftig die populäre Wahrnehmung des Ersten Weltkriegs dominieren – sicher ist, dass dieser auch viele andere, ganz unterschiedliche Gefechtsfelder aufwies.
Zum einen stand die militärische Elite in diesem Krieg vor der grundsätzlichen Herausforderung der permanenten Adaption der Kampfführung. So war denn der Erste Weltkrieg durch eine geradezu revolutionäre Entwicklung der Taktik und Technik, aber auch durch die sich erst ausbildende operative Stufe der Kriegführung geprägt. Diese Entwicklung hatte eine jahrzehntelange Vorgeschichte, kam aber erst in den Jahren 1917/18 zum Tragen. Diese von Deckung, Auflockerung, Tiefengliederung und der Kombination von Feuer und Bewegung geprägte Gefechtsweise bezeichnete der amerikanische Historiker Stephen Biddle unlängst als «modern system of force employment». In Wechselwirkung dazu stand die rüstungstechnische Weiterentwicklung, die mit Neuerungen wie etwa automatischen Handfeuerwaffen, Panzern oder Angriffsflugzeugen aufwartete.
Zum anderen aber war der Frontenkrieg nur eine Ausprägung des Gefechtsfeldes dieses in neuem Masse sich totalisierenden Kriegs. Letzterer war auch durch eine umfassende personelle, wirtschaftliche, politische und geistige Mobilisierung der Kriegsgesellschaften gekennzeichnet und eröffnete ganz neue Gefechtsfelder – nämliche jene an der Heimfront. Nicht mehr alleine Soldaten in den Schützengräben, sondern Rüstungsarbeiterinnen in den Fabriken und Propagandisten in den Pressebüros wurden mitentscheidend für den Kriegsausgang.
Die Tagung «An der Front und hinter der Front» fragte nach den Entwicklungen von Doktrin, Ausrüstung, Kriegsbild und Rekrutierungsform ausgewählter Armeen und nach dem Stellenwert der Zäsur «1914». Des Weiteren lenkte sie den Blick auf die Streitkräfteentwicklung nach 1918 und den diesbezüglichen Stellenwert von Kriegserfahrungen und «Kriegslehren». Mit der Betrachtung der Vor- wie der Nachkriegszeit sollte militärisches Denken und Handeln im Ersten Weltkrieg epochal eingebettet und nicht isoliert betrachtet werden. Der Blick auf die Zeit «nach der Front» befasste sich mit dem gesellschaftlichen Erinnern und Gedenken sowie mit den Deutungen und Narrativen der Darstellungen des Ersten Weltkriegs.
Zu den oftmals nur Spezialisten zugänglichen und verständlichen Gefechtsfeldern gehört die Dynamik militärischer Adaption, sei diese technischer, organisatorischer, taktischer, strategischer oder auch militärtheoretischer Natur. Diese adaptiven Prozesse stehen im Zentrum des Aufsatzes von Georges-Henri Soutou. Er zeigt, wie der als schneller, offensiv geführter Bewegungskrieg geplante Konflikt im Spätherbst 1914 im Westen erstarrte. Dabei betont er die Bedeutung der fehlenden operativen Stufe, die sich erst nach und nach entwickelte, etwa durch die Zusammenfassung von Armeen in groupes d’armées im Herbst 1914 in Frankreich oder durch die Bildung von «Theaterkommandos» wie Ober Ost (Oberbefehlshaber der gesamten deutschen Streitkräfte im Osten) im November 1914 durch das Deutsche Reich. Um dem militärischen Patt an der Westfront zu entkommen, wandten beide Seiten strategische Alternativen an. Vor allem die Entente-Staaten Frankreich und Grossbritannien versuchten eine Peripherie-Strategie, das heisst Offensivaktionen an den schwächer besetzten Fronten der Mittelmächte wie in Griechenland oder bei Gallipoli. Erst mit dem fast schlagartigen Zusammenbruch der bulgarischen Front im September 1918 schlug diese Strategie durch, nachdem die britisch-französische-serbische Saloniki-Front drei Jahre wenig aktiv gewesen war. Nach Soutou versuchten 1915/16 beide Seiten der gescheiterten Vernichtungsstrategie eine Ermattungsstrategie entgegenzusetzen – die Entente durch die Seeblockade, das Deutsche Reich nach dem Scheitern eines Durchbruchversuchs in der Blutmühle von Verdun. Während das Deutsche Reich diesbezüglich erfolglos blieb, brauchte die alliierte Seeblockade sehr lange, bis sie zu wirken begann. 1917/18 folgte dann eine Strategie des Totalen Kriegs, die eine verstärkte Mobilisierung der Gesellschaft, der Industrie und der Politik, eine systematische Kriegführung gegen Zivilisten und den uneingeschränkten U-Boot-Krieg mit sich brachte. Erst durch die taktischen Innovationen der Jahre 1916 bis 1918 wie die Sturmtruppentaktik, neue artilleristische Schiessverfahren und den Panzer als Durchbruchswaffe kam ab Anfang 1918 wieder Bewegung in die erstarrte Westfront. Diese Entwicklung – zusammen mit den Auswirkungen der britisch-französischen Peripheriestrategie – erwies sich, so Soutou, als kriegsentscheidend.
Neue Gefechtsfelder ergaben sich aber auch im geografischen Sinn, nämlich dadurch, dass dieser Krieg sehr rasch zu einem Weltkrieg mit erheblicher aussereuropäischer Beteiligung (Japan, Osmanisches Reich, USA) wurde und eben auch auf aussereuropäischen Gefechtsfeldern stattfand. Umgekehrt kämpften auf dem europäischen Schauplatz Soldaten aus der ganzen Welt, von den Australiern und Neuseeländern bei Gallipoli über Kanadier am Vimy Ridge bis hin zu den Tirailleurs sénégalais am Chemin des Dames. Wie Stig Förster in seinem Artikel zeigt, entstanden aussereuropäische, bisweilen auch eigenständige Gefechtsfelder, wie etwa der Kampf um Unabhängigkeit vor allem in den britischen Kolonien oder die Vernichtung von Minderheiten, die im Falle der Armenier genozidale Ausmasse annahm.
Zu den wichtigsten Themenfeldern des Ersten Weltkriegs gehört sicher die Mobilisierung der Kräfte und Ressourcen durch die einzelnen Nationen. In Bezug auf die Rekrutierung der Soldaten gab es vor und während des Kriegs erhebliche Unterschiede. Dabei spielten nationale Vorstellungen und Eigenheiten eine sehr grosse Rolle. Ian Beckett zeigt die Entwicklung der Rekrutierung in der britischen Armee, die als kleine Berufsarmee in einen erwarteten kurzen Krieg zog. Als sich dieser Krieg immer länger hinzog und in seinen Dimensionen mehr und mehr auswuchs, brauchte das britische Heer neue Kräfte. Diese versuchte es zuerst durch das Heranziehen der Territorials und von Freiwilligen zu gewinnen, und erst als dieses Reservoir weitgehend ausgeschöpft war, wurde eine Wehrpflicht eingeführt. Deren Durchsetzung erfolgte aber deutlich weniger strikt als in den anderen europäischen Ländern.
In Österreich-Ungarn war die Wehrpflicht wie in den meisten europäischen Armeen bereits vor dem Krieg vorhanden, dafür spielten hier die Nationalitätenfrage, der Reichsaufbau der Doppelmonarchie und die relativ geringen Militärausgaben eine wichtige Rolle hinsichtlich des Umfangs, der Ausrüstung und des Ausbildungsstandes der österreichisch-ungarischen Streitkräfte von 1914. Die enormen Verluste des ersten Kriegsjahres vor allem im aktiven Offizierskorps machten allerdings Umstellungen notwendig, die auch politische und soziale Ordnungsvorstellungen betrafen. Als Ironie der Geschichte bezeichnet Günther Kronenbitter in seinem Beitrag das völlige Ausbleiben des vielfach befürchteten Auseinanderbrechens der multiethnischen Armee. Bedeutsamer für die Niederlage Österreich-Ungarns war die zunehmend schlechte Versorgungslage, die ab 1917 katastrophale Ausmasse annahm.
Der Frage, ob der Erste Weltkrieg ein totaler Krieg war, und wenn ja, in welchem Masse und ab wann, widmet sich Roger Chickering. Dabei plädiert er mit dieser Frage für eine neue Herangehensweise, die Kriege nicht einfach als total oder nicht total etikettiert, sondern die in ihnen ablaufenden Prozesse genauer auf ihre Totalisierungstendenzen hin untersucht. Chickering tut dies exemplarisch für den Ersten Weltkrieg und schält drei mögliche Phasen (Jahreswende 1917/18, Herbst 1914, das lange Jahr 1915) heraus. An der Diskussion derselben zeigt er nicht nur exemplarisch die dem historischen Konzept des Totalen Kriegs inhärenten Widersprüche auf, sondern deutet an, dass die einzelnen Nationen zu verschiedenen Zeitpunkten in ganz unterschiedlichem Masse einen totalen Krieg führten. Letztlich, so Chickering, müsse der Totale Krieg weniger als ein Zustand, sondern vielmehr als ein Prozess verstanden werden, bei dem es darum ging, die Herausforderung der grossen materiellen und moralischen Bürden, die der Krieg an die beteiligten Nationen stellte, zu bewältigen.
Den im Beitrag von Georges-Henri Soutou umrissenen Hauptproblemlagen der Kriegführung begegnen Dimitry Queloz und Gerhard Gross in ihren Beiträgen zur Entwicklung der operativen und taktischen Konzepte der französischen Armee beziehungsweise des deutschen Heers im Ersten Weltkrieg. Queloz hält diesbezüglich fest, dass die erst ab 1913 in mehrere Gefechtsvorschriften formulierte Kampfdoktrin der «offensive à outrance» zu spät publiziert wurde, um die reale Gefechtsführung im französischen Heer bei Kriegsbeginn nachhaltig zu beeinflussen. Dergestalt «doktrinbefreit», adaptierten die französischen Truppen bereits ab den ersten Kriegswochen ihre Kampfweise an die Gegebenheiten der jeweiligen Gefechtsfelder, wobei die Minderung der eigenen Verluste Hauptantrieb dieser Bemühungen gewesen sei. Die konzeptuelle und technologische Weiterentwicklung des befestigungsgestützten Defensivkampfes sollte die französische Armee bis zum Jahre 1918 zu einer völlig veränderten und umfassend modernisierten Streitkraft machen, wobei Queloz die Entwicklungswege und Sackgassen militärischer Innovation in der französischen Armee problematisiert.
Gerhard Gross beschäftigt sich demgegenüber schwergewichtig mit der operativen Stufe der deutschen Kriegführung und geht mit ihr auf der Basis seiner kürzlich hierzu erschienenen Monografie streng ins Gericht. Seine Kritik zielt indirekt auch auf die vermeintlich allzu positive Darstellung der Entwicklung der deutschen Kampfführung durch mehrere angelsächsische Militärhistoriker in jüngster Zeit, welche die taktisch-operativen Erfolge des deutschen Heers im Ersten Weltkrieg als Ausgangspunkt der anfänglichen Siegesserie des deutschen Militärs im Zweiten Weltkrieg interpretieren. Zwischen 1914 und 1918 scheiterten nach Gross die auf Bewegung, Angriff, Schnelligkeit, Initiative, Freiheit des Handelns, Schwerpunkt, Überraschung, Umfassung und Vernichtung fokussierten operativen Konzepte des deutschen Heers fast alle an der fehlenden Mobilität beziehungsweise an der Langsamkeit der Truppe, an der lediglich eingeschränkten Fähigkeit zum taktischen Angriff sowie an grundsätzlichen, weil strukturellen Unzulänglichkeiten der deutschen Operationsführung. Die operativen Erfolge des deutschen Heers an der Ostfront wie den Abwehrsieg bei Tannenberg im Jahr 1914, die Sommeroffensive nach der Durchbruchsschlacht bei Gorlice-Tarnów im Jahr 1915 oder die Eroberung Rumäniens im Jahre 1916 anerkennt Gross wohl, qualifiziert sie jedoch lediglich als Halberfolge, da die eigentliche Zielsetzung des deutschen operativen Denkens, die Umfassung und Vernichtung der gegnerischen Kräfte, dabei kaum je gelang. Das entsprechende Schicksal erfuhr, nach Gross symptomatisch, die deutsche Frühjahresoffensive von 1918, welche trotz beachtlicher taktischer Anfangserfolge aufgrund der mangelnden Mobilität der Truppenverbände versackte und letztlich scheiterte.
Wie die nicht kriegführende Schweizer Armee den taktischen und operativen Herausforderungen des Ersten Weltkriegs zu entsprechen versuchte, erläutert schliesslich Michael Olsansky. In seinem Beitrag zeigt er auf, wie Kriegsschauplatz-Abkommandierungen schweizerische Offiziere an fast alle europäischen Fronten des Ersten Weltkriegs führten und dazu beitrugen, zumindest das Kriegsbild im schweizerischen Offizierskorps einigermassen aktuell zu halten. Auf der Basis dieser Frontmissionen lieh sich die Schweizer Armee gewissermassen die Kriegserfahrungen anderer Armeen und war dadurch in der Lage, die Truppenausbildung in der zweiten Kriegshälfte etwas zu modernisieren. Die Haupteinflüsse hierzu kamen von der französischen Armee und vom deutschen Heer, wobei es für den schweizerischen Militärapparat doch schwierig war, aus den teilweise entgegengesetzten Entwicklungswegen dieser beiden Armeen eine eigene Art der Kriegs- und Gefechtsführung herauszufiltern. Die eigentliche schweizerische Adaption der revolutionären Militärentwicklungen des Ersten Weltkriegs sollte sich denn auch erst allmählich in der Zwischenkriegszeit vollziehen.
Aber welche Lehren – bei aller Problematik dieses Begriffes – zogen nun europäische Armeen aus dem Ersten Weltkrieg? Markus Pöhlmann hält in seinem Beitrag zum deutschen Militär nach 1918 deutlich fest, dass der Erste Weltkrieg wohl ein zentraler Erfahrungshintergrund des deutschen Offizierskorps war und auf der taktischen Ebene der Landkriegführung die Erfahrungen und Innovationen der Kriegszeit grosse Wirkung entfalteten. Jedoch waren für die deutsche Militärentwicklung der Zwischenkriegszeit die sich ändernden politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und rüstungsindustriellen Kontexte, so zum Beispiel die militärischen Korsettbestimmungen des Vertrags von Versailles, mindestens so wichtig, sodass der Weltkrieg mit zunehmender Dauer «seine Bedeutung als Referenzereignis verlor». Daneben legt Pöhlmann einen wichtigen Fokus auf die gesamtgesellschaftlichen Aspekte der totalen Kriegführung (Wehrverfassung, Ressourcenmobilisierung, Propagandatätigkeit etc.), deren sich in der Zwischenkriegszeit nicht primär das deutsche Militär, sondern zusehends zivile Stellen und Akteure annahmen und unter der Leitvorstellung der «Wehrwissenschaften» eine zwar kurzlebige, aber gesamtheitliche und anwendungsorientierte «Meta-Wissenschaft vom Kriege» entwickelten.
Adrian Wettstein fokussiert seine Betrachtungen demgegenüber auf eine französische Armee, die sich in der Zwischenkriegszeit primär im Ruhme ihres Sieges sonnte und darob sukzessive intellektuell, konzeptuell und materiell stagnierte. Dabei spielte der auf die Weltkriegserfahrung zurückgehende Imperativ der eigenen Verlustminimierung eine zentrale Rolle und prägte die erstmalig 1921 verschriftlichte französische Doktrin der «bataille conduite» massgeblich. Aufgrund sinkender Rüstungsausgaben, rüstungstechnologischem Stillstand und der Verkürzung der Wehrdienstzeit wurde diese Kampfweise bis 1940 auch nicht mehr grundsätzlich überdacht und die französische Doktrinentwicklung stand spätestens in den 1930er-Jahren still.
Wim Klinkerts Betrachtungen zur niederländischen Militärdebatte der Jahre 1918 bis 1923 gehen wiederum über den engeren militärischen Sachverhalt hinaus. Als Nichtkriegsteilnehmer versuchten führende Vertreter des Offizierskorps die niederländische Militärentwicklung nach Kriegsende weiterhin an der modernen Militärentwicklung auszurichten, wobei sich die traditionell auf das deutsche Modell fokussierte Beobachtung tendenziell auf das französische Militär verlagerte. Alternative Militärkonzepte wurden weniger im militärischen Apparat als in der niederländischen Politik entworfen, wobei sich vorab die politische Linke gegen die Übernahme klassischer ausländischer Militärkonzepte sträubte und auf die Möglichkeiten des Kleinstaats ausgerichtete Gegenmodelle forderte. Diese Diskussionen prallten jedoch an einer an militärischen Angelegenheiten weitgehend desinteressierten Öffentlichkeit ab, die, tendenziell pazifistisch ausgerichtet, Militär vor allem als Kostenfaktor begriff und die Wehrpflicht als staatlichen Eingriff in die individuelle Lebensgestaltung jedes Einzelnen empfand.
Nicht ganz so drastisch standen die Dinge im anderen kriegsunversehrten Kleinstaat Mitteleuropas, der Schweiz. Wie Michael Olsansky ausgehend vom Beispiel des Referatsauftritts von Hans von Seeckt vor der Zürcher Offiziersgesellschaft im Jahr 1930 darlegt, war in der Schweiz das öffentliche Interesse an militärischen Fragen grundsätzlich vorhanden. Jedoch hinderten nach Kriegsende auch hier tiefgehaltene Militärbudgets und damit ausbleibende Rüstungsanschaffungen die schweizerische Militärführung daran, die Kampfweise der Schweizer Armee umfassend zu modernisieren. Aufgrund mehrerer systeminhärenter Bremsfaktoren publizierte die schweizerische Militärführung erst im Jahr 1927 eine erste offizielle Nachkriegs-Gefechtsvorschrift, ein Paradebeispiel für die Problematiken der schweizerischen Militärentwicklungsadaption. Einen Beitrag zu den Kriegserfahrungen der britischen Military Intelligence leistet Sönke Neitzel, wobei die Frage nach der Halbwertszeit und der prozessualen Verwertung derselben im Zentrum steht.
Ein Krieg, der während vier Jahren in intensiver Weise ebenso sehr hinter der Front wie an der Front ausgefochten wurde, musste zu höchst unterschiedlichen Formen des Erinnerns, Gedenkens und Verarbeitens führen. Sieg und Niederlage, Aufrechnung und Nicht-Anerkennung von Kriegsschuld sowie Überwälzung der Niederlage auf das Versagen der Heimfront bildeten die hauptsächlichsten Facetten dabei. Gerd Krumeich zeigt dies in einem Vergleich der Erinnerungsaktivitäten im besiegten Deutschland und im siegreichen Frankreich. In Deutschland liess sich kein nationaler Konsens des Gedenkens und Trauerns herstellen. Die Errichtung von Denkmälern und Gedenkstätten wurde politisch von links und rechts intrumentalisiert und nach deren Errichtung gegenseitig zum Teil wieder zerstört. Zu umstritten war die Frage, weshalb der Krieg verloren ging und der als ungerecht empfundene Frieden von Versailles hatte unterzeichnet werden müssen. Mit der Machtergreifung der NSDAP setzte eine heroische und revanchistische Gedenkkultur ein. Nach der noch katastrophischeren Niederlage im Zweiten Weltkrieg geriet das Gedenken an die Kriegstoten des Ersten Weltkriegs in den Hintergrund. Ganz anders konnte sich in Frankreich ein Gedenken und Trauern etablieren, das bis heute ungebrochen anhält. Im Bewusstsein, dank der Kriegsopfer das Vaterland erfolgreich verteidigt zu haben, wurde in jeder Gemeinde nach nationalen Vorgaben ein Monument des morts pour la France errichtet und mit dem nationalen Gedenktag Armistice am 11. November eine Manifestation des Erinnerns und Trauerns eingerichtet, welche jenseits von allen politischen Differenzen begangen wird und zum festen Feiertag in Frankreich geworden ist.
Michael Epkenhans zeigt in seinem Beitrag, dass die Überwälzung der Niederlage in Deutschland auf die Heimfront und die Kriegsgegner einer empirischen Überprüfung nicht standhält und die These vom Dolchstoss als Dolchstosslüge zu bezeichnen ist. Die Dolchstosslegende, beziehungsweise -lüge, welche die Niederlage vor dem Hintergrund der seit 1917 einsetzenden Betriebsstreiks und Proteste gegen die Versorgungslage der politischen Linken, aber auch den Juden zuschrieb, entfaltete in der Nachkriegszeit eine enorme Wirkung und befeuerte die zum Teil gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen links und rechts. Die Aussage «Im Felde unbesiegt» wurde angesichts der geordnet aus Frankreich zurückmarschierenden Truppenverbände für bare Münze genommen. Epkenhans zeigt, dass diese Aussage angesichts der völlig ausgebrannten deutschen Truppenverbände nach dem Misslingen der Frühjahresoffensive 1918 nicht zutrifft. Die deutsche Armeeführung war ob der materiellen und insbesondere der personellen Überlegenheit der Verbände der Entente und dem mobilisierbaren amerikanischen Ressourcenpotential gezwungen, sich zurückzuziehen, um Waffenstillstand zu bitten und die militärische Niederlage zur Kenntnis zu nehmen, wenn auch nicht zu akzeptieren.
Marin Schmitz zeigt, dass in Österreich insbesondere die höchsten Offiziere die Schuld an der Niederlage, wie die deutsche Heeresführung, nicht ihrem Wirken an der Front zuschrieben, sondern den politischen Akteuren und dem letzten Kaiser Österreich-Ungarns. Gerade besonders brutale Heerführer wie der «Löwe vom Isonzo», Svetozar Boroevic, hielten ihre militärischen Leistungen für untadelig und konnten es nicht verkraften, am Ende nicht nur als Verlierer dazustehen, sondern auch der Heimat beraubt worden zu sein, für die sie gekämpft hatten. Das Auseinanderfallen des Vielvölkerstaats machte viele ehemalige transleithanische Offiziere heimatlos, da sich die Nachfolgestaaten teilweise weigerten, sie als Staatsangehörige aufzunehmen und die Republik Österreich für sie keine Verwendung hatte.
Die Schweiz hatte sich weder mit der Erinnerung an Sieg oder Niederlage noch mit sieghaften oder besiegten Gefallenen zu befassen. Der lange Neutralitätsschutz-Dienst, welcher die Milizarmee an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit führte und der von harten, politisch-medial ausgetragenen Kämpfen um die Darstellung des problembeladenen Dienstbetriebs gekennzeichnet war, sollte auch die nachfolgende Erinnerung und das Gedenken prägen. Béatrice Ziegler zeigt, wie unmittelbar nach dem Krieg für die während des Aktivdienstes durch Unfälle und Grippe zu Tode gekommenen Soldaten Denkmäler errichtet wurden. Diese gerieten im Streit zwischen dem linken und rechten Lager um die Rolle der Auslösung und Bewältigung des Landesgeneralstreiks im November 1918 zur Projektionsfläche. Im Rahmen der Geistigen Landesverteidigung nach 1933 gegen den Nationalsozialismus und Faschismus wurden diese Dispute weggewischt und die Armee in Literatur und Film als Garant der Unversehrtheit der Schweiz und des wehrhaften Zusammenwachsens dargestellt. Die sozialen Probleme der Familien und die ätzenden Missstände in der Truppenausbildung und im Dienstbetrieb wurden als im nächsten Aktivdienst behebbar dargestellt. Diese geschichtskulturellen Narrative determinierten auch die nach 1945 desinteressierte geschichtswissenschaftliche Forschung und führten zum für die Medienöffentlichkeit und Forschung «vergessenen Krieg». Roman Rossfeld zeigt am Beispiel der Produktion von Munitionsbestandteilen, wie sehr die Schweiz in den Wirtschaftskrieg hinter den Fronten einbezogen war – ein Stück verdrängter Geschichte der Schweiz während des Ersten Weltkriegs. Die aus der Uhren- und Buntmetallbranche fulminant gesteigerte Produktion von Munitionsteilen war völlig von den Rohmaterial-Lieferungen der alliierten Kriegsmächte abhängig, welche zu 90 Prozent die Schweizer Munitionsteile-Exporte bezogen. Die Sicherung von Arbeitsplätzen und Gewinnchancen liess neutralitätspolitische und moralische Bedenken in den Hintergrund treten. Die mit Munition hochgradig unterdotierte Schweizer Armee konnte nur hoffen, bei einer akuten Bedrohung der Schweiz vom Feind des Feindes die notwendigen Rohstoffe zu erhalten und die Produktionskapazitäten für den Eigenbedarf nutzen zu können. Dies ist eine der vielen Facetten der Geschichte der Schweiz und der Schweizer Armee im Ersten Weltkrieg, die bisher kaum Eingang in die schweizerische Geschichtskultur gefunden haben.
Die Tagung «An der Front und hinter der Front» hat nicht nur die Dynamiken an der Gefechts- und Ressourcenfront im Verlauf der Kriegsjahre thematisiert, sondern auch die davor und danach liegenden Entwicklungen einbezogen. Sowenig die mörderische Intensität der Waffenwirkungen vor 1914 unbekannt war, so wenig blieben die Erfahrungen dieser Kriegsjahre für die Weiterentwicklung der militärischen Kampfführung wie der Konzepte einer noch intensiveren kriegerischen Nutzung des sozioökonomischen Potentials ungenutzt.
Rudolf Jaun, Michael Olsansky, Adrian Wettstein