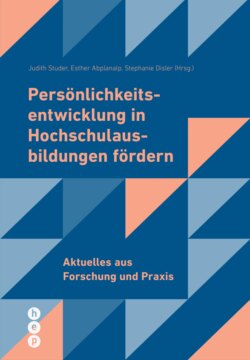Читать книгу Persönlichkeitsentwicklung in Hochschulausbildungen fördern (E-Book) - Группа авторов - Страница 10
2.2 Psychoanalytisch orientierte Perspektive
Оглавление«Das Studium sollte als Chance für die Persönlichkeitsentwicklung begriffen werden. Hier werden oft die Weichen gestellt, die darüber entscheiden, ob das Individuum den Weg in die psychische Gesundheit und kreative Entfaltung im Beruflichen und Privaten einschlägt oder aber in einer Sackgasse landet, die durch das persönliche Scheitern, sozialen Rückzug und Flucht in psychosomatisches Leiden gekennzeichnet sein kann.» (Leuzinger-Bohleber, 2000, S. 159)
«Soziale Berufe»[1] sind durch vielfältige menschliche Kontakte und Erfahrungen geprägt; es geht immer um Beziehungsarbeit. Doch ein Sich-Einlassen wird erst möglich, wenn man «sich in sich selbst wie in einem stabilen eigenen Haus – warm, kuschelig und wohl versorgt – [fühlt, d. Verf.], dann können Fenster und Türen geöffnet werden, um das Haus mit Leben zu füllen» (a. a. O., S. 163). Um dem entgegenzukommen, bedarf es der Festigung von innerseelischen Ressourcen und Möglichkeiten, zum Beispiel durch die Förderung einer beständigen Selbstentwicklung und kreativer Problemlösemöglichkeiten (a. a. O., S. 170).
Die Bedeutung des Rückgriffs auf innerseelische Ressourcen wird deutlich, wenn es um den Umgang mit Ambivalenzen geht, die mit «sozialen Berufen» einhergehen (Helsper, 2011). Ambivalenzen, zum Beispiel zwischen einem großen Bedarf an sozial-erzieherischer Unterstützung und den eigenen begrenzten physischen und psychischen beruflichen Kapazitäten, werden als emotional «belastend erlebt, sie irritieren und können das Handeln unsicher machen» (Schlömerkemper, 2017, S. 25).[2]
In diesem anspruchsvollen Arbeitsumfeld kann es zu Überforderungen von Berufstätigen kommen. Aus diesem Grund besteht die Gefahr, dass sie auf Abwehrmechanismen zurückgreifen, um die erlebte äußere Komplexität zu reduzieren. Dabei regredieren sie unter Umständen auf archaische und primitive Stufen seelischen Erlebens, zum Beispiel durch die Verleugnung konkreter Probleme im beruflichen Kontext oder Projektionen, bei denen eigene unerträgliche Wünsche oder Impulse in eine andere Person projiziert werden (Leuzinger-Bohleber, 2000, S. 164 ff.). Die Wahrnehmung der Umwelt wird dann verzerrt und steht der Entwicklung einer «reifen Ambivalenz» (a. a. O., S. 170) entgegen, also dem Wahrnehmen und Aushalten von unvereinbar erscheinenden Strebungen. «Eine nicht-dichotome Argumentationsfigur zeichnet sich [erst dann, d. Verf.] ab, wenn spekulativ das Verhältnis von erster und zweiter Position in einer dritten Konstellation reflexiv ausgehalten wird» (Müller, 2018c, S. 178). Ein psychoanalytisch orientierter Zugang nimmt dafür den latenten Gehalt beruflicher Gegebenheiten ins Blickfeld. Entsprechend geht es um das zunächst Unausgesprochene und Unbewusste: Eigene Gefühle und spontane Assoziationen werden geäußert und (auch) in Hinblick auf etwaige Widerstände («Abwehrmechanismen») hin analysiert. Es geht um das Wahrnehmen eigener äußerer und innerer Wahrheiten, wodurch eine komplexe und vielschichtige persönliche Auseinandersetzung mit dem beruflichen Kontext ermöglicht werden kann. Dieser psychoanalytisch orientierte Zugang basiert auf kritischer (Selbst-)Reflexion; psychoanalytisch orientiert zu arbeiten, heißt damit, personenbezogen zu arbeiten.