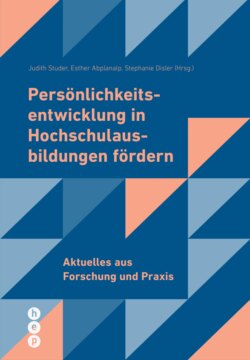Читать книгу Persönlichkeitsentwicklung in Hochschulausbildungen fördern (E-Book) - Группа авторов - Страница 4
Einleitende Worte
ОглавлениеDie Kompetenzorientierung verlangt von den europäischen Hochschulen auch die Förderung der Entwicklung berufsrelevanter Selbst- und Sozialkompetenzen. In den letzten Jahren sind an vielen Hochschulen und in vielen Studiengängen mannigfaltige Bestrebungen zu beobachten, den Auftrag ernst zu nehmen und entsprechende Module und Angebote auszuarbeiten.
Im Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit der Berner Fachhochschule werden seit knapp zehn Jahren didaktische Formate und Methoden erprobt, welche die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden fokussieren und unterstützen sollen. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch die Forschung, die am Departement im Rahmen der Dissertation von Judith Studer zum Thema «Gestaltung von Lernumgebungen zur Förderung der Entwicklung berufsrelevanter Selbst- und Sozialkompetenzen» durchgeführt wurde.
Es schien an der Zeit, sich über die Hochschul- und Landesgrenzen hinweg auszutauschen. Im Oktober 2018 veranstaltete das Departement Soziale Arbeit der Berner Fachhochschule eine erste internationale Tagung zum Thema «Förderung der Persönlichkeitsentwicklung in Hochschulausbildungen» mit dem Ziel, bereits erprobte und möglicherweise beforschte didaktische Konzepte und Modelle zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen der Hochschulausbildungen bekannt zu machen, Erfahrungen theoretisch zu verorten, gemeinsam zu reflektieren und vielleicht sogar weiterzuentwickeln. Bereits die Ausschreibung stieß auf außerordentliches Interesse, sodass wir als Organisatorinnen ein vielfältiges, spannendes Programm ausarbeiten konnten. An der Tagung nahmen rund hundert Personen aus dem internationalen Hochschulumfeld und unterschiedlichen Disziplinen teil.
Während unter den Teilnehmenden Einigkeit darin bestand, dass Persönlichkeitsentwicklung zur Hochschulausbildung gehören muss, bot die Tagung einen bunten Strauß unterschiedlicher mikro- und makrodidaktischer Ansätze. Intensiv wurden eigene Überlegungen, Zugänge und Forschungsergebnisse ausgetauscht, diskutiert und vereinzelt auch ausgetestet. Die Tagung schloss mit vielen Anregungen, neuen Netzwerken und Kooperationsvorhaben sowie dem gemeinsamen Wunsch, den Austausch fortzuführen.
Der vorliegende Tagungssammelband bietet einen differenzierten Einblick in die Tagungsinhalte, bildet die Vielfalt und Innovation der Beiträge ab und macht sie damit einer breiten (Fach-)Öffentlichkeit zugänglich.
Einführend nimmt sich Stine Albers der Frage nach der Berechtigung personenbezogener Arbeit an Hochschulen an. Sie begründet deren Wichtigkeit aus bildungstheoretisch und psychoanalytisch orientierter sowie professionsorientierter Perspektive.
Grundsätzliche Überlegungen, wie eine Lernumgebung zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung auf Hochschulebene gestaltet werden kann, macht sich Judith Studer. Sie erläutert theoretisch und empirisch gestützte didaktische Prinzipien und gibt damit den Leserinnen und Lesern Anhaltspunkte für das eigene didaktische Handeln.
Seit der Antike gilt Philosophie als etablierter Weg zur gezielten Förderung von Persönlichkeitsentwicklung. Thomas Kriza zeigt auf, wie Philosophie an Hochschulen bei Studierenden die Fähigkeit fördert, als autonome, vernünftige und moralische Individuen Verantwortung zu übernehmen, und sie auf die beruflichen und persönlichen Anforderungen in einer sich rasant verändernden Welt vorbereitet.
René Rüegg postuliert kritisches Denken als eine der wichtigsten Persönlichkeitseigenschaften von Studierenden. Er legt einige Deutungsansätze vor und bewertet neuere didaktische Lernformen hinsichtlich ihres Nutzens für das kritische Denken im Hochschulstudium.
Mit dem Zusammenhang des Forschenden Lernens als didaktisches Konzept und der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt sich André Zdunek. Er tut dies in einem ersten Schritt, indem er die begrifflichen Konzepte klärt, um sie dann in einem zweiten Schritt lehrmethodisch zusammenzubringen.
Theaterpädagogik wird als Schnittstelle zwischen Bildung und Kunst beschrieben. Nathalie Fratini führt aus, wie durch den Einsatz theaterpädagogischer Methoden die Selbst- und Sozialkompetenzentwicklung von Studierenden unterstützt wird, und beschreibt ausgewählte theaterpädagogische Unterrichtsmethoden.
Ansätze der Gestaltpädagogik eröffnen vielfältige Möglichkeiten, die Persönlichkeitsentwicklung im Hochschulstudium der Sozialen Arbeit zu unterstützen. Sandra Meusel führt in die Entstehungsgeschichte des gestaltpädagogischen Ansatzes ein und erläutert interessante Anwendungsmöglichkeiten am Beispiel von Lehrveranstaltungen der Fachhochschule Erfurt.
Das neu entwickelte Curriculum der Fachhochschule St. Pölten soll neben der Wissensvermittlung auch den individuellen Entwicklungsprozessen der Studierenden Rechnung tragen. Ein Modulbereich im Studiengang ist deshalb explizit der Wechselbeziehung zwischen Profession und Person gewidmet. Christina Engel-Unterberger und Christine Haselbacher stellen Zielsetzungen und Ausgestaltung des Modulbereichs vor.
Peter Stade und Jacqueline Wyss geben Einblick in die Studienwoche «Arbeiten in und mit Gruppen» im Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit der Hochschule Luzern. Ziel dieses Formats ist das Erleben und Reflektieren gruppendynamischer Phänomene und des eigenen Verhaltens in Gruppensituationen zur Förderung spezifischer Aspekte berufsrelevanter Selbst- und Sozialkompetenzen.
Im Virtual Reality Lab des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit der Berner Fachhochschule üben Studierende Beratungsgespräche mit virtuellen Klientinnen und Klienten. Esther Abplanalp und Manuel Bachmann präsentieren diese neue didaktische Lernumgebung und beschreiben erste Erfahrungen aus der Perspektive der Selbst- und Sozialkompetenzentwicklung.
Die aus der Ethnografie entlehnte Metapher der Expedition dient Manuel Freis als Möglichkeit, Praxiserfahrung von Studierenden kontextbezogen zu spezifizieren. Er beleuchtet die Potenziale eines metaphorischen Nachdenkens über die Erfahrungen aus dem Praxissemester und die damit einhergehenden Gelegenheiten zur Persönlichkeitsentwicklung im Studium.
Der Ausbildungssupervision, die in vielen Studiengängen als praktikumsbegleitendes Lernformat eingesetzt wird, widmet sich Tim Middendorf. Er thematisiert in seinem Artikel den Beitrag der Ausbildungssupervision zur Persönlichkeitsentwicklung im Studium der Sozialen Arbeit.
Der Phase des Bachelor-Abschlusses nimmt sich Elke Schimpf an. Am Beispiel eines ethnografischen Feldforschungsprojekts zeigt sie auf, inwiefern der Studienabschluss für Studierende ein Konfliktfeld und damit ein Nährboden für die eigene Persönlichkeitsentwicklung darstellen kann.
Mandy Schulze und Maria Kondratjuk gehen davon aus, dass Hochschullehre ein relationales Zusammenspiel von Lehren und Lernen ist. Sie nehmen einen Perspektivenwechsel vor und thematisieren die Persönlichkeitsentwicklung von Studierenden aus der Sicht von Lehrenden.
Abschließend wirft Michael Stolle einen Blick in die Zukunft und zeigt auf, welche Schlüsselqualifikationen zukünftig gebraucht werden und welche Aufgabe dabei sogenannten Schlüsselqualifizierungseinrichtungen an Hochschulen zukommt. Dabei verortet er die Persönlichkeitsentwicklung im Kontext der digitalen Revolution.
Wir wünschen Ihnen anregende Lektüre.
Bern, im Februar 2019
Die Herausgeberinnen
Judith Studer, Esther Abplanalp und Stephanie Disler