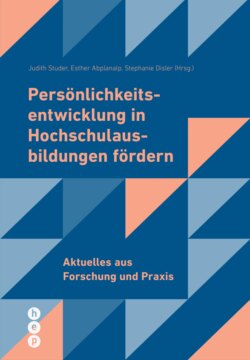Читать книгу Persönlichkeitsentwicklung in Hochschulausbildungen fördern (E-Book) - Группа авторов - Страница 12
3 Schlussfolgerungen
ОглавлениеDas in diesem Artikel dargelegte Verständnis von personenbezogener Arbeit ist untrennbar mit Reflexivität verbunden. Entsprechend basieren auch alle drei vorgestellten Begründungsperspektiven für personenbezogene Arbeit – bildungstheoretisch, psychoanalytisch und professionsorientiert – auf einem metakognitiven, kritisch-reflexiven Zugang zu sich selbst. Personenbezogene Arbeit ist in erster Linie auf den sich für die Person ergebenden subjektiven Wert der eigenen Bildung ausgelegt. Bildung steht an Hochschulen allerdings im Kontext der von den Studierenden intendierten Entwicklung berufsspezifischer Expertise.
«Damit wird eine Unterscheidung von Berufsausbildung und Persönlichkeitsbildung unmöglich. Die Persönlichkeit und ihre Bildung werden mindestens teilweise Bestandteil der pädagogischen Professionalität.» (Nieke, 2017, S. 138)
Eine kritisch-reflexive Auseinandersetzung mit Arbeitsumfeld und Arbeitsaufgaben sowie mit konkreten Situationen und Fällen im beruflichen Kontext stellt eine entscheidende Aufgabe in «sozialen Berufen» dar (Dauber, 2006; Dewe, 2013 u. a.). Hochschulen stellen einen geeigneten Ort zur Förderung von Reflexivität dar: «[D]er Einstieg in die Habitualisierung von Reflexivität lernt sich unter den Bedingungen der Hochschule leichter als unter dem Handlungsdruck des Alltags» (Tenorth, 2006, S. 591).
Personenbezogene Arbeit wird als eine notwendige Bedingung für eine vielschichtig-umfassende und langfristig für die Person tragende und vertiefende theoretische und praxisorientierte Auseinandersetzung mit berufsspezifischen Inhalten an Hochschulen gehalten. Die durch die Bologna-Reform angestoßenen hochschulpolitischen Entwicklungen in den letzten Jahren sind vermutlich ein gewichtiger Grund, warum personenbezogene Arbeit an Hochschulen dennoch weiterhin wenig populär zu sein scheint. Die Reform ging häufig mit einer Orientierung an Kompetenzformulierungen im Sinne von Standardisierungen und Outputorientierungen einher, die wiederum ein Korsett bilden, dem sich ein kritisch-reflexiver, ergebnisoffener Prozess entzieht. Personenbezogene Arbeit und Kompetenzorientierung scheinen häufig als «zwei verschiedene Erzählweisen» (Fischer, 2016, S. 15) ausgelegt zu werden:
«Die eine handelt davon, wie Entwicklung einmündet in einen bereitgestellten objektiven Bestand an Werkzeugen, die zur kulturellen Teilhabe befähigen. Die andere bleibt nahe am Individuum, um die Entfaltung der in ihm angelegten Möglichkeiten und ihr Zusammenspiel in einer eigenen beseelten Form zu beleuchten.» (A. a. O., S. 15)
Im Sinne eines divergent-selbstorganisativ ausgelegten Kompetenzverständnisses – wenn Kompetenzerwerb also als kreativer Prozess mit unterschiedlichen Problemlösungsstrategien aufgefasst wird (Erpenbeck & von Rosenstiel, 2007, S. XIX; XXXVI) – ginge es darum, personenbezogene Arbeit und Kompetenzorientierung gemeinsam zu denken.
Um personenbezogene Arbeit an Hochschulen zu etablieren, bedürfte es häufig eines «Sich-in-Bewegung-Setzens» im Sinne von Entwicklungsprozessen, und zwar in mindestens zweifacher Hinsicht:
– Zum einen organisatorisch durch eine Hinwendung zur Person als Bezugssystem im Hochschulstudium. Personenbezogene Arbeit stellt eine Querschnittsaufgabe im Hochschulstudium dar, die auf einer Makroebene in jedem Studiengang, auf einer Mesoebene in jedem Modul und Seminar und auf einer Mikroebene in jeder Seminarsitzung mitgedacht werden und Berücksichtigung finden sollte.
«Die zur Verfügung stehende Zeit nimmt dabei einen ebenso entscheidenden Faktor ein wie die Organisation der (intersubjektiven) Interaktion: Erleichtert wird der Einbezug reflexiver Positionierungen, wenn sich möglichst heterogene Gruppen verständigen.» (Müller, 2018b, S. 119)
– Zum anderen intrapersonell durch das Sich-Einlassen auf «innere» (kognitiv-emotionale) Prozesse aufseiten der Studierenden und der Lehrenden. Doch
«Reflexion lässt sich nicht verordnen. Die Eigenständigkeit der je Einzelnen sowie aller, die sich auch in dem Vermittlungsverhältnis von Individuum und Gesellschaft findet, steht dem entgegen.» (Müller, 2018c, S. 181)
Reflexivität bedarf als spezifischer Zugang zu sich selbst nicht nur der Übung, sondern geht auch mit Unsicherheit einher, fordert sie doch von den Beteiligten, sich als Personen einzubringen, damit auch unangenehme Gefühle und Bedürfnisse zu offenbaren und anderen gegenüber verletzlich zu erscheinen. Deshalb geht es bei der Anbahnung personenbezogener Arbeit gegebenenfalls zunächst darum, eine etwaige wahrnehmbare Ablehnung des Sich-drauf-Einlassens als widerständiges Moment mit den Studierenden zu thematisieren. Für personenbezogene Arbeit bedarf es einer vertrauensvollen Rahmung mit empathisch und sensibel handelnden Lehrenden, die die Anliegen der Studierenden ernst nehmen und einen ebensolchen Umgang zur Bedingung für die gemeinsame Interaktion machen. Für die Studierenden kommt dem Lehrenden in seiner Zugewandtheit als «Container» (Bion, 1992 [1962], S. 146) Bedeutung zu. Das heißt, dass sie einen Teil ihres Selbst – unangenehme Gefühle – auf die lehrende Person projizieren. Als «contained» (ebd.) Objekt kommt ihr die Aufgabe zu, diese Projektionen zu «tragen», damit verantwortungsvoll umzugehen und sie «verdaubar» für die Studierenden zu machen. Sie können später von den Studierenden wieder – ertragbar – reintrojiziert werden.
In diesem Beitrag wird personenbezogene Arbeit im Sinne der Erweiterung des Denk-, Urteils- und Handlungsraumes der Studierenden gesehen. Die intendierte Autonomie für die jeweilige Person geht allerdings mit der Annahme von Defiziten beim bisherigen Reflexionsvermögen der Studierenden einher sowie mit dem aufoktroyierten «Zwang», sich im Hochschulstudium personenbezogener Arbeit zu unterziehen. Es wird der «Doppelcharakter von Subjektivität» (Müller, 2018a) deutlich. Personenbezogene Arbeit bewegt sich im unauflöslichen Spannungsfeld von Förderung und instrumentellen Einbezügen. Diese Dialektik gilt es auszuhalten (siehe dazu auch Abschnitt 2.1), das heißt:
«Es geht nicht um den alleinigen Bezug auf die eine oder die andere Seite, sondern um eine entscheidende Differenzierung, die Chancen und Probleme für die Erweiterung und die Einschränkung von Subjektivität[4] auf beiden Seiten verortet.» (A. a. O., S. 103)
Personenbezogene Arbeit ist eine anspruchsvolle und dabei ebenso wichtige wie gewichtige Aufgabe im Hochschulstudium.