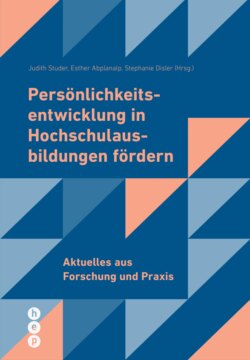Читать книгу Persönlichkeitsentwicklung in Hochschulausbildungen fördern (E-Book) - Группа авторов - Страница 17
2 Ansätze zur Kompetenzförderung
ОглавлениеSind die im Studium zu erwerbenden Selbst- und Sozialkompetenzen festgelegt, stellt sich die Frage, wie deren Entwicklung didaktisch unterstützt werden kann. Die Literatur antwortet auf diese Frage vorwiegend mit dem Verweis auf die klassischen (behavioristischen, sozial-kognitiven und kognitiven) Lerntheorien. Ein Konzept jüngeren Datums, dem ebenfalls Potenzial hinsichtlich der Förderung von Selbst- und Sozialkompetenzen zugeschrieben wird, ist das «Konzept des problemorientierten Lernens» (vgl. Euler & Hahn, 2014, S. 118 ff.). Ausgangspunkt für das Erlernen von Kompetenzen bilden diesem Konzept zufolge möglichst praxisbezogene und herausfordernde Problemstellungen, die an den Lernzielen und den Voraussetzungen der Lernenden auszurichten sind. Dadurch wird der Erwerb von Handlungskompetenzen im (hoch-)schulischen Rahmen mit ihrer Anwendung im Praxisfeld verknüpft. Durch die Verortung des Problemlösens in unterschiedlichen Kontexten kann das Anwenden der Kompetenzen zusätzlich erleichtert werden. Nach von Rosenstiel (2012, S. 113) ist es grundsätzlich die Auseinandersetzung mit Herausforderungen, die zur Entwicklung von Kompetenzen führt. Solche Herausforderungen können sich seines Erachtens infolge unerwarteter, komplexer Situationen ergeben, wie sie beispielsweise in Praktika während der Studienzeit anzutreffen sind.
Ein weiterer Ansatz, der zur didaktischen Unterstützung der Kompetenzentwicklung in der Literatur vorzufinden ist, ist das «Prinzip des problembezogenen Lernens durch Erfahrung» (vgl. Euler, 2012, S. 186 ff.; Euler & Walzik, 2009, S. 129 ff.). Grundlage des Lernens bilden nach diesem Prinzip konkrete Erfahrungen, deren Reflexion zur Entwicklung von Kompetenzen führt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Reflexion einem Nachdenken über eine erlebte Situation oder einem Vordenken zukünftiger Handlungen gleichkommt. Entscheidend für die Kompetenzentwicklung ist dem Prinzip zufolge die Verzahnung von Erleben (im Sinne der Auseinandersetzung mit vergangenen [eigenen wie fremden] Geschehnissen), Erproben (im Sinne des eigenen Agierens in konkreten Situationen) und Reflektieren – oder wie bereits Dewey (2000, S. 215) und Schön (1983) betont haben: die Verknüpfung von Handlung und Reflexion.
Dass die Kompetenzentwicklung der Reflexion bedarf, darüber sind sich viele Autorinnen und Autoren einig (u. a. Euler, 2012, S. 186 ff.; Gerber & Müller, 2014, S. 37; Greif, 2008, S. 20; Müller, Gerber & Markwalder, 2014; Müller Fritschi, 2013; Reis, 2009; von Rosenstiel, 2012, S. 113 ff.). Als förderlich wird sowohl das Reflektieren als Einzelperson als auch das Reflektieren in Gruppen angesehen. Letzteres kann beispielsweise das gemeinsame Auswerten und gegebenenfalls Generalisieren von Erfahrungen (von Rosenstiel, 2012, S. 113), das Bewusstmachen eigener, aber auch fremder Stärken und Schwächen (a. a. O., S. 14) wie auch das gemeinsame, dialogartige Hinterfragen des Wissens und Könnens, das sich in konkreten Praxishandlungen zeigt (Schön, 1987, S. 100 ff.), umfassen. Im Hinblick auf die Förderung der Kompetenzenzwicklung scheint es Greif (2008, S. 37) zufolge jedoch wichtig zu sein, in Abgrenzung zu ziellos kreisenden Grübeleien ergebnisorientierte Reflexionen anzustreben. Diese zeichnen sich durch ein systematisches Vorgehen und ein praktisch verwertbares Ergebnis aus.
Den Blick in die Literatur zusammenfassend, lässt sich festhalten, dass die Förderung der Kompetenzentwicklung Folgendes notwendig macht:
– Authentische, praxisbezogene und herausfordernde Problemstellungen als Ausgangspunkt von Lernprozessen. Die Problemstellungen sind dabei an den Lernzielen und Lernvoraussetzungen der einzelnen Studierenden auszurichten. Mit anderen Worten: Die Studierenden sind bei der Förderung von Kompetenzen mit ihrem je eigenen Lern- und Entwicklungsrucksack zu berücksichtigen.
– Eine flexible Herangehensweise an die Lerngegenstände und die Verortung der Problemlösung in unterschiedlichen Kontexten.
– Die Verzahnung von Erleben, Erproben und Reflektieren – sprich die Verknüpfung von Handeln und Reflektieren, wobei die Reflexion individuell oder in einer Gruppe erfolgen kann, in jedem Fall aber systematisch und auf ein Ergebnis ausgerichtet vollzogen werden soll.
So weit, so gut. Die Schwierigkeit besteht nun darin, dass damit noch sehr wenig Hilfestellung geboten wird, wie denn nun auf Hochschulebene eine Lernumgebung zur Förderung berufsrelevanter Selbst- und Sozialkompetenzen konkret lehrmethodisch auszugestalten ist. Konkretere Orientierung bieten hierfür didaktische Gestaltungsprinzipien, wie sie in ihrer Entstehungsgeschichte und ihrem Inhalt in den nachfolgenden Abschnitten erläutert werden.