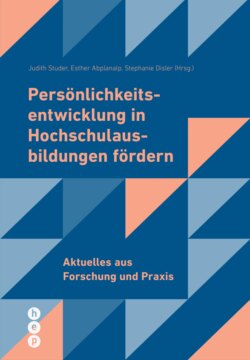Читать книгу Persönlichkeitsentwicklung in Hochschulausbildungen fördern (E-Book) - Группа авторов - Страница 22
Philosophie an Hochschulen für angewandte Wissenschaften: Wege zur Persönlichkeitsbildung Abstract
ОглавлениеPhilosophie ist ein seit der Antike etablierter Weg zur gezielten und methodischen Förderung der Persönlichkeitsbildung. Mit den gegenwärtigen gesellschaftlichen Transformationsprozessen, die durch die Dynamiken moderner Technik wie der Digitalisierung ausgelöst werden, gewinnen Philosophie und namentlich Ethik an Fachhochschulen zunehmend an Bedeutung: Diese Prozesse erfordern reflektierte ethische Entscheidungen vor dem Hintergrund einer infrage stehenden Wertebasis. Ziel von Persönlichkeitsentwicklung durch Philosophie ist die Förderung von Studierenden in ihrer Fähigkeit, als autonome, vernünftige und moralische Individuen Verantwortung zu übernehmen.
Fachhochschulen bzw. Hochschulen für angewandte Wissenschaften vermitteln durch anwendungsbezogene Lehre und Forschung in erster Linie «eine Bildung, die zur selbstständigen Anwendung wissenschaftlicher Methoden und künstlerischer Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt» (Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG). Philosophie gehört üblicherweise nicht zu den an Fachhochschulen unterrichteten Kernfächern oder Studiengängen. Dennoch bekommt Philosophie eine zunehmende Bedeutung auch für Fachhochschulen in dem Maß, wie auch der Stellenwert der Persönlichkeitsbildung von Studierenden in Hochschulausbildungen und die Relevanz von ethischen und philosophischen Fragestellungen innerhalb der angewandten Wissenschaften zunehmen. Es stellt sich daher die Frage, welche Rolle Philosophie für die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung an Fachhochschulen spielen kann und wie diese Rolle mit der Thematisierung von ethisch-philosophischen Fragestellungen innerhalb der angewandten Wissenschaften zusammenhängt.
Hochschulen für angewandte Wissenschaften «befinden sich aktuell in einem Spannungsfeld zwischen der gesellschaftlichen Verantwortung für die Persönlichkeitsentwicklung der immer jünger werdenden Studierenden und einer anspruchsvollen und tragenden wissenschaftlichen Ausbildung» (Hochschule Coburg, 2015, S. 4). Fachhochschulen wie die Hochschule Coburg definieren eine «ganzheitliche, kulturell und interdisziplinär ausgerichtete Bildung» und die Befähigung zu «gesellschaftlich verantwortlichem Handeln» als Leitbilder und explizit auch als strategische Ziele der Hochschule (Hochschule Coburg, 2015, S. 26, 28). Mit groß angelegten interdisziplinären Projekten wie dem «Coburger Weg»[1] wird nicht zuletzt auch Philosophie zum integralen Bestandteil einer interdisziplinär ausgerichteten, studiengangübergreifenden Lehre, die den Blick der Fachhochschulstudierenden – über den Tellerrand der eigenen Fachlichkeit hinaus – auf wichtige und weitreichende Fragen lenken soll, die sich im persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Leben eines Menschen und nicht zuletzt auch eines jeden Berufsmenschen stellen. Welchen Beitrag leistet Philosophie zur methodischen Förderung der Persönlichkeitsbildung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften?
Begriffe wie «Persönlichkeitsbildung», «Persönlichkeitsentwicklung» und «Persönlichkeitsentfaltung» sind in unterschiedlichsten Praxiskontexten weit verbreitet. Die Begriffsverwendung ist vieldeutig und nicht selten auch floskelhaft, insbesondere wenn die «kritische Reflexion der […] zugrunde liegenden Annahmen, Werte und Menschenbilder» (Rogmann, 2016, S. 142) fehlt. Auch in der Hochschuldidaktik sind diese Begriffe präsent – die vieldeutige Begriffsverwendung geht jedoch nur mit einer spärlichen erziehungswissenschaftlichen Theoriebildung und dazugehörigen empirischen Forschung einher (Budde & Weuster, 2018, S. 5). Trotz der Vielfältigkeit und Vagheit der jeweiligen Definitionen und begrifflichen Verwendungen kreist die Allgegenwart der Forderung nach Persönlichkeitsentwicklung im Kern um die Idee, dass die menschliche Persönlichkeit etwas Gestaltbares und zu Gestaltendes darstellt, dass «Bildung» hierfür eine entscheidende Rolle spielt und dass sich diesbezüglich in der Situation der Moderne und insbesondere in der aktuellen Gegenwart besondere Herausforderungen stellen, die in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kontexten zu bewältigen sind (a. a. O., S. 6 f.).
Verstehbar wird die Idee einer zu bildenden menschlichen Persönlichkeit insbesondere vor dem übergreifenden Hintergrund des modernen Menschenbildes und seiner Ursprünge, die bis in das antike Denken zurückreichen. Dessen Grundpfeiler können im Rahmen dieses Aufsatzes zumindest angedeutet werden: Die antike Auffassung des Menschen als vernunftbegabtes und soziales Lebewesen[2] entfaltet bis in die heutige Zeit ihre bestimmende Wirkung. Die christliche Vorstellung menschlicher Individualität bekam in der Renaissance eine neue Dynamik, löste sich im Verlauf der Neuzeit zunehmend von ihren religiösen Wurzeln ab und radikalisierte sich in der Moderne bis in die Gegenwart hinein (Kriza, 2018, S. 151–213). Zum Kern des modernen Personseins gehören die Idee des freien menschlichen Willens[3] und die Auffassung, dass der Mensch seine Lebensweise frei zu wählen habe[4] – aber zugleich auch die Vorstellung einer Moralität, die in der vernünftigen Autonomie des Menschen ihren Ursprung nimmt.[5] Im modernen Menschenbild verbinden sich freie Selbstbestimmung, moralische Verantwortlichkeit und Rationalität. Der Zusammenhang dieser bestimmenden Facetten kommt in der Vorstellung einer besonderen Würde des Menschen zum Ausdruck. Die abstrakte Idee der Menschenwürde entfaltet ihre Wirkung durch ihre Konkretisierungen, nicht zuletzt in der Ausgestaltung von Menschenrechten (Bielefeldt, 2011, S. 105–144). Die Auffassung des Menschen als freies und selbstbestimmtes, vernünftiges und moralisches Individuum, das sich im Zusammenleben mit anderen Menschen die Gesetze seines Lebens selbst auferlegt und sich in seiner Ganzheit durch eine besondere Würde auszeichnet, konstituiert das moderne Bild des Menschen. An diesem Bild hängen die Idee des Personseins und zugleich auch die Vorstellung, dass die Persönlichkeit des Menschen erst entwickelt, entfaltet bzw. gebildet werden muss.
Das menschliche Leben ist, anders als beim Tier, kein durch Instinkte weitgehend festgelegter Ablauf: Menschen können ihr Leben – sowohl in individueller als auch in gesellschaftlicher Hinsicht – ganz unterschiedlich leben. Und weil sich ihr Leben nicht als ein Automatismus vollzieht, müssen sich Menschen um ihr Leben kümmern: Sie müssen sich aktiv darum bemühen, dass sich ihr Leben zu einem guten Leben entwickelt. Das antike Denken hat hierbei eine bis heute einflussreiche Unterscheidung getroffen: Menschen können entweder ihr Leben einfach laufen lassen, sich nur auf die Befriedigung ihrer unmittelbaren materiellen Bedürfnisse fokussieren, sich den Dynamiken ihres sozialen Umfeldes unreflektiert hingeben – oder aber sie können danach streben, ihr Leben in einer bewussten und reflektierten Weise aktiv zu gestalten und dabei die wertvolleren, höheren Potenziale, die in ihnen als Möglichkeiten angelegt sind, zur Entfaltung kommen zu lassen. Die Interpretation des guten Lebens als ein zielgerichtetes und durch Reflexion begleitetes Streben nach höheren Zielen, nach wertvolleren Weisen des Lebens, nach methodischer Veredelung und Vervollkommnung der Persönlichkeit ist eine Vorstellung, die – trotz aller inhaltlicher Verschiedenheit – die einflussreichen philosophischen und religiösen Strömungen des antiken Denkens mit vielen späteren und gerade auch modernen Auffassungen des guten Lebens verbindet – wenn auch mit entscheidenden Brüchen.[6] Derartige Vorstellungen finden sich bei Platon, Aristoteles, den Stoikern wie auch im Christentum, sie finden sich bei den Denkern der Renaissance und der Aufklärung, sie bilden den Kern des vielzitierten Humboldt’schen Bildungsideals (z. B. Budde & Weuster, 2018, S. 14 f.), und sie befeuern noch das Denken Friedrich Nietzsches, des vermeintlichen Zertrümmerers aller Traditionen (Kriza, 2018, S. 213–220). Hierbei ist es keine Nebensächlichkeit, dass eine kulturell derart wirkungsmächtige Idee – die Auffassung, dass Menschen für ein gutes und glückliches Leben ihre Persönlichkeit aktiv und zielgerichtet bearbeiten und entwickeln müssen – mit Namen und Positionen von Philosophen verknüpft ist. Philosophie stellte in ihren antiken Ursprüngen die zentrale Methode der Persönlichkeitsentwicklung dar, und die dazugehörigen Vorstellungen entfalten bis heute ihren Einfluss. Was bedeutet Philosophie in diesem ursprünglichen Sinn?
In der antiken Vorstellung von Philosophie war der Aspekt der Reflexion direkt mit der Gestaltung des menschlichen Lebens verbunden: Es ging nicht primär um den Entwurf von theoretischen Systemen des Denkens, sondern um die Entwicklung von umfassenden Entwürfen des Lebens. Nach den Werken von Pierre Hadot (1991) und des späten Michel Foucault (2004; 2005, S. 747–776, 902–909) kann annähernd die gesamte antike nachsokratische Philosophie als geistige Übungen verstanden werden, die eine grundlegende Transformation des Lebens zum Ziel hatten (Kriza, 2018, S. 88–101, 114–128; Kriza 2019). Durch die gezielte Herausbildung menschlicher Vernünftigkeit sollte der Blick des Menschen weg vom niederdrückenden Irdischen hin auf etwas Höheres, Göttliches umgelenkt und ausgerichtet werden. Im antiken Streben nach Erkenntnis durch Wissenschaft und Philosophie lag die Bemühung, die eigene Persönlichkeit zu formen: Durch Einblick in die Wahrheit über die Zusammenhänge der Welt und durch Orientierung an der göttlichen kosmischen Ordnung sollte im Menschen eine analoge vernünftige Ordnung zur Entfaltung gebracht werden, um auf diesem Weg ein gutes Leben zu ermöglichen. Die geistigen Übungen der Philosophie hatten, als Arbeit am eigenen Selbst, das Ziel, die Persönlichkeit des Menschen zielgerichtet zu gestalten und zu bilden, um die im Menschen angelegten höheren Möglichkeiten als das wesenhaft Menschliche zur Entfaltung zu bringen.
Heute, in modernen Kontexten des Denkens, erscheinen dieses antike Verständnis von Wissenschaft und Philosophie und insbesondere die dazugehörige Weltsicht und Wahrheitsauffassung eher als etwas Fremdes – die Grundidee hingegen, dass Menschen ihre Persönlichkeit zielgerichtet zu verändern, zu bilden und zu entwickeln haben, um gut zu leben, hat ihre Faszination bis heute nicht verloren. Bedeutende Strömungen der modernen Philosophie können als Versuch interpretiert werden, das antike Verständnis von Persönlichkeitsbildung als Arbeit am eigenen Selbst in moderne Kontexte des Denkens zu transformieren (Kriza, 2018, S. 213–294). Die Allgegenwart von körperlichen und geistigen Übungsbewegungen in unterschiedlichen Kontexten der Gegenwart belegt die heutige Lebendigkeit derartiger Auffassungen (Sloterdijk, 2009; Kriza, 2018, S. 128–150). Zu diesen Kontexten gehört nicht zuletzt auch der Bildungsbereich.
Die zeitgenössische Philosophiedidaktik kann als Anknüpfung an das antike Philosophieverständnis aus dem Blickwinkel des modernen Menschenbildes interpretiert werden. Der Mensch in der Moderne, begriffen als freies und autonomes Individuum, sieht sich vor die Herausforderung gestellt, seine Freiheit und moralische Verantwortlichkeit stets erst herausbilden zu müssen. Die Philosophiedidaktik versteht hierbei Philosophie in einem weitgehenden Konsens als eine Schulung des Selberdenkens in der Tradition des antiken und aufklärerischen Denkens, oft in expliziter Anknüpfung an Sokrates und Immanuel Kant (Tiedemann, 2017b, S. 14 f.; Steenblock, 2017a, S. 30–33; Steenblock, 2017b, S. 58–65; Martens, 2017, S. 41–47). So interpretiert Ekkehard Martens Philosophie als eine «elementare Kulturtechnik» und als Mittel, um «das Selbstdenken und somit die Autonomie der Person zu fördern», und bezieht dabei die Philosophie direkt «auf den Zweck der Persönlichkeitsbildung und eine humane Lebensgestaltung» (Martens, 2017, S. 46). Volker Steenblock verortet philosophische Bildung in der Tradition Platons und Wilhelm von Humboldts im allgemeinen «Bemühen um ein selbst verantwortetes und gestaltetes Wissen» als Grundlage eines menschlichen Lebens, das als Projekt bewusster und autonomer Gestaltgebung aufzufassen ist (Steenblock, 2017b, S. 58, 63–65). In dieser die Antike und Neuzeit verbindenden Traditionslinie wird die menschliche Existenz als die Herausbildung einer Persönlichkeit interpretiert, die «sich aus einem letzten, verantworteten Prinzip heraus zu steuern sucht» (a. a. O., S. 58). Bedingung hierfür ist, dass der Mensch über die relevanten Aspekte, Ziele und Konsequenzen des eigenen Lebens und Denkens reflektiert Rechenschaft geben kann. Die Herausbildung dieser Fähigkeit ist seit jeher eine Kernaufgabe der Philosophie und erstreckt sich insbesondere auch auf die gezielte Schulung der «Urteilskraft, verstanden als Fähigkeit zur kritisch rationalen Argumentation sowie sicheren Verwendung von Begriffen und kategorialen Unterscheidungen» (Tiedemann, 2017a, S. 26).
Die aktuelle Philosophiedidaktik hebt in einem weitgehenden Konsens und zu Recht die Orientierungsfunktion der Philosophie hervor und betont deren besondere Relevanz vor dem Hintergrund heutiger Herausforderungen. So erinnert Julian Nida-Rümelin an den Orientierungsbedarf Jugendlicher in einer komplexen sozialen Welt, die durch globale Verflechtungen und durch eine rasant voranschreitende Technik besondere ethische Fragestellungen mit sich bringt (Nida-Rümelin, 2017, S. 19). Auch Markus Tiedemann betont den besonderen Orientierungsbedarf der Moderne und ruft in Erinnerung, dass geschichtlich Philosophie gerade in Zeiten von Orientierungskrisen ihre Blütezeiten erlebt hat (Tiedemann, 2017a, S. 23). Ethische Neuorientierung ist zwar kein Alleinstellungsmerkmal unserer Zeit, stellt aber heute eine besondere Herausforderung dar, weil die gegenwärtige Innovationsgeschwindigkeit der Technik die Handlungsoptionen und den Entscheidungsbedarf des Menschen ins Unüberschaubare ausweitet und dabei die Dringlichkeit mit sich bringt, weitreichende ethische Entscheidungen auf Grundlage eines fraglich gewordenen kulturellen Wertefundamentes zu fällen (a. a. O., S. 23–26). Als Charakteristikum der heutigen Zeit identifiziert Tiedemann zu Recht die Tatsache, dass dringliche praktische Probleme ethische Entscheidungen erfordern, «deren theoretische Grundlage selbst als problematisch gilt» (Tiedemann, 2017c, S. 71). Die heutigen Anforderungen verlangen daher eine «nachdenkliche Werteentwicklung» statt einer «traditionelle[n] Wertevermittlung», und Adressat hierfür ist nicht zuletzt die Philosophie (Tiedemann, 2017a, S. 27). In die gleiche Richtung argumentiert auch Volker Steenblock, der Bildung und insbesondere philosophische Bildung als «Antwortversuch auf gesellschaftliche Transformationen» in einer kulturellen Situation interpretiert, in der «der Einfluss lebensregelnder und sinnstiftender Traditionen zurückgeht» (Steenblock, 2017b, S. 59, 61). All dies verdeutlicht den heutigen Stellenwert von Persönlichkeitsbildung in Bildungsbereich und die besondere Rolle der Philosophie.
Welche Schlussfolgerungen lassen sich für Hochschulen für angewandte Wissenschaften ziehen? Der Ruf nach Persönlichkeitsbildung an Fachhochschulen wurzelt zunächst unmittelbar in der modernen Auffassung des Menschseins: Insofern sich Menschen als freie und selbstbestimmte, vernünftige und moralische Individuen verstehen, stehen sie vor der Herausforderung, sich als solche herauszubilden. Fachhochschulen sind als Bildungsinstitutionen Orte, an denen Studierende sich als Persönlichkeiten herausgestalten. Daher ist auch das Studium an Fachhochschulen nicht nur als eine Vermittlung von Fachkompetenzen, sondern in einem erweiterten Sinne als eine methodische Unterstützung der Persönlichkeitsbildung der Studierenden zu verstehen – gerade auch im Hinblick auf ihre Fähigkeit, reflektierte moralische Positionen einzunehmen. Philosophie ist, seit ihren antiken Ursprüngen bis in die heutige Zeit hinein, im Kern ein Weg, um die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen bewusst und methodisch zu fördern. Daher liegt es nahe, philosophische Bildung auch an Hochschulen für angewandte Wissenschaften zu verankern – in Einklang mit der Einsicht, dass die gezielte Förderung der Persönlichkeitsentwicklung auch für Fachhochschulen eine Kernaufgabe darstellt.
Konfligiert die Verortung von Philosophie in Hochschulcurricula mit der Notwendigkeit, in kurzer Zeit fundiertes Fachwissen zu vermitteln? Zu einem gewissen Grad mag dies der Fall sein, jedoch ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich gegenwärtig die Prioritäten in einer bemerkenswerten Weise verschieben. Gerade weil moderne Technik sich mit all ihren Facetten in nie dagewesener Geschwindigkeit weiterentwickelt, weil dabei die Innovationsgeschwindigkeit noch zunimmt und weil sich moderne, entwickelte Gesellschaften in umwälzenden Transformationsprozessen befinden, kann selbst eine konsequent praxisorientierte Hochschulausbildung nicht das primäre Ziel haben, Studierende auf die konkreten Aufgaben der Arbeitswelt vorzubereiten. Selbst in Bildungskontexten, die weitestgehend auf Praxisorientierung ausgerichtet sind und unter hohem Zeit- und Kostendruck stehen, kann eine Ausweitung des Bildungsziels in Einklang mit Effizienzüberlegungen stehen oder gar direkt aus solchen abgeleitet werden. Ein interessantes Beispiel ist die Firma Siemens in den USA: Vor die Aufgabe gestellt, für ein neu zu bauendes Gasturbinenwerk in North Carolina 1500 neue Mitarbeiter zu rekrutieren, hatte sich Siemens aufgrund eines Mangels an qualifizierten Bewerbern erfolgreich dafür entschieden, ein eigenes Trainingsprogramm aufzusetzen und zu finanzieren. Modell hierfür war die aus Deutschland bekannte Berufsausbildung bzw. das duale Studium. In diesem Zusammenhang vor die Frage gestellt, was ein vierjähriges praxisorientiertes Hochschulstudium beinhalten sollte, gab die CEO von Siemens USA, Barbara Humpton, folgende Antwort:
«I’m not looking to universities to get people ready for a job. I’m looking for universities to get people ready for a career. Because technology’s changing so fast […]. I think four-year institutions can very happily focus on the kind of traditional things they’ve done, giving people a really well-rounded background, teaching the arts, teaching humanities, teaching people for context and appreciation.» (White, 2019)
Geistige Flexibilität ist heute eine der zentralen Kompetenzen für eine lebenslange Karriere in sich rapide verändernden Kontexten. Eine systematische Förderung der Persönlichkeitsentwicklung durch Philosophie kann neben dem übergreifenden Ziel der Herausbildung einer reflektierten, selbstbestimmten Persönlichkeit auch den Effekt einer geistigen Beweglichkeit mit sich bringen, die gerade in heutigen Praxiskontexten eine Kernkompetenz darstellt. Werden hierbei die «hohen» geistigen Ziele von Bildung durch eine monetarisierbare Leistungsoptimierung profanisiert?[7] Selbst wenn man dies so sehen mag, könnte im «Nebeneffekt» einer herangereiften, gebildeten Persönlichkeit ein eigener, davon unberührter Wert gesehen werden.
Ihre besondere und auch dringliche Relevanz gewinnt philosophische Bildung in den praxisorientierten Kontexten heutiger Technik aber insbesondere durch die weitreichenden ethischen Fragen, die moderne Technik aufwirft. Unter diesem Gesichtspunkt hat Philosophie auch für Hochschulen für angewandte Wissenschaften eine besondere Relevanz: Die neuen Möglichkeiten einer immer mächtigeren Technik verlangen nach reflektierten ethischen Positionierungen. Gerade Philosophie kann hier die Suche nach intersubjektiv tragfähigen Antworten vor dem Hintergrund einer pluralen und sich verändernden Wertebasis gezielt und methodisch unterstützen.
Ein Kernaspekt heutiger Technik ist die fortschreitende Digitalisierung: Sie erfasst alle Lebensbereiche und Berufsfelder und transformiert dabei Arbeits- und Lebensweisen, soziale Strukturen, politische Dynamiken und nicht zuletzt auch die grundlegenden Auffassungen des Menschseins. Die daraus resultierenden ethischen Fragen sind vielgestaltig. Auf gesellschaftlicher Ebene ergeben sich Fragen wie: Welche bisher ungekannten Lebensweisen werden ermöglicht, wenn dem Menschen ein Großteil der Arbeit durch Maschinen und automatisierte Prozesse abgenommen wird? Wie können die durch Digitalisierung und Automatisierung erzielten Produktivitätsgewinne gerecht verteilt werden? Und wie geht eine Gesellschaft damit um, dass die Digitalisierung möglicherweise neue soziale Spaltungen zwischen Profiteuren und Abgehängten erzeugt? Es stellen sich aber auch ethische Fragen, die nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene, sondern direkt auch in praktischen Kontexten der Arbeitswelt von Bedeutung sind: Die umfassende Erhebung von persönlichen Daten mittels moderner Informationstechnik durch Privatunternehmen und Staaten und die automatisierte Zusammenführung dieser Daten durch Big-Data-Analysen zu Persönlichkeitsprofilen wirft etwa die ethische Frage nach einer Balance zwischen den Vorteilen dieser Technologien und dem Stellenwert menschlicher Privatsphäre auf. Praktisch jeder Mensch muss heute davon ausgehen, dass bei Unternehmen und Staaten vielfältige, ihn betreffende persönliche Daten zu Persönlichkeitsprofilen zusammengefügt werden, ohne dass sich dabei das genaue Ausmaß vor Augen führen ließe.[8] Noch vor wenigen Jahrzehnten urteilten deutsche Verfassungsrichter, dass genau hierin eine wesentliche Hemmung von Freiheit und Selbstbestimmtheit liegt, und kamen zu folgendem Schluss: «Freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt unter den modernen Bedingungen der Datenverarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus» (BVerfG, 1983). Der Schutz der Privatsphäre wurde direkt im obersten Wert einer unantastbaren Menschenwürde verankert, dem es widerspricht, den Menschen «zwangsweise in seiner ganzen Persönlichkeit zu registrieren und zu katalogisieren […] und ihn damit wie eine Sache zu behandeln, die einer Bestandsaufnahme in jeder Beziehung zugänglich ist» (BVerfG, 1969). Gilt das auch heute noch, im Zeitalter von Facebook und Google? Welche Relevanz spielt Privatsphäre heute? Wie sollen zum Beispiel IT-Fachkräfte mit der technischen Möglichkeit umgehen, dass bereits relativ wenige Datenpunkte wie etwa einige Dutzend Facebook-«Likes» bei einer ausreichenden Menge von Daten erstaunlich tiefe Einblicke gewähren können (Kosinski, Stillwell & Graepel, 2013; Youyou, Kosinski & Stillwell, 2015)? Sollten zum Beispiel einer automatisierten Gesichtserkennung ethische Grenzen gesetzt werden, sobald klar wird, dass hierdurch bei einer großen Datenbasis sogar intime Persönlichkeitsmerkmale wie etwa sexuelle Präferenzen offengelegt werden können (Murphy, 2017; Wang & Kosinski, 2018)? In ganz konkreten beruflichen Kontexten stellen sich heute explizit philosophische Fragen: Müssen wir unsere zentralen Wertvorstellungen von Privatsphäre, freier Selbstbestimmung oder einer unantastbaren Menschenwürde den neuen Möglichkeiten der Technik anpassen? Und wenn ja, wie genau? Derartige Fragen verlangen gerade durch die praktischen Einsatzmöglichkeiten der Technik nach fundierten, intersubjektiv mitteilbaren Antworten. Unerlässlich hierfür ist ein Bewusstsein um kulturelle Wertvorstellungen und die Fähigkeit, auf dieser Basis in konkreten Anwendungskontexten begründete ethische Argumente formulieren und mit anderen austauschen zu können. Die Herausbildung dieser Kompetenzen kann durch Philosophie methodisch gefördert werden, und gerade Studierende von angewandten Wissenschaften können durch Philosophie auf die ethischen Fragen vorbereitet werden, die unweigerlich mit dem Einsatz moderner Technik einhergehen und die sie unmittelbar in Praxiskontexten stellen und beantworten müssen.
Heutige Technik wirft in ganz unterschiedlichen Kontexten ethische und philosophische Fragen auf, die eine Auseinandersetzung mit grundlegenden Wertfundamenten erfordern. So verändern soziale Netzwerke nicht nur die zwischenmenschliche (Turkle, 2012), sondern auch die politische Kommunikation (Grassegger & Krogerus, 2018; Cadwalladr & Graham-Harrison, 2018). Gesellschaftlich verantwortliches Handeln erfordert heute auch eine ethisch-philosophische Auseinandersetzung mit den Dynamiken der Informationstechnik: Wie funktioniert eine genuin demokratische Meinungsbildung im Zeitalter von Facebook, Twitter, Social Bots und personalisierter Wahlwerbung? Wie können in diesem Zusammenhang normative Ideen wie Menschenwürde, Menschenrechte, Freiheit oder Selbstbestimmung so konkretisiert werden, dass sie gesellschaftliches Engagement tragen können? Die Thematisierung von sozialem Engagement an Hochschulen muss sich explizit auch mit den ethisch-philosophischen Fragen auseinandersetzen, die aus der Transformation des gesellschaftlichen Lebens durch Digitalisierung hervorgehen. Gerade durch philosophische Reflexionsprozesse kann bei Studierenden ein kritisches Denken angeregt werden, das erforderlich ist, um ein politisches Bewusstsein in einem Umfeld des rapiden technologischen Wandels herauszubilden.
Auch die Biotechnologien bringen heute tief greifende Umwälzungen und bohrende Fragen mit sich. Die Gentechnik hat mit der CRISPR/Cas-Methode ein mächtiges, präzises und zugleich billiges Werkzeug bekommen, um Gene von Pflanzen, Tieren und Menschen zielgerichtet zu verändern. Den mannigfaltigen Einsatzmöglichkeiten stehen sehr grundlegende ethische Fragen gegenüber, die heute in breiten öffentlichen Debatten diskutiert werden (Cathomen & Puchta, 2018). Gefordert sind ethische und juristisch bindende Antworten auf nationaler, transnationaler und globaler Ebene. Aber zunehmend wird klar, dass ethische Verantwortung gerade auch von jedem Einzelnen wahrgenommen werden muss, der Umgang mit einer derartigen Technologie hat, die bestehende Vorstellungen des Lebens und insbesondere auch des menschlichen Lebens fundamental infrage stellt. Etwas Ähnliches gilt für eine Biotechnologie, die momentan noch nicht in diesem Maße im Fokus der Öffentlichkeit steht, die aber ähnliche Umwälzungen verspricht wie die Gentechnik: die Neurotechnologie. Mit immer präziseren Wegen zur Erfassung von Gehirnzuständen und Werkzeugen wie «Deep Brain Stimulation» und «Transcranial Magnetic Stimulation» verspricht heutige Neurotechnik, in nicht allzu ferner Zukunft die Gedanken und Gefühle des Menschen und sogar die innersten Schichten der menschlichen Persönlichkeit zielgerichtet technisch verändern zu können, und die ersten Erfolge scheinen den Prognosen recht zu geben (Giordano, 2012; Keiper, 2012). Hier werden, wie bei anderen Technologien auch, mannigfaltige Anwendungsmöglichkeiten geschaffen, die gleichzeitig immer auch militärische Anwendungen ermöglichen, was bei der ethischen Einschätzung zu berücksichtigen ist (DiEuliis & Giordano, 2017). Wie wird sich die Gesellschaft und auch das Bild des Menschen verändern, wenn selbst die innersten Aspekte des menschlichen Selbst in den Bereich technischer Veränderbarkeit rücken (Benedikter, Giordano & Fitzgerald, 2010)? Derartige Anwendungsfelder führen vor Augen, welch fundamentale philosophische Fragen heute aus unmittelbar praktischen Kontexten des technologischen Fortschritts erwachsen und wie dringlich sie dort nach fundierten ethischen Antworten verlangen.
Die skizzierten Entwicklungen der Technik zeigen,[9] inwiefern Philosophie gerade auch an Hochschulen für angewandte Wissenschaften eine wichtige Rolle spielen muss und dass ihre Wichtigkeit in Zukunft noch zunehmen wird. Die fundamentalen Umwälzungen durch moderne Technik werden alle Bereiche des individuellen und gesellschaftlichen Lebens transformieren und auch vor grundlegenden Wertvorstellungen und Menschenbildern nicht Halt machen. Menschen werden gerade auch in praktischen Anwendungskontexten zunehmend reflektierte ethische Entscheidungen treffen müssen, und Hochschulausbildungen müssen sie gezielt darauf vorbereiten. Der naheliegende didaktische Weg liegt für Fachhochschulen in der expliziten Thematisierung der ethischen und philosophischen Fragen, die sich aus den aktuellen Anwendungen moderner Technik und der damit einhergehenden Lebensweisen ergeben, da dies die Relevanz und die Dringlichkeit von Philosophie unmittelbar vor Augen führt. So öffnen sich zugleich Wege zur Auseinandersetzung mit kulturellen Wertvorstellungen und dem modernen Menschenbild und damit auch Wege, um die komplexe Verflochtenheit des modernen Denkens mit seinen vormodernen, bis in die Antike zurückreichenden Wurzeln zu thematisieren (Kriza, 2018).
Ziel von Philosophie ist, bei Studierenden ein Bewusstsein für die relevanten Dimensionen des Menschseins in der komplexen Situation der Gegenwart zu eröffnen: Durch eine Schärfung des analytischen Denkens sollen Studierende die Fähigkeit entwickeln, sich die Dynamiken der modernen Welt differenziert vor Augen zu führen. Durch eine philosophische Diskussion von kulturellen Wertvorstellungen sollen sie in die Lage versetzt werden, eigene ethische Positionen zu beziehen und sie vor anderen zu begründen. Studierende sollen durch eine gezielte Förderung des selbstständigen und kritischen Denkens die Fähigkeit und den Mut zum Hinterfragen entwickeln. Ziel von Philosophie ist, Studierende darin zu unterstützen, sich die Ziele des eigenen beruflichen und persönlichen Lebens und auch die Reichweite und Konsequenzen des eigenen Handelns bewusst vor Augen zu führen und die aufgeworfenen Fragen auch zu Ende zu denken. All diese Kernziele von Philosophie sind auch für Fachhochschulen unmittelbar relevant.
Philosophie eröffnet zudem, nicht zuletzt an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wertvolle Räume der Interdisziplinarität: Die erwähnten ethischen und philosophischen Fragen, die sich gerade auch in konkreten Anwendungssituationen stellen, können nicht als Fachfragen einer bestimmten Disziplin, sondern nur aus einer fachübergreifenden Perspektive und nur mit Einbeziehung unterschiedlicher fachlicher Sichtweisen thematisiert werden. Dies bietet interessante Gelegenheiten, um Studierende und Lehrende unterschiedlicher Fachgebiete zusammenzubringen. Die Diskussion über die ethischen und philosophischen Fragen und die Suche nach Antworten vollzieht sich dann nicht als eine losgelöste didaktische Übung, sondern als Auseinandersetzung mit «echten» Themen, die auch im wirklichen Leben nach Lösungen verlangen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Philosophie in einem mehrfachen Sinne die Persönlichkeitsentwicklung von Studierenden fördert – gerade auch an Hochschulen für angewandte Wissenschaften: Sie unterstützt ihre Herausbildung zu reflektierten, selbstbestimmten Persönlichkeiten, die die Fähigkeit besitzen, sich mit anderen über die wichtigen Herausforderungen unserer Zeit zu verständigen, und die auch bereit sind, ethische Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Damit unterstützt Philosophie die Entfaltung der wertvolleren Potenziale von Studierenden, und in diesem Sinne trägt sie das, was auch aus modernen Perspektiven des Denkens als das genuin Menschliche interpretiert werden kann: das Streben eines jeden Menschen nach einer bewussten Entwicklung und Herausbildung der jeweils eigenen Persönlichkeit, im je eigenen Bemühen um ein gutes Leben.