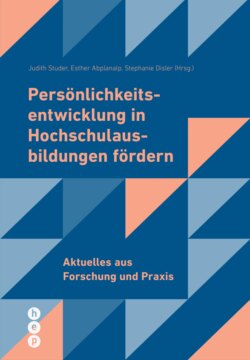Читать книгу Persönlichkeitsentwicklung in Hochschulausbildungen fördern (E-Book) - Группа авторов - Страница 7
1 Begriffsverständnis
ОглавлениеArendt (2013 [1965]) differenziert zwischen «Mensch» und «Person». Sie schreibt der Person die Fähigkeit der Nachdenklichkeit zu, die wiederum die Entwicklung der Persönlichkeit einschließe.
«Ich erwähnte, dass das Person-Sein unterschieden wäre vom Nur-menschlich-Sein […] [und, d. Verf.] ich mich in diesem Denkprozess, in dem ich die spezifisch menschliche Differenz der Sprache aktualisiere, klar als Person konstituiere und dass ich Einer bleibe in dem Maße, in dem ich immer wieder und immer neu zu einer solchen Konstituierung fähig bin. Wenn es das ist, was wir gewöhnlich Persönlichkeit nennen […], dann ist sie das einfache, beinahe automatische Ergebnis von Nachdenklichkeit.» (A. a. O., S. 77 f.)
Luhmann (2002) weist darauf hin, dass sich zwar im Verlauf der langen Begriffsgeschichte verschiedene Varianten des Begriffs «Person» entwickelt hätten, mit Person aber immer etwas beschrieben werde, «was sich von der körperlichen Realisation des menschlichen Lebens und der bloßen Tatsache des Bewusstseins unterscheiden» (a. a. O., S. 29) lasse. Im vorliegenden Beitrag zeichnen sich Personen durch Reflexivität aus. Unter Reflexion wird in einem unspezifischen, allgemeinen Verständnis jede Art des rückbezüglichen Denkens, des Nach-Denkens verstanden. Erst eine kritische Reflexion fordert allerdings beim Reflexionsprozess explizit das eigene Selbst. Müller (2018b, 2018c u. a.) differenziert die Denkfiguren «Reflex», «Reflektion» und «Reflexion». Letztere wendet «die Ansätze von Reflex und Reflektion kritisch und nimmt sie in offenen, denk-, handlungs- und urteilserweiternden Varianten auf» (Müller, 2018b, S. 127). Die Denkfigur «Reflexion» berücksichtigt auch innerpsychische Prozesse. «So können sowohl äußere Relationsbeziehungen von Wechselwirkungen als auch innere Vermittlungsverhältnisse gedacht und konzeptualisiert werden» (ebd.).
Der Begriff «Person» wird verwendet, «um die gesamte physische und psychische Ausrüstung des Individuums zu bezeichnen» (Spiegel, 1961, S. 217). Das Selbst wird als psychischer Anteil aufgefasst, der dazu beiträgt, dass aus einem Menschen eine Person wird. Während sich zum Beispiel für Jacobson (1998 [1964]) das Selbst «auf die gesamte Person eines Individuums, einschließlich seines Körpers und seiner Körperteile, wie auch seiner psychischen Organisation und deren Teile» (a. a. O., S. 17) bezieht, wird im vorliegenden Beitrag zwischen «Person» und «Selbst» differenziert. Das Selbst als psychischer Anteil der Person kann wiederum als Prozess und Inhalt aufgefasst werden (Ludwig-Körner, 2014, S. 857 f.). In prozessorientierter Perspektive entwickelt und verändert sich das Selbst stetig. Eine inhaltlich-strukturorientierte Perspektive auf das Selbst betont das Beständige. Die Entwicklung der Persönlichkeit in Hinblick auf die Ausbildung konsistenter «Muster des Fühlens, Denkens und Verhaltens» (Pervin, Cervone & John, 2005, S. 31) wäre einer inhaltlich-strukturorientierten Perspektive auf das Selbst zuzuordnen.
Unter personenbezogener Arbeit wird die Berücksichtigung der Denkfigur «Reflexion» im Hochschulstudium verstanden. Reflexivität trägt wiederum zur Persönlichkeitsentwicklung bei – ein entscheidender Aspekt, wenn es im Folgenden um Begründungen für die Berücksichtigung personenbezogener Arbeit im Hochschulstudium geht.