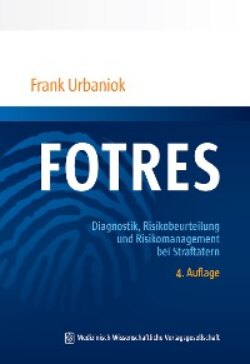Читать книгу Autismus-Spektrum-Störungen im Erwachsenenalter - Группа авторов - Страница 56
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5.3.1 Wie entwickelt sich eine Theory of Mind
ОглавлениеFür die Entwicklung einer Theory of Mind gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze. Obwohl sich bestimmte Fähigkeiten in einem bestimmten zeitlichen Entwicklungsfenster zeigen, bleibt unklar, wie genau diese Entwicklung vonstattengeht. Handelt es sich um eine zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Entwicklung neu auftauchende kognitive Fertigkeit oder werden schon vorhandene kognitive Fähigkeiten erweitert, sodass Perspektivenwechsel oder Metarepräsentationen erst möglich werden? Weiter stellt sich die Frage, ob es sich um eine grundlegende Basisfertigkeit handelt oder um eine Kombination aus verschiedenen Einzelfertigkeiten. Werden möglicherweise unterschiedliche Aufgaben, die zur Testung der Theory of Mind eingesetzt werden, durch unterschiedliche Fertigkeiten vermittelt, die nicht nur etwas mit ToM zu tun haben?
Verschiedene Theorien versuchen die Entwicklung und die Funktionen der Theory of Mind zu erklären. Im Folgenden werden die verschiedenen Ansätze, wie z.B. die Simulationstheorie, die Theorie-Theorie und die Modultheorie kurz beleuchtet.
Vertreter der Simulationstheorie gehen davon aus, dass jeder Mensch sich zunächst selbst bewusst werden und wahrnehmen muss, bevor er andere Personen interpretieren kann. Dabei wird nicht aufgrund von Begriffen gelernt, sondern durch direkte Erfahrungen. Erst nachdem diese Selbsterfahrungen gemacht und Situationen nachgeahmt wurden, kann mittels Analogie darauf geschlossen werden, dass andere Personen gleiche oder ähnliche Vorstellungen, Ansichten, Gefühle, usw. haben wie man selbst. Die Simulationstheorie nimmt also an, dass wir uns in eine andere Person und deren Situation hineinversetzen und uns vorstellen, wie wir in dieser Situation z.B. denken und fühlen würden (Harris 1991). Das bedeutet, dass wir zuerst lernen müssen, unsere egozentrische Perspektive zu verlassen, um eine Theory of Mind zu entwickeln (Harris 1992). Unterschiede zwischen den Personen kommen daher durch unterschiedliche primäre Eigenerfahrungen zustande. Dies wirkt sich dann auf die Interpretation anderer Personen aus, sodass nicht jede Person die gleiche Interpretation mit der gleichen Ausführlichkeit haben wird. Im Rahmen der Simulationstheorien gibt es jedoch unterschiedliche Meinungen hinsichtlich der Art und Weise der Simulation. Es gibt die Hypothese, dass man geistige Zustände bei sich selbst erzeugen kann (Selbstsimulation), als wäre man die andere Person. Diese Simulation kann dann auf eine andere übertragen werden, sodass sie interpretiert werden kann. Andere gehen wiederum davon aus, dass Kinder mit der Fähigkeit zur Simulation schon geboren werden und im Laufe ihrer Entwicklung diese Fertigkeit durch Erfahrung und Übung weiter verbessern. Demnach kann bei genügend Erfahrung eine Person direkt ohne die Eigensimulation das Verhalten einer anderen erklären oder vorhersagen.
Allgemein wird davon ausgegangen, dass eine Perspektivenübernahme umso schwerer wird, je stärker sich der eigene mentale Zustand von dem einer anderen Person unterscheidet. Je größer die Differenz zwischen zwei mentalen Zuständen, desto stärker muss der eigene Zustand unterdrückt werden. Im Falle der False-Belief-Aufgabe (s. Beispiel in Kap. I.5.3 und Abb. 5) bedeutet dies, dass der eigene Wissensstand ignoriert werden muss, um eine andere Person (im diesem Falle Sally) korrekt simulieren und interpretieren zu können. So lernen die Kinder mit zunehmendem Alter die eigenen mentalen Zustände von denen anderer zu unterscheiden und voneinander zu trennen, sodass schließlich eine vom eigenen Empfinden getrennte Interpretation anderer möglich wird.
Vertreter der Theorie-Theorie gehen hingegen davon aus, dass ein Kind je nach Reifungsstand Theorien darüber entwickelt, wie Menschen funktionieren und was ihr Handeln beeinflusst und leitet (Perner 1991). Kinder leiten diese Regeln und Gesetze implizit aus ihrem bisherigen vorhandenen Wissen ab. Das theoretische Wissen über soziale Regeln wird implizit, d.h. unbewusst in sozialen Bezügen durch Eltern, Geschwister oder anderen Gruppen, gelernt und verinnerlicht. Dieses Wissen ist zunächst nicht bewusst und erklärbar. Immer dann, wenn sich bereits bestehende Regeln durch die Umwelt als nicht zutreffend erweisen, wird die Theorie weiterentwickelt, das Wissen überprüft und gegebenenfalls modifiziert. Die entwickelten Theorien sind spezifisch, d.h. sie können sich auf unterschiedliche Zusammenhänge beziehen (biologisch, physikalisch, mental). Perner beschreibt dabei die kognitive Entwicklung von Kleinkindern bis zum vierten Lebensjahr in einem Stufenmodell. Ein Kind durchläuft demnach in diesen vier Jahren drei unumkehrbare Stufen. Zentral hierbei sind interne Repräsentationen von externen Objekten.
Primäre Repräsentation: Von der Geburt bis 1,5 Jahre gibt es laut Perner (1991) keine parallel zur realen aktuellen Welt bestehenden Situationen, d.h. keine gleichzeitig zur realen Welt bestehenden hypothetischen, vergangenen oder zukünftigen Situationen („Single Updating Models“).
Sekundäre Repräsentation: Erst mit etwa 18 Monaten hat das Kind die Möglichkeit, mehrere Modelle gleichzeitig zu nutzen und zwischen den Modellen eine Beziehung herzustellen („Multiple Models“). Ab diesem Zeitabschnitt werden dann Symbolspiele (Pretend Play, „So-tun-als-ob-Spiele“) möglich und das Kind kann erkennen, dass andere Personen ebenfalls Objekte in der Umwelt wahrnehmen. Jedoch kann das Kind in dieser Phase noch nicht zwischen der eigenen Wahrnehmung und der anderer Personen unterscheiden (egozentrischer Standpunkt). Mit zwei bis drei Jahren bilden Kinder laut Perner bereits Repräsentationen, können diese jedoch noch nicht vollständig verstehen, sodass Wünsche oder Vorstellungen nur in direktem Bezug zur Umwelt erkennbar sind und Verhalten für konkrete Situationen vorhersagbar wird.
Meta-Repräsentation: Ab dem vierten Jahr beginnen Kinder zu verstehen, dass sich die Vorstellungen, Überzeugungen oder Wünsche zwischen der eigenen und anderen Personen unterscheiden können. Eine bestimmte Situation wird dann nicht mehr als objektiv für alle Personen gleich der eigenen Wahrnehmung empfunden, sondern als subjektiv erkannt. Es wird begriffen, dass sie von Mensch zu Mensch verschieden sein kann. Bei einem vierjährigen Kind kann eine Theory of Mind als eine Theorie mentaler Repräsentationen verstanden werden, welche falsche Überzeugungen und fehlerhafte Repräsentationen anderer Personen beinhaltet (Perner 1991). Ab diesem Stadium können Kinder „False-Belief“-Aufgaben korrekt lösen.
Bei der Modultheorie wird davon ausgegangen, dass bestimmte Fähigkeiten angeboren sind. Das heißt jedoch nicht, dass eine Fertigkeit schon bei Geburt vorhanden und im Verhalten erkennbar sein muss, sondern dass durch Lernprozesse in einem bestimmten sensiblen Alter auch die Fertigkeiten heranreifen können und dann erst vollständig wirksam werden. Sogenannte angeborene kognitive Module ermöglichen es uns, bestimmte Fertigkeiten zu erlernen. Ein Vertreter dieser Theorie ist beispielsweise Fodor (1992). Die Module sind spezifisch für die Bearbeitung bestimmter Informationen und unabhängig von anderen Modulen und zentralen Prozessen. Die Außenwelt wird über die Ebene der Sensorik (z.B. Sehen oder Hören) erfasst und muss verschiedene Ebenen durchlaufen bis hin zur höchsten Ebene des Denkens, welche die zentralen Prozesse einschließt. Auf der höchsten Ebene werden die verschiedenen Informationen integriert. Auf dieser höchsten Ebene des Denkens und der zentralen Prozesse ist die Informationsverarbeitung flexibel und willentlich, dadurch jedoch auch langsamer. Auf der Ebene der Sensorik erfolgt die Verarbeitung hingegen sehr schnell und automatisch. Innerhalb der Modultheorie kann ein Defizit der Theory of Mind durch eine spätere Reifung eines oder mehrerer Module erklärt werden oder aber durch einen Mangel an Informationsverarbeitungskapazität, welcher die Erreichung des Levels verhindert, das für eine korrekte Theory of Mind nötig ist.
Baron-Cohen ist einer der Vertreter der Modultheorie (Baron-Cohen 1991), der annimmt, dass zwei in der Entwicklung getrennte Module für die Entwicklung von ToM notwendig sind. Das erste Modul beinhaltet einen „Shared Attention Mechanismus“ welcher schon mit etwa neun Monaten aktiv ist. Dabei handelt es sich um das Konzept „Joint Attention“, bei dem ein Säugling dem Blick z.B. der Mutter folgen kann und die Aufmerksamkeit z.B. auf ein gemeinsames Objekt gerichtet wird. Es handelt sich dabei um eine gemeinsame oder geteilte Aufmerksamkeit auf etwas. Das zweite Modul wird im zweiten Lebensjahr wirksam und wird von ihm als „Theory-of-Mind-Mechanismus“ (TOMM) bezeichnet. In dieser Zeit beginnt sich das Symbolspiel zu entwickeln.
Leslie (1994) spricht sogar von drei in der Entwicklung aufeinander folgenden Modulen, einem Theory-of-Body-Mechanismus in den ersten sechs Lebensmonaten, in dem das Baby lernt, auf der Basis von spontaner Bewegung Agenten von Nicht-Agenten zu unterscheiden, ToMM (System 1) am Ende des ersten Lebensjahres mit der Fähigkeit, absichtsvolle Agenten repräsentieren zu können und aus deren Handeln konkrete Ziele abzuleiten, ToMM (System 2) mit ca. 18 Monaten mit der Fähigkeit zu Metarepräsentationen, also der Repräsentation z.B. von „Beliefs“ wie Wünschen oder Überzeugungen aber auch Täuschungen. Leslie nimmt an, dass alle drei Module bereits vorhanden sind, bevor Kinder in der Lage sind, z.B. „False-Belief“-Aufgaben zu lösen.