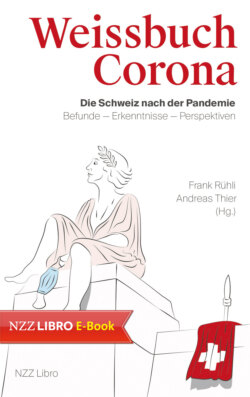Читать книгу Weissbuch Corona - Группа авторов - Страница 11
ОглавлениеLaurence Kaufmann / Marine Kneubühler / Fabienne Malbois
Das Soziale im Angesicht der Pandemie*
Wie jede Krise, die per Definition aussergewöhnlich ist, stellt die Gesundheitskrise die sozialen Prozesse auf eine Probe, die es den Individuen erlaubt, die Bedingungen ihres Zusammenlebens zu regeln. Um diese Prozesse, die die Pandemie untergräbt oder im Gegenteil verstärkt, zu erfassen, müssen wir sorgfältig die verschiedenen Bedeutungen des Sozialen unterscheiden. In diesem Text werden wir auf das Soziale im Sinn von Institutionen zurückkommen, insbesondere auf die politischen, medialen, medizinischen und wissenschaftlichen Institutionen, die an der Bewältigung der Krise beteiligt sind (I.); sodann auf das Soziale im Sinn von Verhaltensregeln, die vom Staat aufgestellt und in soziotechnischen Distanzierungsmitteln «objektiviert» werden (II.); weiterhin auf das Soziale im Sinn der Interaktionen und situierten Neuverhandlungen, deren Gegenstand diese Regeln sind oder für die sie ein Hindernis darstellen (III.); und schliesslich auf das Soziale im Sinn der Erfahrung, insbesondere der Emotionen, der Schwierigkeiten und der neuen Gewohnheiten, die die Beziehung zu sich selbst, zu anderen und zur Welt geprägt haben (IV.).
*Dieser Text entstand im Rahmen des SNF-Projekts Nr. 196185, Social distancing in times of pandemics. A study of the renegotiation of the interaction order, unter der Leitung Laurence Kaufmann.
I. Das Soziale im Sinn von Institutionen
Überall auf der Welt hat die Pandemie die grundlegende und transzendente Funktion des Staats reaktiviert: die des Überlebens und des Schutzes der Gesellschaft, deren organisierter verlängerter Arm er normalerweise ist, für die er aber in Krisenzeiten (Krieg, Terrorismus, Pandemie) vollständig verantwortlich ist. Durch die Auferlegung von Eindämmungsregeln und Massnahmen zur Kontaktreduzierung haben die Staaten ihre Macht über ihr Territorium und dessen Bevölkerung wieder geltend gemacht, Grenzen verhärtet, die Normen des sozialen Zusammenlebens neu definiert und die Bedeutung des Gefühls der nationalen Zugehörigkeit (einmal mehr) bekräftigt. Die Hypertrophie und Omnipräsenz des Nationalstaats während der Pandemie wurde noch verstärkt durch die Art und Weise, in der andere öffentliche Institutionen, einschliesslich der Medien und der Wissenschaft, die Regierungspolitik vermittelten. Der pluralistische Journalismus, der den Alltag des demokratischen Lebens ausmachen soll, ist weitgehend einem Regulierungsdiskurs gewichen, der sich sowohl an die Bevölkerung als auch an die Protagonisten des öffentlichen Handelns richtet. Was die Ärzte, Biologen, Epidemiologen und wissenschaftlichen Experten betrifft, so sind sie aufgerufen, auf die gesellschaftliche Nachfrage und die politische Dringlichkeit zu reagieren. Sie mussten über ihre normalen Tätigkeiten der Untersuchung, Information und Prävention hinausgehen, um zu alarmieren, zu beruhigen, zu schützen oder unangemessenes Verhalten anzuprangern. Die Angleichung von politischen, wissenschaftlichen, medialen und juristischen Institutionen, oder wie Claude Lefort (1986) sagen würde, von «Macht, Wissen und Recht», verhinderte das Entstehen einer Gesundheitsdemokratie und führte zur Suspendierung von Kritik und öffentlicher Debatte. Mit anderen Worten, die Zeit der Pandemie ist weder die der öffentlichen Kontroverse noch die des politischen Konflikts; sie ist die der Bekräftigung der moralischen Stärke des Kollektivs und seiner Solidaritätsbande.
Die wichtigste Folge der Gesundheitskrise war, dass die Grenzen zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten verwischt wurden. Eine solche Durchdringung, die allerdings mit der Demokratie unvereinbar ist, wurde bei den direkten Eingriffen des Staats in die Art und Weise, wie wir uns miteinander verhalten sollen, sichtbar und reichte bis in die Privatsphäre unserer Häuser. Indem sie direkt in unser tägliches Leben eingreifen, haben staatliche Verordnungen die Kluft überbrückt, die normalerweise Institutionen als Organisationen mit kodifizierten Betriebsregeln (die Kirche, die Universität, die Armee, das Krankenhaus usw.) und Institutionen als Formen des Fühlens, Denkens, Handelns, Unterhaltens und sogar Sterbens trennt (Mauss und Fauconnet, 1901). Um unsere Handlungs- und Lebensweisen auf diese Weise zu beeinflussen, mussten die öffentlichen Institutionen die neuen staatlichen Regeln in soziotechnische Distanzierungsmittel übersetzen. «Geräte» ist eine andere Bedeutung von «sozial», die die Pandemie in den Vordergrund gerückt hat.
II. Das Soziale im Sinn der Geräte
Wie der Name andeutet, «disposiert» ein Gerät («dispositio») den Menschen. Das geschieht in einer Geste, die im juristischen Sinn der Anordnung von Rechten und Pflichten, im technologischen Sinn der Maschine, die «es zum Laufen bringt», und im militärischen Sinn der «strategischen Planung» funktioniert (Agamben, 2006). Soziotechnische Geräte sind heterogene Ansammlungen von materiellen Objekten, Techniken, Regeln und Sprachkategorien, die als «System» funktionieren, um «Verhalten zu leiten» (Foucault, 2001: 299). In der Tat geht es bei den Distanzierungsmitteln um die hygienische Durchführung von Verhaltensweisen, unabhängig davon, ob ihre Wirkung so nah wie möglich am Körper (hydroalkoholisches Gel, Hygienemaske, Trennglas, Markierung auf dem Boden usw.) oder auf Distanz (Präventionsschilder und -plakate, Suchanwendungen, Online-Kurse, Videokonferenzen usw.) ausgeübt wird. Die Geräte erweitern die Institutionen bei gleichzeitiger Vergrösserung ihres Wirkungsbereichs. Sie sind in der Lage, sowohl auf der makrosozialen Ebene, auf der Ebene der allgemeinen Umstrukturierung der Modalitäten des Zusammenlebens (Versammlungsverbot), als auch auf der mikrosozialen Ebene, auf der Ebene der situierten Organisation von Face-to-Face-Interaktionen (Maskenzwang), zu intervenieren. Viele von ihnen haben, wie die Tracking-Anwendungen, sozusagen den Standpunkt des Virus eingenommen und ignorieren Lebensformen, die mit den Dispositionen und Veranlagungen, die ihr Erfolg erfordert, unvereinbar sind.
Das bedeutet, dass Institutionen und Geräte bei Weitem nicht ausschöpfen, was «sozial» bedeutet. Ihr Wirken ist gekennzeichnet durch Aktivitäten der Regulierung, Verwaltung und Koordination, die auf unpersönlichen Regeln, Rechten, Pflichten und Statuten basieren, die das Verhalten «von oben» steuern. Diese Sozialität, die auf die «systemische Integration» der Individuen hinarbeitet, vernachlässigt die interaktionelle Dynamik und die Pluralität der Zugehörigkeit, die für ihre «soziale Integration» (Habermas, 1987) notwendig sind. Genauer gesagt behindern die Regeln der sozialen Distanzierung die kollektive Dimension des sozialen Lebens (indem sie Zusammenkünfte oder Kaffeekränzchen zwischen Freunden, Kollegen oder Nachbarn verhindern). Sie heben auch seine öffentliche Dimension auf, sei es auf der Ebene der materiellen Öffentlichkeit, die Zirkulation, Austausch und Beziehungen in der Öffentlichkeit ermöglicht, oder auf der Ebene der immateriellen Öffentlichkeit, im Sinn der politischen Beteiligung an der Diskussion kollektiver Normen und Orientierungen des gemeinsamen Lebens.
III. Das Soziale im Sinn von Interaktionen
Um ihre «öffentlichen Beziehungen» zu managen, steht den Individuen das zur Verfügung, was Erving Goffman (1971) «die Ordnung der Interaktion» nennt: eine bestimmte Anzahl sozialer Codes, die die Art und Weise bestimmen, wie sie sich verhalten sollen, und die es ihnen erlauben, die angemessenen Reaktionen auf die Situation zu antizipieren – von einer ärztlichen Konsultation über die Bestellung eines Kaffees in einem Restaurant bis hin zu elterlichen Interaktionen auf einem Spielplatz. Die potenziell angstauslösende Erfahrung der Kopräsenz wird durch rituelle Zwänge und gewohnheitsmässige Begrüssungen beruhigt, die es ermöglichen, den Körper des Gegenübers «in angemessener Distanz» zu halten. Es wird auch durch die Arbeit der Figuration beruhigt, durch die die Teilnehmer der Interaktion den Wert oder das soziale «Gesicht» des anderen bewahren. Die Ritualisierung von Begegnungen ermöglicht also eine affektive und kognitive Grundhaltung, nämlich die des Vertrauens: Jeder kann sich gelassen auf die Routinen verlassen, die die Interaktionen «einrahmen», und auf die Fähigkeit des anderen vertrauen, vorhersehbar und rational zu reagieren.
Die Ordnung der Interaktion ist dramaturgischer Natur: Sie entfaltet eine Vielzahl von Szenen, die es den sozialen Akteuren erlauben, eine Rolle zu spielen, eine soziale Maske aufzusetzen (Elternteil, Krankenschwester, Musiker, Kunde usw.), während sie sich vor den potenziell aufdringlichen Blicken ihrer Mitmenschen schützen. Diese Dramaturgie ist durch die Pandemie untergraben worden. Die Anwesenheit im öffentlichen Raum ist zu einem Zeichen für moralische Übertretung geworden. Die soziale Maske, die per Definition plural ist, wurde durch eine einheitliche Gesundheitsmaske ersetzt, die das Selbst depluralisiert und auf einen biologischen Körper reduziert, der verletzlich und potenziell bedrohlich für andere ist. Was die konventionellen Stützen betrifft, die die Interaktion aufrechterhielten, so sind sie einer interaktionellen und emotionalen Störung gewichen, die die gesetzlichen Richtlinien der «sozialen Distanzierung» kaum beschwichtigen können. Wie halten Sie den richtigen Abstand in einer engen Gasse? Wie gehen Sie mit einer Begegnung mit einer nahestehenden Person (Freund, Familienmitglied) um, die wahrscheinlich das Virus trägt? Die mit dieser unaufhörlichen Frage korrelierende Unruhe, die zur Voraussetzung für jede Interaktion geworden ist, erzeugt ein diffuses, wenn nicht paranoides Gefühl der Unsicherheit.
Dieses Gefühl der Unsicherheit wird durch das Beinahe-Verschwinden der Ausdruckskraft von Gesichtern noch verstärkt. Da sie die Sprache des Blicks nicht beherrschen, vermeiden viele Menschen verdeckte Begegnungen oder lassen sich auf sie ein auf der Basis eines an reiner «instrumenteller Rationalität» (Weber, 1995) orientierten Handelns. Ferninteraktionen über Videokonferenzen, die keinen Blickkontakt ermöglichen, kompensieren diese Verzerrung der sozialen Bindung kaum. Mit der beispiellosen Zunahme von Fern- und verdeckten Interaktionen ist die Linie der Gegenseitigkeit, die uns direkt mit anderen verbindet und das sensible Fundament unserer Zugehörigkeitsgemeinschaft darstellt, ausgehöhlt oder gebrochen worden. Aber es ist nicht nur die Beziehung zu anderen, die erodiert ist, sondern auch die Beziehung zu sich selbst. Das ist die ultimative Bedeutung dessen, was sozial bedeutet: Das Selbstgefühl und sein Wert sind an der Zustimmung der anderen aufgehängt – ein anderes, das durch soziale Distanzierung distanziert, gepunktet und manchmal ausgelöscht wird.
IV. Das Soziale im Sinn der Erfahrung des Selbst
Das Selbstgefühl ist «ökologisch»; es basiert auf dem Gefühl, seinen Platz in einer Familie, einer Gruppe von Freunden, einem beruflichen Kreis oder einer Nation zu haben (Rochat, 2003). Im phänomenologischen Sinn entsteht die Erfahrung des Selbst also an der Schnittstelle zwischen dem eigenen inneren Erleben und einer äusseren Welt, die von anderen, Regeln und Objekten bevölkert wird (Depraz, Varela und Vermersch, 2011). In einer entvölkerten Welt, geschrumpft auf die Wände einer Wohnung, manchmal eines Schlafzimmers, wird das Gefühl des Existierens brüchig, das Selbstgefühl verarmt und verliert eben einen Teil seiner Bedeutung. Zur objektiven Isolation der Entlassung kommt ein Gefühl der Einsamkeit, vermischt mit diffusen Emotionen, Angst vor der beruflichen Zukunft, Wut oder Misstrauen gegenüber den Behörden, Sehnsucht nach sozialen Bindungen, Schuldgefühle gegenüber den am meisten Benachteiligten und neuerdings auch die hoffnungsvolle oder ängstliche Erwartung eines Impfstoffs.
Um diesen emotionalen Nebel zu beruhigen, müssen wir in der Lage sein, unsere Gefühle mitzuteilen und die sozialen Bindungen der Nähe zu bekräftigen, die die unpersönlichen Koordinationsbeziehungen, die durch Institutionen und soziotechnische Geräte geschaffen wurden, ersetzt haben. In Abwesenheit einer gemeinsamen Welt kann die emotionale Desorganisation oder Anomie, die durch Isolation entsteht, nicht in eine gemeinsam geteilte Erfahrung umgewandelt werden. In der Abwesenheit einer gemeinsamen Realität, die den Eindruck von Künstlichkeit oder Bedeutungslosigkeit vermeiden würde, verkümmert das Selbst; es nimmt sogar die spektrale Form des Zombies oder des Untoten an, mit der sensorischen Deprivation, die es erleidet. Diese gespenstische Erfahrung eines unentschlossenen und schwebenden Selbst wird noch verstärkt durch den Spiegel, den ihm die Geräte der Ferninteraktion vorhalten, die es in eine unbehagliche Beziehung der Andersartigkeit mit seinem Doppelgänger, halb Vertrauten, halb Fremden, einladen.
V. Fazit
Die Pandemie ist zweifellos eine «Bewährungsprobe für den Staat» (Linhardt, 2005): Sie zwingt den Staat, an ungewohnten Orten präsent und sichtbar zu sein, auch in unseren Gesichtern durch Masken. Unter der Ägide des Staats haben Institutionen soziotechnische Einrichtungen und Schutzmassnahmen geschaffen, um die Kontamination einzudämmen und Leben zu retten. Während ein solches Unternehmen weitgehend das Überleben der Bevölkerung sichert, ist die quantitative Logik, die es umsetzt, unvereinbar mit der qualitativen Logik sozialer Lebensformen. Diese Unvereinbarkeit zeigte sich besonders in der Weihnachtszeit 2020, als bei Familienfeiern nicht mehr als zehn Personen, einschliesslich Kinder, zusammenkommen sollten. Doch eine Familie ist keine Ansammlung von Individuen, die nebeneinander stehen und voneinander getrennt sind, sondern ein kollektives Subjekt, das sich unter anderem durch das Bewohnen eines gemeinsamen Hauses definiert. Es ist dieser elementare soziale Körper, der durch die Verpflichtung, die Individuen einzeln zu zählen, buchstäblich zerstückelt wird. Indem die Logik des Gesundheitswesens «uns» auf Aggregate von Individuen reduziert, deren biologisches «nacktes Leben» um jeden Preis erhalten werden muss, gefährdet sie das soziale Leben.
Abgeschnitten vom öffentlichen Leben und den Kollektiven, an die sie gebunden sind, findet sich der Einzelne gefangen zwischen seinen intimen Bindungen, in die er verstrickt ist, und seinem unpersönlichen und frontalen Verhältnis zum Staat, dessen Entscheidungen von einem Tag auf den anderen unmittelbare Auswirkungen auf sein Leben haben. In Ermangelung eines «Dazwischens von Taten und Worten» findet das in digitalen Netzwerken eingeschlossene oder «fragmentierte» Subjekt seinen Hauptschauplatz der Verwirklichung letztlich in seinem Verhältnis von Zugehörigkeit oder Opposition zum Staat.
Literatur
Agamben, Giorgio: «Théorie des dispositifs», in: Po&sie, 1(115) (2006), S. 25 – 33.
Depraz, Natalie; Varela, Francisco J.; Vermersch, Pierre: A l’épreuve de l’expérience. Pour une pratique phénoménologique, Bukarest 2011.
Foucault, Michel: Dits et écrits, Paris 2001.
Goffman, Erving: Les Relations en public, 2, La mise en scène de la vie quotidienne, Minuit: Paris 1971 (1973).
Habermas, Jürgen: Théorie de l’agir communicationnel, Paris 1987 (1981).
Lefort, Claude: Essais sur le politique (XIXe–XXe), Paris 1986.
Linhardt, Dominique: «Légitime violence? Enquêtes sur la réalité de l’Etat démocratique», in: Revue française de science politique, 2 (55) (2005), S. 269 – 298.
Mauss, Marcel; Fauconnet, Paul: «Sociologie», in: La Grande Encyclopédie, Bd. 30, Paris 1901, S. 165 – 175.
Rochat, Philippe: «Five levels of self-awareness as they unfold early in life», in: Consciousness and Cognition, 12 (2003), S. 717 – 731.
Sennett, Robert: The Fall of the public man, New York 1977.
Weber, Max: Economie et société, Bd. 1, Paris 1995 (1922).