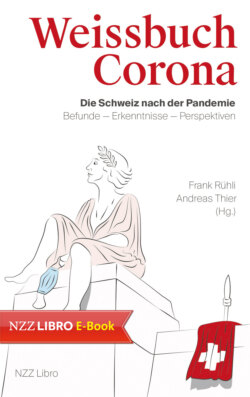Читать книгу Weissbuch Corona - Группа авторов - Страница 14
ОглавлениеNuma Bischof Ullmann
Reflexionen aus der Sicht des Intendanten eines Sinfonieorchesters
I. Klanglose Konzertsäle, sprachlose Theater, blickleere Museen
Die Pandemie und das damit einhergehende Verbot für Grossveranstaltungen traf die Schweizer Kulturinstitutionen jäh wie ein Blitz. Ins Herz und vernichtend. Als der Bundesrat am 28. Februar 2020 sämtliche Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen verbot, fühlte sich das zunächst wie ein irrealer Vorhang an. Dem Schreckensgespenst wurde nur kurze Zeit des Verweilens zugetraut. Dabei war es lediglich der Vorbote zu einer flächendeckenden Katastrophe, deren langfristige Ausmasse für die Kultur aus heutiger Sicht noch nicht abschliessend bewertet werden können.
Das in der Schweiz erstmals in dieser Form verkündete Grossveranstaltungsverbot war zunächst auf 14 Tage beschränkt. Im Nachhinein entpuppte sich dieses Präludium geradezu als harmlos und hielt die Branche vorübergehend in einer irreführenden Illusion, der Spuk könnte bald vorbei sein. Hoffnung auf baldige Normalisierung war eine weitverbreitete Losung. Im Gegensatz zu den späteren Massnahmen ab November 2020 unterschied sich das anfängliche Aufführungsverbot indes durch zwei Komponenten, die wesentlich einfacher hinzunehmen waren: die kurze Dauer und die zu Beginn kommunizierte zeitliche Befristung. Aus zwei Wochen wurden vier Monate. Anstelle von Programmen und Inhalten wurden allerorts emsig Schutzkonzepte entwickelt, die jedoch mit zunehmenden Fallzahlen erbarmungslos entwertet respektive ausgehebelt wurden.
Die in der zweiten Welle ausgesprochenen Veranstaltungsverbote hingegen wirkten wie lähmendes Gift, dessen Ausbreitung wortwörtlich viral war. Mangels zeitlicher Perspektive drohte dadurch nicht nur die künstlerische und ökonomische Substanz zu erodieren. Die spezifische Situation eines Sinfonieorchesters veranschaulicht die Problematik besonders klar, kann sinfonische Spielkultur doch nur durch das Aufführen von Konzerten entwickelt und auf hohem Niveau gepflegt werden – in Resonanz eines wertschätzenden Publikums. Die fehlende zeitliche Perspektive entkräftete mit jedem zusätzlichen Monat den Kreativmuskel der Institutionen und freischaffenden Künstler. Zwar verhinderten potente Hilfsprogramme wie die Aktivierung der Kurzarbeit sowie ein ausserordentliches Hilfspaket des Bundes («Entschädigung für Erwerbsausfall bei Massnahmen gegen das Coronavirus») den unmittelbaren Kollaps.
Die wirkliche Bedrohung lag hingegen in der sich stets von Neuem verlängernden, quasi sich selbst perpetuierenden Planungsunsicherheit. Eine Kakofonie von drängenden Fragen bestimmte das tägliche Denken: Werden wir je wieder eine Sicherheit erlangen, dass Konzerte und Tourneen stattfinden können? Planungssicherheit war lange eine Selbstverständlichkeit, die nun erst einmal passé war. Das Vertrauen in über Jahrzehnte erprobte Modelle und Traditionen wurde in den Grundfesten erschüttert.
Während sich freischaffende Künstler fragen mussten, wie sie das tägliche Brot kaufen sollten, stellten sich die unter einen Schutzmantel gestellten Institutionen die Frage, wie in diesem Zustand überhaupt Zukunftsvisionen entwickelt werden sollten, wie sie ihr Publikum erhalten bzw. retten sollten; ja, ganz allgemein, wie es überhaupt weitergehen sollte. Aus der Sicht eines Intendanten fühlte sich das Hier und Jetzt als eine nie da gewesene Ohnmacht der Hilflosigkeit an: Das Ausfüllen von Schadenersatzforderungen und Registrieren von Kurzarbeit waren zwar existenzsichernde Massnahmen zur Krisenbewältigung, aber eben nicht über die Krise hinaus. Und da liegen das grosse Problem und der sich abzeichnende reelle Schaden. Selbst wenn in absehbarer Zeit die Betriebe ihre Tätigkeit wieder aufnehmen können, der Substanzverlust von nahezu zwei Spielzeiten ist beträchtlich. Abhaken und nach vorn schauen könnte die einfache Direktive sein. Doch damit ist der Schaden weder aufgezeigt noch bewältigt. Kunst entsteht aus der Kunst heraus. Eine gespielte Note, ein intonierter Klang zieht den nächsten nach. Inspiration ist oft am stärksten in der erlebten Kreativität. Dasselbe gilt für unser Publikum: Es konstituiert sich durch jede neue Erfahrung, wird vom Erlebnis vitalisiert und vom Moment der Begeisterung geprägt.
Der Zeitpunkt der Pandemie traf die traditionellen Kulturbranchen an einem Wendepunkt, an dem viele grundlegende Fragen ohnehin geklärt werden mussten. Die Verortung der gesellschaftlichen Relevanz, die Digitalisierung und Vermittlung der Inhalte, die Suche nach dem Publikum von morgen sind nur einige der entscheidenden Aspekte, deren Beantwortung anstehen. Die Krise hat diese Fragestellungen nicht hervorgerufen, jedoch den Prozess beschleunigt.
Die Politik wiederum muss sich die Frage stellen, ob sie weiterhin auf eine Leuchtturmpolitik und auf den Mut zu klaren Akzenten verzichten kann. Der gerechtfertigte Anspruch der «Breitenkultur» versus Exzellenzförderung muss sich dabei nicht ausschliessen.
Die Kulturpause durch die Pandemie hat die Schweiz profund schockiert und auf Entzug gesetzt. Hat dies auch etwas Gutes? Vielleicht! Die Bedeutung der Kulturbranche, aber auch die Fragilität unserer Systeme wurden von vielen endlich (!) erkannt.
Einiges haben wir in der Krise begriffen, beispielsweise die Chancen, aber auch die Grenzen von digitaler Vermittlung: Selbst ein ausgeklügeltes Streaming-System kommt nicht im Entferntesten an die Dringlichkeit eines Live-Erlebnisses heran. Der «Grenzreiz» eines nächsten Konzertstreamings ist abnehmend. Menschen gehen an Konzerte, um Konzerte zu hören und Menschen zu treffen, mit denen sie Inhalte gemeinsam erfahren. Streaming ist nicht ein Substitut, bestenfalls eine Ergänzung, ein paralleler Kanal. Allerdings war Streaming in der Krise schlicht die einzige verbliebene Überbrückungsoption, denn spielen zu können war für alle Musiker zu einer Frage der mentalen Gesundheit geworden. Permanent auf den Websites der Kulturinstitutionen «Vorstellung gestrichen» zu lesen, ist vergleichbar mit der Geisteratmosphäre eines Bahnhofs, von dem keine Züge mehr starten.
II. Wie geht es weiter?
Es steht viel Arbeit an. Die Kulturbranche muss aus dieser Krise endlich erkennen, ihre Daseinsberechtigung besser darzustellen. Sie kann die Antwort darauf geradezu von ihr ableiten; jetzt, wo wir wissen und da es dokumentiert ist, wie sich das Leben anfühlt ohne die geistige Nahrung durch Live-Erlebnisse. Wer kann nach dieser Krise noch sagen, kulturelle Einrichtungen seien überflüssig? Quod erat demonstrandum – Beweisführung erbracht! Dies gilt es zu Kapital – zu unserer Causa – zu machen: Es ist der zeitweilige Verlust von live erfahrbarer Kultur gewesen, der ihren Wert nachdrücklich und hoffentlich auch nachhaltig deutlich gemacht hat.
Begriffen haben wir auch, dass in der Schweiz nur eine schwache und fragmentierte Lobby für den Veranstaltungs- und Kulturbereich existiert, die im verfahrenen föderalistischen Finanzierungssystem keine Durchschlagskraft hat. Die öffentlichen Systeme wie die Institutionen wiederum waren erschreckend schlecht auf die Pandemie vorbereitet. Wertvolle Zeit ging in uferlosen Debatten verloren, der Kantönligeist bremste konsequente Antworten aus.
Wird der Startpunkt nach nahezu 15 Monaten Spielpause in einem gewissen Sinn auch ein Nullpunkt sein? Entsteht durch die Erfahrung ein neues Verständnis der Institutionen? Wird sich mehr Best-Practice-Denken durchsetzen, geknüpft an höheres Verantwortungsbewusstsein? Es ist zu hoffen, dass Reflexionen einsetzen. Auswirkungen werden zunächst im Tourneegeschäft spürbar werden, die vermehrt auf dem eigenen Kontinent stattfinden. Wir werden noch mehr gezwungen sein, Beliebigkeit zu vermeiden, durch selektive Verdichtung in die Tiefe zu dringen und Beständigkeit zu schaffen. Jedes Programm, jede Aufführung sollte einen «dringlichen» Grund erhalten. Eine gewisse Reduktion des Produktionstempos würde dies sicherlich begünstigen. Im Gegenzug dürfte regional Geschaffenes einen höheren Stellenwert erhalten: Dirigenten, die gestern in New York und morgen in Luzern dirigieren, bringen nicht zwingend wache und inspirierte Resultate.
Während Grossformatiges suspendiert wurde, entdeckten in der Not viele Orchester die Kammermusik. Es bleibt zu hoffen, dass deren (Wieder-)Entdeckung nicht nur einer Faute-de-mieux-Situation geschuldet war. Alteingespielte Rituale – wie der traditionelle Programmablauf «Ouvertüre – Konzert – Sinfonie» – werden hinterfragt werden. Zu bezweifeln ist aber, dass die von vielen in der Krise beschworenen und angesagten «neuen Formate» bewährte Konventionen verdrängen. Eine Inszenierung Beethovens Neunter im Stil einer Zirkusmanege bringt weder neue Erkenntnisse noch künstlerische Vorteile. Im Gegenteil!
Langfristig werden Erkenntnisse aus der Krise in die Konzeption von Konzertsälen und Veranstaltungslokalitäten einfliessen. Neben technischen Voraussetzungen wie Lüftungen, Saaldisposition, Bestuhlung, Ticketing- und Datenverarbeitung wird die Saalkapazität auch kritisch zu hinterfragen sein. Sinn- und Machbarkeitsanalyse eines Covid-Zertifikats respektive «Impfpasses» werden unumgänglich Teil des Kompendiums sein.
Hätten wir die Krise besser bewältigen können? Sicherheitsaspekte wurden augenscheinlich lange ignoriert nach dem Prinzip: «Bei uns passiert das schon nicht.» Heute wissen alle, dass wir einfach unglaublich lange Glück hatten. Pandemie-Experten weisen darauf hin, wie erstaunlich es sei, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten von Pandemien verschont geblieben sind, und warnen uns in der gleichen Logik, dass die gegenwärtige auch nicht die letzte sein wird.
Ein differenziertes Krisenmanagement-Modell muss deshalb hinsichtlich zukünftiger Pandemien erarbeitet werden. In der Verantwortung stehen gleichermassen die Kulturbranche wie die Politik. Nicht nachvollziehbare Schutzmassnahmen führten nicht nur zu unermesslichem (und vermeidbarem) Schaden, sondern auch zu einem extremen Frustrationspotenzial in der Gesellschaft. Dass das Schliessen von Konzertsälen mit modernsten Belüftungssystemen und bei lückenloser Erfassbarkeit der Besucherdaten ohne Differenzierung landesweit verfügt wurde, löste auf dem Höhepunkt der zweiten Welle im Dezember 2020 allseits Stirnrunzeln aus angesichts chaotischer Zustände in den Warteräumen der Gondelstationen mancher Skiorte. Auch eine Differenzierung der Anwendbarkeit von Kurzarbeit ist prüfenswert. So sehr die Kurzarbeitsentschädigung alle Kulturinstitutionen in der Pandemie über Wasser gehalten hat, sie hat die Betriebe gleichzeitig auch gelähmt. Denn selbst Proben- oder Aufnahmetätigkeiten (ohne Publikum), die mit keinen direkten Einnahmen verbunden waren, waren in der Kurzarbeitszeit nicht möglich. Da es sich de facto die wenigsten Institution leisten konnten, auf die Kurzarbeitsentschädigung zu verzichten, führte dies zu extrem langen «Sendepausen» – mit verheerend demoralisierender Auswirkung auf die Künstler wie für die Gesellschaft. Ein Zwischenweg wäre, gezielte Ausnahmebewilligungen situativ einzuführen.
Dies ist keineswegs ein Plädoyer für eine Bevorzugung der Kulturbranche. Es zeigt uns aber auf, dass die Branchen wie auch die verantwortlichen politischen Instanzen Systeme und Einsatzpläne erarbeiten müssen, sodass massenhafter Kollateralschaden durch Pauschalmassnahmen so gut wie möglich verhindert werden kann.
Wird nach der Krise alles neu und besser? Gegenwärtig sind zwei Lager im internationalen Diskurs festzustellen: Die einen sehen die Krise als Chance und wollen alles neu erfinden; die anderen tun alles, um danach eine «neue Normalität» zu erlangen, also quasi zurück zum alten Modus vor der Krise. Eine Annäherung der Standpunkte ist wahrscheinlich, wenn wir das Virus erst einmal im Griff haben. Kunst war schon immer innovativ.