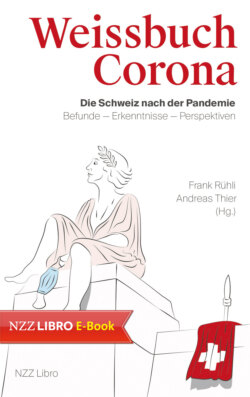Читать книгу Weissbuch Corona - Группа авторов - Страница 8
ОглавлениеHeiko Hausendorf
Kommunikation mit und durch Sprache*
I. Covid-19 und Kommunikation mit und durch Sprache
Seit Beginn der Pandemie sind die Zeitungen, die Talkshows und die Plattformen im Internet voll von Kommentaren, Stellungnahmen und Diagnosen zu der Frage, ob und wie die Covid-19-Krise die Gesellschaft verändert, verändern wird oder schon verändert hat. Auch nach mehr als einem Jahr sind die Versuche der Zeitgenossen und -genossinnen nicht abgerissen, reflektierend zu begleiten, was wir seither alltäglich erleben – wiewohl man wissen kann, dass es dazu eines Abstands bedürfte, den im Moment noch niemand beanspruchen kann. Auch der vorliegende Beitrag ist deshalb mit der Einschränkung versehen, dass es (viel) zu früh ist, um die mittel- und langfristigen Folgen der Pandemie für die Gesellschaft (innerhalb und ausserhalb der Schweiz) verlässlich darzulegen. Für einen sehr begrenzten Bereich – die Kommunikation mit und durch Sprache – soll gleichwohl der Versuch gemacht werden, die Relevanz etwas näher zu bestimmen, die den mit der Pandemie einhergehenden Veränderungen zukommen könnte. So spricht viel dafür, dass die Pandemie mit ihrer weitreichenden Problematisierung der Face-to-face-Interaktion zu einer Hybridisierung von Kommunikation beigetragen hat, die insbesondere die Bedingung der Kopräsenz (Goffman 1963) und damit das Sprechen und Zuhören unter Anwesenden betrifft. Wenn es längerfristige Folgen der Pandemie für Sprache als Kommunikationsmedium geben sollte, dürften sie in diesem Kontext zu finden sein.
*Der vorliegende Beitrag ist durch den Universitären Forschungsschwerpunkt Sprache und Raum der Universität Zürich (UFSP SpuR: www.spur.uzh.ch, Zugriff: 27. 7. 2021) unterstützt worden. Aus dem UFSP ist u. a. das SNF-Projekt «Interaktion und Architektur» (IntAkt: www.ds.uzh.ch/de/projekte/intakt, Zugriff: 27. 7. 2021) hervorgegangen, innerhalb dessen wir seit dem FS 2020 die Auswirkungen der Pandemie auf den Lehrbetrieb (den Übergang von Kontakt- zu Fernlehre) dokumentiert und analysiert haben. Mein Dank geht an Kenan Hochuli, Johanna Jud und Alexandra Zoller für zahlreiche Diskussionen, Anregungen und gemeinsame Datensitzungen und an Andi Gredig vom Deutschen Seminar für eine Reihe von Anmerkungen zu einer ersten Version des Beitrags.
II. Anwesenheit versus Erreichbarkeit
Ohne dass es als Versuchsanordnung irgendwo festgelegt worden wäre, ist seit März 2020 auch in der Schweiz ein einzigartiges soziales Grossexperiment angelaufen. Es besteht in der weitreichenden Einschränkung von Interaktion, die als eine auf Kopräsenz (bzw. Anwesenheit) beruhende Sozialform (Hausendorf 2020) auf einen Schlag (und zu Recht!) unter den Generalverdacht der Pandemieverbreitung geraten ist. Dabei wird die Interaktion vielleicht nicht zufällig an ihren Extremen besonders hart getroffen: Mit der Einschränkung der Versammlungsfreiheit wird einerseits die Versammlungsöffentlichkeit der Interaktion in Grossgruppen («Massen») unterbunden. Mit dem allgegenwärtigen Abstandsgebot wird andererseits nicht nur die Reichweite der Kommunikationsorgane strapaziert, sondern es werden insbesondere die Intimität und die Exklusivität der Interaktionsdyade empfindlich beeinträchtigt. Das Sozialleben moderner Gesellschaften kommt mit diesen Einschränkungen aber keineswegs zum Erliegen. Die modernen Teilsysteme unserer Gesellschaft setzen schon längst nicht mehr exklusiv und dominant auf Anwesenheit, sondern operieren unter der Bedingung von Erreichbarkeit: Sie können sich darauf verlassen, dass mehr oder weniger weltweit gesendet und empfangen, gelesen und geschrieben werden kann (Luhmann 2014). Mit dem Schreiben und Lesen von Nachrichten und Mitteilungen in mobilen und fast jederzeit und überall verfügbaren elektronischen Umgebungen ist Erreichbarkeit in Form von Lesbarkeit (Hausendorf et al. 2017) auch schon vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie zu einer viel kommentierten Alltagserscheinung geworden. Die Pandemie hat die auf Erreichbarkeit basierenden Formen der Kommunikation noch einmal mächtig angekurbelt und intensiviert, weil durch sie Interaktion unter Anwesenden unter Infektionsverdacht geraten ist.
Dabei tritt ein bestimmter Typus hybrider Kommunikation besonders dominant in Erscheinung. Er existiert nicht erst seit der Covid-19-Pandemie, aber er verbreitet sich ähnlich rasant wie das Virus selbst und beruht auf einer Kreuzung der Merkmale von Anwesenheit und Erreichbarkeit. Schon Anwesenheit ist nicht einfach eine physi(kali)sche Gegebenheit, sondern eine kommunikative Konstruktion, die darauf beruht, dass man wahrnehmen kann, dass man wahrgenommen wird (Goffman 1963). Wie genau diese Wahrnehmungswahrnehmung im konkreten Einzelfall bewerkstelligt wird, ist dann schon eine empirische Frage. Zwei Leute im gleichen Zimmer, die einander zum Beispiel aufgrund einer Trennscheibe nur einseitig wahrnehmen können, sind also im hier angesetzten Sinn nicht wechselseitig «anwesend», zwei Leute, die über ein Telefon sicherstellen können, dass sie sich gegenseitig hören können, aber sehr wohl (auch wenn zwischen ihnen der Atlantik liegen mag). Wenn man folglich das Telefongespräch als Fall von anwesenheitsbasierter Interaktion verortet, wird man gleichwohl darauf bestehen wollen, dass in diesem Fall auch Erreichbarkeit im Spiel ist: Ich muss den anderen ja offenkundig auch erreichen können, bevor ich ihn wahrnehmen kann. Um das gebührend in Rechnung zu stellen, bietet sich die in der Systemtheorie verbreitete Figur des «re-entry» an (Luhmann 2002). Sie besteht abstrakt gesagt darin, eine Unterscheidung auf der einen Seite derselben Unterscheidung noch einmal ein- und durchzuführen, das heisst «wiedereintreten» zu lassen:
Abbildung 1:
Anwesenheit vs. Erreichbarkeit als Ausgangspunkt hybrider Kommunikation
Wir können (und müssen) dann im Bereich der anwesenheitsbasierten Kommunikation den weiteren Fall unterscheiden, dass Anwesenheit auf Erreichbarkeit beruht, die Wahrnehmungswahrnehmung also medial hergestellt wird. Damit haben wir einen Spezialfall hybrider Kommunikation («Telekopräsenz» im Sinn von Zhao 2003). Am Fall des Telefonierens kann man sich gut klarmachen, was dabei passiert: Die Interaktion wird anfälliger, weil sie sich nicht mehr auf die «Bordmittel» der beteiligten Körper verlassen kann, sondern auf Medientechnologien (z. B. in Form der Übertragung, der Sendung und des Empfangs elektrischer Signale) und -institutionen (z. B. eine Art Fernmeldewesen) angewiesen ist. Aber sie bleibt doch unzweifelhaft Interaktion. In genau diesem Sinn haben wir es mit einer «Kreuzung» zweier sonst unterscheidbarer Merkmale bzw. mit dem Wiedereintritt einer Unterscheidung auf der einen Seite der Unterscheidung zu tun. Eben dieser Typus hybrider Kommunikation, der auf Telekopräsenz beruht, hat sich seit dem Ausbruch der Pandemie rasant verbreitet. Man denke dazu an all die neuen, inzwischen schon längst routinisiert verwendeten Softwaretools für Meetings und Videokonferenzen. So ist Zoom bereits zur Bezeichnung für einen neuen Typus von Kommunikation geworden (vom Marken- zum Gattungsnamen), und unter dem Stichwort «zoom fatigue» werden bereits erste Begleiterscheinungen dieser Kommunikation medienwirksam kritisch diskutiert.
III. Telekopräsenz als hybride Kommunikationsbedingung
Ihre erste Welle der Verbreitung hat Telekopräsenz mit der Allgegenwart des Telefons erlebt, die zweite Verbreitungswelle ist seit Ausbruch der Pandemie mit der Nutzung des Internets und mobiler Endgeräte für Video- bzw. Bildtelefonie angelaufen. Zwar ist die dafür notwendige Technologie schon sehr viel älter, aber in ihrer gesellschaftlichen Relevanz ist sie gleichwohl ein noch junges Phänomen: «In 2020, video conferencing went from a novelty to a necessity, and usage skyrocketed due to shelter-in-place throughout the world» (Fauville et al. 2021). Viele der mit dieser Verbreitungswelle einhergehenden Tipps aus der Ratgeberliteratur leben von der Hypostasierung eines Ur- und Reinzustands «natürlicher» Kommunikation. So wird zum Beispiel immer wieder moniert, dass die Wahrnehmung eingeschränkt und eingeengt, Blickkontakt nicht möglich und der Sprecherwechsel erschwert sei (vgl. z. B. Benini 2021).
Das alles ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Auch im Gespräch unter unmittelbar Anwesenden ist beispielsweise nicht alles automatisch in der kommunikativen Zone, was für die Beteiligten sinnlich wahrnehmbar sein mag, sondern es wird nur ein kleiner Ausschnitt in seiner Wahrnehmbarkeit systematisch wahrnehmbar gemacht (Hausendorf 2003); der Blickkontakt ist seit je sehr viel stärker regelbasiert, als uns das bewusst ist (Brône und Oben 2018). Und das, was wir über den Sprecherwechsel aus der Konversationsanalyse wissen (Sacks et al. 1974), stammt originär aus der Beschäftigung und Konfrontation mit Telefongesprächen! Vieles von dem, was jetzt als «künstlich», «belastend» oder «erschwerend» mit Blick auf das «Zoomen» ins Feld geführt wird, ist also nichts Neues. Die auf Anwesenheit beruhende Interaktion war nie ein Wohlfühlsetting, sondern schon immer ein durch und durch strukturiertes, regel- und gesetzmässig ablaufendes Geschehen, das an die Beteiligten systematische Anforderungen stellt, darunter auch eine nicht zu unterschätzende Körperdisziplin. Man musste, vereinfacht gesagt, schon immer zeigen, dass man auch anwesend ist. Weil das so ist, ist Interaktion wandel- und entwickelbar, das heisst mit dem Entstehen neuartiger Technologien auch über den Kreis des Hier und Jetzt ausdehnbar, und überhaupt sehr robust und anpassungsfähig an interaktionsfeindliche Umwelten, in denen zum Beispiel die menschliche Sinneswahrnehmung massiv eingeschränkt ist. So ist Interaktion bekanntlich auch unter Anwesenden möglich, die weder hören noch sehen können (aber dafür womöglich ganz andere Sensorien für die Interaktion zugänglich machen können). Anwesenheit ist also eine Konstruktion und als solche auch und gerade sprachlicher Natur. Auf Plattformen wie Zoom oder Teams wird sie deshalb nicht nur technisch hergestellt, sondern im Krisenfall unsicherer Wahrnehmung(swahrnehmung) auch sprachlich sichergestellt («Kann man mich hören?»).
Im Übrigen ergeben sich auf diesen Plattformen nicht nur Be- und Einschränkungen für Interaktion (zu denen das «Blickkontaktdilemma» gehört, vgl. Held 2019), sondern auch neue Ressourcen, die auf Sichtbarkeit beruhen. Zum Beispiel rücken die Gesichter näher und es wird möglich, das Schreiben und Lesen von Mitteilungen systematisch einzubeziehen. Damit wird nicht nur ein weiteres Tool neben anderen ausgenutzt, sondern Lesbarkeit mit Telekopräsenz verknüpft. Ein weiterer Effekt von Telekopräsenz ist das Auseinanderfallen der Räume, in denen sich die Beteiligten jeweils befinden. Allerdings ist schon in der auf Kopräsenz beruhenden Interaktion der Raum als geteilter Raum nicht einfach gegeben, sondern muss in dem, was für die Interaktion gerade relevant sein soll, von den Beteiligten «hergestellt» werden. Mit dem Übergang von Kopräsenz zu Telekopräsenz verändern und verlagern sich also nur die Möglichkeiten der Herstellung des Interaktionsraums: Verkörperte Motorik und Sensorik wird durch Kameras und Mikrofone nicht nur begrenzt, sondern auch ergänzt. An die Stelle gebauter und möblierter «Interaktionsarchitektur(en)» (Hausendorf und Schmitt 2016), die eine wirkmächtige Ressource der Interaktion darstellen, treten die «affordances» (Gibson 1977) der Videokonferenzplattformen. Damit ragen zum Beispiel Aspekte von (auch und gerade privater) Räumlichkeit (im Sinn des «Wohnens» und des «Zuhauses») in die kommunikative Zone, womit sie nolens volens zum geteilten Interaktionsraum dazugehören (können). Viel spricht dafür, dass wir hier erst und noch am Anfang einer Entwicklung stehen, die das eigene Wohnen mehr und mehr zum «natürlichen Zuhause» (Goffman 1964) von Telekopräsenz umgestalten wird (Smart Home), sodass wir, um telekopräsent zu sein, beispielsweise nicht länger darauf angewiesen sein werden, ein Endgerät mit Internetzugang auf- und anzustellen.
Bis es so weit ist, werden wir wohl noch eine Weile damit leben müssen, uns wechselseitig darauf hinzuweisen, dass das Mikrofon nicht angeschaltet, das Kamerabild eingefroren oder die Stimme zu leise ist. Fast keine der vielen telekopräsent abgehaltenen Treffen und Sitzungen der letzten Monate dürfte entsprechend ohne situationsreflexives sprachliches Krisenmanagement ausgekommen sein. Aber klar ist auch, dass wir es hier mit Übergangsphänomenen zu tun haben, wohingegen sich deutlich abzeichnet, dass die auf Telekopräsenz beruhende Kommunikation mit und durch Sprache so schnell nicht aus unserem Alltag verschwinden wird. Ob und wie das neben der Kommunikation und mit ihr auch die Sprache selbst verändern wird, ist im Moment noch nicht abzusehen, muss uns aber auch nicht weiter kümmern: Die Sprache ist als Medium nicht weniger robust und anpassungsfähig als die Interaktion, in der sie ihr natürliches Zuhause hat.
Literatur
Benini, Sandro (2021): «Die grosse Meetingmüdigkeit», in: Tages-Anzeiger, 10. 3. 2021, S. 27.
Brône, Geert; Oben, Bert (Hg.): Eye-tracking in interaction. Studies on the role of eye gaze in dialogue, Benjamins: Amsterdam, Philadelphia 2018.
Fauville, Geraldine; Luo, Mufan; Queiroz, Anna C. M.; Bailenson, Jeremy N.; Hancock, Jeff (2021): «Zoom Exhaustion & Fatigue Scale», in: SSRN Journal. DOI: 10.2139/ssrn.3786329.
Gibson, James J. (1977): «The theory of affordances», in: Shaw, Robert; Bransford, John (Hg.): Perceiving, acting, and knowing. Toward an ecological psychology, Erlbaum: Hillsdale, N. J., New York, S. 67 – 82.
Goffman, Erving (1963): Behavior in Public Places. Notes on the Social Organization of Gatherings, New York: Free Press.
Goffman, Erving (1964): «The Neglected Situation», in: Gumperz, John J.; Dell, Hymes (Hg.): The ethnography of communication, American Anthroplogist (6/2), American Anthropological Association: Menasha, S. 133 – 136.
Hausendorf, Heiko (2003): Deixis and speech situation revisited. «The mechanism of perceived perception», in: Friedrich Lenz (Hg.): Deictic Conceptualisiation of Space, Time and Person, Benjamins: Amsterdam, Philadelphia, S. 249 – 269.
Hausendorf, Heiko (2020): «Geht es auch ohne Interaktion?», in: Aptum. Zeitschrift für Sprachkritik und Sprachkultur, 16/202 (2 und 3), S. 196 – 199.
Hausendorf, Heiko; Kesselheim, Wolfgang; Kato, Hiloko; Breitholz, Martina (2017): Textkommunikation. Ein textlinguistischer Neuansatz zur Theorie und Empirie der Kommunikation mit und durch Schrift, de Gruyter: Berlin, New York.
Hausendorf, Heiko; Schmitt, Reinhold (2016): «Interaktionsarchitektur und Sozialtopographie. Basiskonzepte einer interaktionistischen Raumanalyse», in: Hausendorf, Heiko; Schmitt, Reinhold; Kesselheim, Wolfgang (Hg.): Interaktionsarchitektur, Sozialtopographie und Interaktionsraum, Narr: Tübingen, S. 27 – 54.
Held, Tobias (2019): «Face to Face. Sozio-interaktive Potentiale der Videotelefonie», in: Journal für Medienlinguistik, 2 (2), S. 157 – 194.
Luhmann, Niklas (2002): Die Wissenschaft der Gesellschaft, Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt.
Luhmann, Niklas (2014): «Ebenen der Systembildung – Ebenendifferenzierung. (Unveröffentlichtes Manuskript 1975)», in: Zeitschrift für Soziologie, Sonderheft «Interaktion – Organisation – Gesellschaft revisited». Hg. von Bettina Heintz und Hartmann Tyrell, S. 6 – 39.
Sacks, Harvey; Schegloff, Emanuel A.; Jefferson, Gail (1974): «A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation», in: Language, 50 (4), S. 696 – 735.
Zhao, Shanyang (2003): «Toward a Taxonomy of Copresence», in: Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 12 (5), S. 445 – 455.