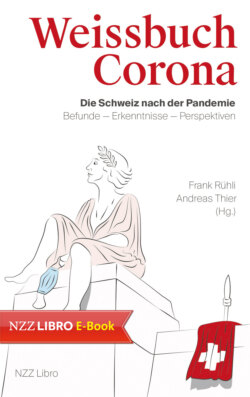Читать книгу Weissbuch Corona - Группа авторов - Страница 12
ОглавлениеSamia Hurst-Majno
Ethik
Die Ethik beschäftigt sich mit Werten und Wertkonflikten, Gründen und Rechtfertigungen für unser Handeln. Aus dieser Sicht ist eine Pandemie eine Zeit, in der die Probleme, um die es dabei geht, kumulativ gegeben sind. Diese Problemstellungen ragen weit über das hinaus, was in den wenigen nachfolgenden Zeilen beschrieben werden kann. Pandemien sind nie nur Gesundheitskrisen. Sie sind Stresstests für unsere gesamte Gesellschaft. Epidemien bedrohen unser Leben am offensichtlichsten, indem sie unsere körperliche Gesundheit gefährden, aber sie bedrohen auch unsere geistige Gesundheit, unsere Biografien (die regelrecht aus der Bahn geworfen werden können), unsere Bindungen, unsere Identitäten und unsere Gemeinschaften. Es ist durchaus möglich, aus einer Pandemie körperlich völlig unversehrt hervorzugehen, aber auf diesen anderen Ebenen irreparable Schäden davongetragen zu haben.
Indem sie uns schwierige und oft schmerzhafte kollektive und individuelle Anstrengungen abverlangen, zeigen uns Pandemien, wo wir der Situation gewachsen sind und wo nicht. Sie sind aufschlussreich. Indem sie uns mit wichtigen Themen konfrontieren, zeigen sie uns unsere Werte, denn unsere Werte werden immer dann besser sichtbar, wenn sie vor Herausforderungen stehen. Pandemien zeigen uns auch, wo diese Werte nicht ganz kompatibel sind. Sie zeigen uns unsere Prioritäten, und manchmal weichen unsere Prioritäten voneinander ab. Die Welt der Pandemie sieht ganz anders aus, wenn man sie aus dem Blickwinkel der Menschen betrachtet, die vielleicht in der Lage sind, Telearbeit zu leisten oder nicht, die sich vielleicht in einer prekären Lage befinden oder nicht.1 Die pandemische Situation betrifft Männer und Frauen oder Generationen nicht in gleicher Weise.2 Und natürlich ist auch die Art und Weise, wie wir mit unseren Meinungsverschiedenheiten über unsere Werte und Prioritäten umgehen, Teil unserer Werte und Prioritäten, der Stärken und Schwächen, die uns dieser Spiegel zurückspiegelt. Aus ethischer Sicht ist eine Pandemie eine Gelegenheit, viel zu lernen, über uns selbst, unsere Mitmenschen und unsere Gemeinschaften.
Containment – oder Semi-Containment in der Schweiz – war nach der Erinnerung der heutigen Generation eine bis dahin noch nie angeordnete Massnahme. Hauptziel dabei war es, zu viele vorzeitige Todesfälle zu vermeiden und die Belastung durch die Krankheit für uns alle zu begrenzen. Covid-19 war eine Krankheit, für die es weder eine wirksame Behandlung noch einen Impfstoff gab und der die gesamte Bevölkerung damals ohne vorherigen Schutz ausgesetzt war. Als Prozentsatz der Betroffenen scheint die Sterblichkeit nicht so hoch zu sein, aber in Relation zur Allgemeinbevölkerung wird sie beeindruckend.3 Ausserdem hat die Krankheit viel häufiger Langzeitfolgen, die noch nicht vollständig bekannt sind. Die Vermeidung der Überforderung der Spitalkapazitäten wurde immer wieder als Ziel dargestellt, sie ist aber in Wirklichkeit ein Mittel zum Zweck: In einem nicht überbeanspruchten Gesundheitssystem werden die Menschen besser behandelt, und deshalb geht es auch darum, die gesundheitlichen Folgen der Epidemie zu begrenzen.
(Semi-)Containment hat auch den Effekt, Zeit zu gewinnen, sodass gezieltere Alternativen eingeführt werden können. Da es die Freiheit des Einzelnen strikt einschränkt, muss das (Semi-)Containment die Kriterien der Rechtmässigkeit, Notwendigkeit, Subsidiarität und Verhältnismässigkeit erfüllen. Die Massnahme muss einem wichtigen Zweck dienen, was hier der Fall ist. Sie muss wirksam sein, um dieses Ziel zu erreichen, sie muss der geringste verfügbare Eingriff sein, um dieses Ziel zu erreichen, und schliesslich muss sie «die Kosten wert sein»: Es muss eine Verhältnismässigkeitsbeziehung zwischen der Massnahme und dem erwarteten Effekt bestehen. (Semi-)Containment stellt eine Beschränkung unserer Aktivitäten auf das Wesentliche dar und konfrontiert uns auch mit der Notwendigkeit, dieses Wesentliche zu identifizieren. Es ist in dieser Hinsicht ein grosser Spiegel: Die als wesentlich identifizierten Tätigkeiten sind nicht die, die unsere Gesellschaft normalerweise so hoch bewertet, weder durch Geld noch durch Wertschätzung. Schliesslich entstehen durch das Einsperren von Menschen Pflichten ihnen gegenüber: ihr materielles Überleben zu sichern, das Leben in der Enge und die Einhaltung der Regeln zu ermöglichen, zum Beispiel durch den Schutz von Menschen, die ihre Arbeit aufgeben müssen, vor Einkommens- oder Arbeitsplatzverlusten. Es ist eine Mobilisierung. Menschen unter solchen Umständen sich selbst zu überlassen, ist erst recht inakzeptabel, wenn das Land, in dem sie sich befinden, die Mittel hat, diese Unterstützung zu leisten, und ihnen strenge Regeln auferlegt.
Dem (Semi-)Containment sind tatsächlich andere Massnahmen gefolgt, die weniger restriktiv sind. Alle aber konfrontieren uns mit ähnlichen Fragen: Wenn wir uns zwischen verschiedenen Werten entscheiden müssen, die uns alle wichtig sind, wofür entscheiden wir uns und im Namen wovon? Viele Menschen haben sich diese Fragen wahrscheinlich zum ersten Mal gestellt. Die daraus resultierenden Debatten sind, auch wenn sie nicht immer unter den besten Umständen stattfinden und stattgefunden haben, dennoch von grundlegender Bedeutung. Während einer Pandemie stehen wir alle gemeinsam immer wieder mit dem Rücken zur Wand. Was ist der Grad und die Art des akzeptablen Risikos für uns selbst und andere? Wie werden wir Public-Health-Tools wie die digitale Kontaktverfolgung handhaben?4 Wie Quarantäne? Ist es akzeptabel, den Zugang zu bestimmten Aktivitäten auf Personen zu beschränken, die eine Bescheinigung über die Nichtansteckungsfähigkeit (oder ein geringes Ansteckungsrisiko) besitzen, und wenn ja, unter welchen Bedingungen und unter welchen Umständen?5 Welche Prioritäten werden wir bei gesellschaftlichen Aktivitäten setzen, wenn nur einige von ihnen zugelassen werden können, weil das kumulative Risiko sonst zu gross wäre? So hat die Schweiz seit dem Ende der ersten Welle den Zugang zu Bildung für Kinder höher gewichtet als die positiven Auswirkungen, die weitere Schulschliessungen auf die Epidemie haben könnten. Mit einer Ausnahme: die Gemeinde Wengen, die ihre Schulen schloss, um (letztlich vergeblich) das Lauberhornrennen zu retten. In einer Krise lassen sich unsere Prioritäten erkennen, auch wenn sie voneinander abweichen. Und in der Klinik müssen wir uns fragen, wie können wir knappe Ressourcen gerecht verteilen, wie zum Beispiel Impfstoffe am Beginn ihrer Verfügbarkeit oder Intensivbetten während der aufeinanderfolgenden Wellen, die unsere Krankenhäuser gefüllt haben?
Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften hat diese letztgenannte Schwierigkeit frühzeitig erkannt und ein Dokument mit dem Titel «Covid-19-Pandemie: Triage von Intensivbehandlungen bei Ressourcenmangel»6 erarbeitet. Eines der Ziele war es, ein ähnliches Szenario zu vermeiden, wie es im Frühjahr 2020 in Norditalien auftrat, als Fachkräfte ohne Unterstützung mit der Triage von Patienten alleingelassen wurden. Angesichts einer Situation knapper Ressourcen bleiben ethische Prinzipien wie Fürsorge, Schadensvermeidung, Respekt vor der Autonomie und die Fairness natürlich auch während einer Pandemie grundlegend. Doch das Prinzip der Fairness wird in der Anwendung schwieriger und erfordert daher besondere Sorgfalt. Über die Verteilungsgerechtigkeit im Gesundheitswesen sind ganze Bibliotheken geschrieben worden. Grundsätzlich geht es darum, so viel Gutes wie möglich zu tun, Diskriminierung und unfaire Privilegien zu vermeiden und den gleichen Wert jedes Menschen zu respektieren. Aus diesem Grund schlägt die Akademie als Eckpfeiler ein Kriterium vor, das diese Prinzipien eint: die Kurzzeitprognose, die unabhängig davon angewendet wird, wer krank ist, ohne jemals auf der Abwertung einer Person für eine andere zu beruhen.7
Diese Richtlinien wurden nie explizit umgesetzt, aber die verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass die Parameter für die Aufnahme auf die Intensivstation im Herbst 2020 dennoch verschärft wurden.8 Als Ethikerin hätte ich mir ein anderes Vorgehen gewünscht. Explizite Entscheidungen sind oft fairer als implizite: Sie erfordern eine klare Begründung und können kritisiert, überprüft und angefochten werden.9 Fairness ist in Krisenzeiten eine besonders schwierige Anforderung, aber auch besonders wichtig. Bislang ist es der internationalen Gemeinschaft auch nicht gelungen, das Problem des universellen Zugangs zu Impfungen zu lösen, obwohl mehrere Mechanismen speziell zu diesem Zweck eingerichtet wurden. Nochmals, Pandemien sind aufschlussreich und nichts sagt, dass alles, was aufgedeckt wird, so sein muss, wie man es sich gewünscht hätte.
Es gibt auch scheinbare Wertekonflikte, die keine sind oder die komplexer sind als erwartet. So wurde seit Beginn der Pandemie viel über die Gesundheit und die Wirtschaft gesprochen. Tatsächlich geht es den Volkswirtschaften umso schlechter, je schlechter die Übertragung der Krankheit kontrolliert wird.10 Massnahmen zur Pandemiebekämpfung sind daher langfristig Massnahmen zum Schutz der Wirtschaft und nicht umgekehrt. Diese Massnahmen hingegen sind in der Tat kurzfristig schädlich für die wirtschaftliche Situation des Einzelnen und müssen von Unterstützung begleitet werden. Diese wirtschaftlichen Unterstützungsmassnahmen für den Einzelnen sind wiederum Massnahmen gegen die Pandemie, denn wer bleibt schon ohne Mittel zum Lebensunterhalt im Lockdown? Gesundheit und Wirtschaft sind, zumindest angesichts der starken Wellen einer Pandemie, organisch miteinander verbunden.
Auch die Wertekonflikte zwischen den jüngeren und älteren Generationen sind komplexer, als sie erscheinen. Auf den ersten Blick opfert die Eindämmung die berufliche Zukunft der Jungen, um die Gesundheit der Alten zu schützen. In Wirklichkeit konkurrieren diese beiden Gruppen nicht in erster Linie miteinander, sondern beide konkurrieren gegen eine dritte Gruppe. Unsere Gesellschaften existieren, um uns zu ermöglichen, bestimmte Entscheidungen zu treffen, bestimmte Rechte auszuüben, unser Leben zu leben, und zwar ohne allzu grosse Risiken. Eine neue Krankheit, gegen die wir machtlos sind, verändert unsere Lebensumstände. Als die Autos schneller und gefährlicher wurden, mussten wir die Geschwindigkeit auf den Strassen begrenzen. Auch hier müssen wir – diesmal vorübergehend – alle möglichen Bereiche unseres Lebens umorganisieren, damit wir unser Leben weiterleben können, ohne es zu sehr zu gefährden. Diese Mühen der Reorganisation, um unser Dasein «corona-kompatibel» zu machen, sind geleistet worden, aber das geschah hauptsächlich in der Welt der bezahlten Arbeit. Die anderen Bereiche der Gesellschaft – der Vereins-, Familien- und Bildungsbereich, das Leben der Rentner und vor allem das der Menschen, die in medizinischen und sozialen Einrichtungen leben – haben warten müssen. Es sind also nicht hauptsächlich Jung und Alt, deren Interessen in einem Spannungsverhältnis stehen. Sie gehören beide zu den Gruppen, die bei diesen Umstrukturierungen nicht vorrangig behandelt wurden, während ein gleicher Respekt für alle verlangt hätte, dass diese Arbeit für alle gleich ist.
Jedes dieser Themen ist eine weitere Gelegenheit für Menschen, sich ausgegrenzt zu fühlen. Manchmal auch zu Recht. Und dieses Gefühl, zurückgelassen zu werden, ist eine der Determinanten von Verschwörungstheorien11, die in der Tat zunehmen. Wenn unsere Prioritäten offengelegt werden, dann können wir sie nicht übersehen haben. Wie überstehen wir gemeinsam eine Pandemie und sind dann am Ende immer noch zusammen? Ethik ist Teil des «Werkzeugkastens» des Zusammenlebens. Was nun? Die Zukunft nach der Pandemie ist der grösste Spiegel von allen. Was wir gelernt haben, sollte uns dazu bringen, unsere Beziehung zur Welt, zueinander und zu unseren Prioritäten zu hinterfragen. Wir haben unsere Stärken gesehen, aber auch unsere Schwächen. Was sollen wir mit ihnen machen? Dies mag ein einzigartiger Moment in unserem Leben sein, und es wäre eine Schande, ihn verstreichen zu lassen, als wäre nichts geschehen.
Anmerkung
1Reich, Robert: «Covid-19 pandemic shines a light on a new kind of class divide and its inequalities», in: The Guardian, 26. April 2020.
2Siehe etwa https://sciencetaskforce.ch/en/policy-brief/gender-aspects-of-covid-19-and-pandemic-response/ (Zugriff: 21. 7. 2021).
3Die Letalität von SARS-Cov2 wurde aufgrund zahlreicher Studien frühzeitig auf 0,5 – 1 % geschätzt (siehe z. B. Basu, Anirban: «Estimating The Infection Fatality Rate Among Symptomatic COVID-19 Cases In The United States», in: Health Affairs (Project Hope) 39, Nr. 7 (Juli 2020): S. 1229 – 1236. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2020.00455; Kenyon, Chris: «COVID-19 Infection Fatality Rate Associated with Incidence-A Population-Level Analysis of 19 Spanish Autonomous Communities», in: Biology 9, Nr. 6 (Juni 16, 2020). https://doi.org/10.3390/biology9060128; Roques, Lionel, Klein, Etienne K., Papaïx, Julien, Sar, Antoine und Soubeyrand, Samuel: «Using Early Data to Estimate the Actual Infection Fatality Ratio from COVID-19 in France», in: Biology 9, Nr. 5 (Mai 8, 2020). https://doi.org/10.3390/biology9050097. Diese Zahl mag auf den ersten Blick niedrig erscheinen, aber die Krankheit hätte sich auf einen Grossteil der Bevölkerung ausgebreitet und etwa 5000 bis 10 000 Todesfälle pro Million Erkrankte verursacht – eine Zahl, die jeder auf die Bevölkerung seines Landes beziehen kann.
4NEK-CNE: «Le traçage numérique des contacts comme outil de lutte contre la pandémie – aspects centraux dans la perspective de l’éthique» Nr. 33/2020, https://www.nek-cne.admin.ch/inhalte/Themen/Stellungnahmen/fr/NEK-stellungnahme-FR_Contact_Tracing.pdf (Zugriff: 21. 7. 2021).
5Siehe etwa «Aspects éthiques, légaux et sociaux de la stratégie de dépistage et de quarantaine», https://ncs-tf.ch/fr/policy-briefs/ethical-legal-and-social-aspects-of-test-trace-isolate-quarantine-strategies-09-may-20-en-2/download (Zugriff: 21. 7. 2021) sowie «Enjeux éthiques des passeports sérologiques», https://ncs-tf.ch/fr/policy-briefs/ethics-of-serological-passports-22-april-20-en-3/download (Zugriff: 21. 7. 2021); «Aspects éthiques, légaux et sociétaux de traitements différenciés pour les personnes vaccinées ou non contre le COVID-19», https://sciencetaskforce.ch/en/policy-brief/requiring-proof-of-covid-19-vaccination-vaccine-passports-certificates-key-ethical-legal-and-social-issues/ (Zugriff: 21. 7. 2021); NEK-CNE: «Zusammenfassung, Empfehlungen und Medienmitteilung zur Covid-19-Impfung», https://www.nek-cne.admin.ch/de/ueber-uns/news/news-details/nek-veroeffentlicht-zusammenfassung-empfehlungen-und-medienmitteilung-zur-covid-19-impfung (Zugriff: 21. 7. 2021).
6Online verfügbar: https://www.samw.ch/fr/Ethique/Apercu-des-themes/Medecine-intensive.html (Zugriff: 21. 7. 2021).
7Siehe etwa The University of Toronto Joint Centre for Bioethics Pandemic Influenza Working Group: Stand on guard for thee; Ethical considerations in preparedness planning for pandemic influenza, November 2005; Office fédéral de la santé publique: Plan suisse de pandémie Influenza. Stratégies et mesures pour la préparation à une pandémie d’Influenza 2018, 5ème edition, Questions éthiques, S. 95 ff. Cf. https://www.bag.admin.ch/dam/bag/en/dokumente/mt/k-und-i/hygiene-pandemiefall/influenza-pandemieplan-ch.pdf.download.pdf/foph-swiss-influenza-pandemic-plan.pdf (Zugriff: 21. 7. 2021); Hurst, S. A.: «Interventions and Persons», in: American Journal of Bioethics 12, Nr. 1 (2012): 10 – 11. https://doi.org/10.1080/15265161.2011.634954
8Siehe z. B. https://sciencetaskforce.ch/en/policy-brief/the-double-burden-of-operating-near-intensive-care-saturation-in-switzerland/ (Zugriff: 21. 7. 2021).
9Daniels, N.: «Accountability for reasonableness», in: British Medical Journal 2000; S. 321: 1300-1.
10«Quels compromis entre santé et économie?», https://sciencetaskforce.ch/wp-content/uploads/2020/10/Quels-compromis-entre-sante-et-economie.pdf (Zugriff: 13. 8. 2021).
11Siehe etwa «Adresser le coronascepticisme», https://sciencetaskforce.ch/fr/policy-brief/adresser-le-coronascepticisme (Zugriff: 21. 7. 2021), sowie Wagner-Egger, Pascal (2021): Psychologie des croyances aux théories du complot: le bruit de la conspiration, Presses Universitaires Grenoble: Grenoble.