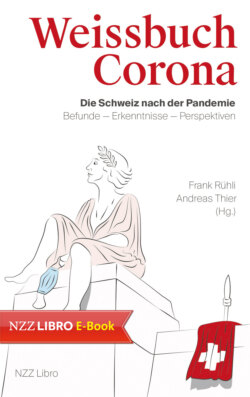Читать книгу Weissbuch Corona - Группа авторов - Страница 13
ОглавлениеJeanne Devos / Egbert Tholl
Kultur (Sprechtheater)
«It was a large room.
Full of people.
All kinds.
And they had all arrived at the same buidling at more or less the same time.
And they were all free.
And they were all asking themselves the same question:
| What is behind that curtain?» | Laurie Anderson |
Doch dieser Vorhang blieb lange zu. Stattdessen gehörte im vergangenen Jahr der tägliche Spaziergang durch die eigene Stadt zur Routine vieler Schauspielerinnen und Schauspieler. Es war ein Ritual, das sie mit all jenen teilten, denen wie ihnen die Grundlage der Arbeit entzogen worden war. Und als auch wir mal wieder so durch die städtische Landschaft streunten, fragten wir uns, in welchen Bildern diese Pandemie einmal gedacht werden wird. Können wir daraus Geschichten generieren, die wir vor Publikum aufführen werden? In welcher Sprache werden wir darüber sprechen? Und wird das dann überhaupt noch jemanden interessieren? Werden wir uns nur an die Masken auf den Proben und im Zuschauerraum erinnern? Oder auch an die erhabenen Momente?
Jedenfalls erinnern wir uns gut daran, wie es vor mehr als einem Jahr begann. Zumindest für eine geraume Zeit konnte man den pandemiebedingten Lockdown als ein interessantes gesellschaftliches Projekt begreifen. Hat man ja noch nie erlebt. Bald stellten sich Musiker auf ihren Balkon und spielten für die Nachbarschaft, die darüber sehr glücklich war. Kunst schaffte in diesen Momenten neue Gemeinschaften, die diejenigen ersetzten, die unmöglich gemacht wurden. Aber das galt nicht für die Theater. Dort hoffte man eher darauf, dass der Spuk bald verschwinden würde und man so weitermachen könne wie zuvor. Die schrittweise Kasernierung in die engsten eigenen Lebensumstände liess einen dann doch schnell spüren, dass man als Schauspielerin oder Schauspieler ganz am Ende der Nahrungskette gesellschaftlicher Relevanz steht. Wer Glück hatte, sich in einem Festengagement befand, als Freischaffende für bereits terminierte und dann abgesagte Aufführungen ausbezahlt wurde oder Hilfsgelder erhielt, musste sich immerhin nicht unmittelbar existenzielle Sorgen machen. Doch niemand wird Schauspielerin, um zu verstummen. Man will gehört werden, man braucht ein Publikum, sonst gibt es diesen Beruf nicht.
Die Auffassung, dass die Schauspielerei oder überhaupt die Kultur nicht systemrelevant sei, hat uns am Anfang der Pandemie zutiefst getroffen. Denn dieser Begriff stigmatisiert. Er macht uns verzichtbar und unwichtig. Und dabei kann eine Aufführung etwas sein, was die Trostlosigkeit durchbricht und neue Horizonte aufzuzeigen vermag. Dies haben wir immer dann gesehen, wenn die Theater zwischenzeitlich wieder öffnen durften. Sie waren voll. Und die Leute waren und fühlten sich dort sicher. Carolin Emcke schreibt in Journal. Tagebuch in Zeiten der Pandemie: «Wenn wir jetzt nicht nachweisen, was wir können, wenn wir jetzt nicht begründen, warum es uns, die wir Geschichten erzählen, fiktive oder nicht-fiktive, die wir die Wirklichkeit verwandeln oder beschreiben, die wir Trost spenden oder Wissen vermitteln, die wir Wörter oder Konzepte wiegen und für zu leicht befinden, die wir Lügen entlarven, Missverständnisse analysieren, demokratische Rechte und Räume verteidigen, wenn wir jetzt nicht zeigen, warum es auch uns braucht, dann werden wir nicht überleben …»1
Nach mehr als einem Jahr des Schweigens, unterbrochen von einem verheissungsvollen Sommer des Jahrs 2020, stellte man fest, dass sich nichts geändert hatte. Der Staat hielt die Theater, die er – respektive die Kantone und Städte – selbst unterhält, bis zum späten Frühjahr 2021 geschlossen. Kaum ein anderer Berufszweig wurde und wird so unmöglich gemacht wie jener der Schauspielerei, kaum ein anderer kann so wenig beweisen, wozu er fähig ist. Für Theater gibt es keinen Liefer- oder Abholservice. Für Theater gibt es auch kein Homeoffice. Theater ist sozial, und sozial zu sein ist schwierig geworden. In jenem Sommer 2020 indes konnte man erleben, wie flexibel Theater sein können. Es fanden sogar Festivals statt, weil man draussen spielen konnte und sich extrem detaillierte Hygienekonzepte ausdachte und durchsetzte. Einige grosse (Opern-)Häuser wie in Zürich oder München führten Pilotprojekte mit einigen Hundert Zuschauern durch, sie sollten den Nachweis erbringen, dass Theater sichere Orte sind, wenn man achtgibt. Sie erbrachten diesen Beweis. Am deutlichsten wohl die Salzburger Festspiele. Aufführungen vor mehr als 1000 Zuschauern, und keine einzige wurde als Ansteckungsherd bekannt. Aber: Die Politik negierte all diese Erfolge, obwohl sie die Pilotprojekte teilweise mitinitiierte. Theater sollte nicht sein. Die Spielstätten wurden wieder geschlossen, weil die Politik glaubte, dass man sie schliessen kann.
Theater finden auch kaum Erwähnung in den Berichterstattungen. Für die meisten Politikerinnen und Politiker scheinen sie im ganzen Wulst der Krise schlicht unterzugehen. Überraschenderweise tun sich einige Theaterinstitutionen aber auch schwer damit, von alten Praktiken und Gewohnheiten abzulassen. Wenn man jetzt nicht fähig ist, neuartige Formate zu finden, sich den Gegebenheiten immer wieder aufs Neue anzupassen, radikal flexibel zu sein, funktioniert es nicht.
Man könnte also manchen Theatern durchaus vorwerfen, dass sie in einem Jahr kaum gelernt haben, wie sie mit der Situation umgehen können. Tatsächlich aber wurde alles Erdenkliche ausprobiert. Manche Theatermacher verweigerten sich allem Digitalem und beharrten darauf, Theater finde live statt oder gar nicht, perfektionierten weiter ihre Hygienekonzepte und versuchten, damit die Politik unter Druck zu setzen. Vergeblich. Andere setzten eben aufs Digitale. Und einige davon kreierten ganz neue Formate: Theater als Videokonferenz, teils in Interaktion mit den Zuschauern, Theater als Film, als Installation im Netz, als Videospiel. Doch alle warteten nur darauf, dass sie wieder so spielen könnten, wie sie es einst konnten. Live, analog und vor Publikum.
Natürlich, man kann alles, wozu man fähig ist, ins Netz stellen. Ein fast schon verzweifelter Nachweis der eigenen Relevanz, der aber dennoch ein Publikum fand und dieses beglückte. Manche Theater plünderten ihre Archive und machten Aufzeichnungen alter Aufführungen online zugänglich, was vor allem aus theaterhistorischer Sicht interessant sein mochte. Andere produzierten ihre Premieren fürs Netz. Doch blieb es immer nur ein Behelf. Theater ist eine Kunstform, die von der Unmittelbarkeit, von der Nähe zu anderen Menschen lebt. Theater besteht im Moment einer Aufführung, Theater ist keine Fernsehshow und schon gar keine Netflix-Serie. Jede gestreamte Theateraufführung macht schmerzlich deutlich, was fehlt.
Es fehlen die Körperlichkeit und die Reaktionen auf beiden Seiten. Auf der Bühne und im Zuschauerraum. Die gemeinsame Erfahrung. Das Ereignis. Man kann nicht einfach wegklicken oder vorspulen, sondern muss die Situation für die Dauer einer Vorstellung aushalten.
Während die Theater also für lange Zeit ihre Türen geschlossen hielten, wurde hinter diesen Türen endlich mit- oder auch gegeneinander gesprochen. So schien es. Vermutlich waren die Theaterinstitutionen notgedrungen so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass gerade im Lockdown Fälle von Machtmissbrauch, von Übergriffen des Leitungspersonals publik wurden. Rassismen wurden offengelegt. Personen in leitenden Funktionen versprachen, nun besser und verständnisvoller mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umzugehen als bisher. Aus der Ferne betrachtet, also ohne Teil des jeweiligen Betriebs zu sein, wirkte in einigen Fällen die Diskussion kreischend notwendig, in anderen Fällen wie übersteigerte Hysterie. So als drängen die verordneten Abstandsregeln ins Zwischenmenschliche. Freilich ist die Diskussion über die alten, weissen Männer, die auch Frauen sein können, viel älter als die Pandemie. Nur wurde sie nun mitunter zum alleinigen öffentlichen oder zumindest öffentlich diskutierten Lebenszeichen eines Theaters. Das ist so problematisch wie dennoch notwendig.
Gleichzeitig kann man nun erleben, dass im Zug der zaghaften Lockerungen Theater genauso weitermachen wie zuvor. Als wäre der Lockdown lediglich ein Jahr Stillstand gewesen, aber ein Stillstand ohne Veränderung. Die Fachmagazine schicken ihre Fragebögen zu den Jahresumfragen herum, das Theatertreffen findet (digital) statt. Und immer noch stehen die Theater im Zentrum der Städte, deren öffentliche Kassen sie finanzieren, stolze Baudenkmäler einer Idee der Bedeutung von Kunst, die noch lange nicht wieder gefüllt ist. So wenig wie die Häuser selbst, die immer noch weit von der einstigen Bedeutung als soziale Orte entfernt sind. Noch fühlt sich ein Theaterbesuch an wie ein Ausflug in eine geisterhafte Nebenwelt, allerdings zusammen mit einigen wenigen, die ihr Glück, Theater wieder live sehen zu können, kaum fassen können. Auch das Spielen vor Publikum fühlt sich noch nicht frei an. Obwohl die Schutzkonzepte Sicherheit schaffen, ist die Angst tief in unsere Körper eingedrungen. Die Hoffnung liegt in der Begeisterung des Publikums, das nun die absurdesten bürokratischen Hürden auf sich nimmt, um eine Vorstellung besuchen zu können. Neugierig warten die Menschen auf das Öffnen des Vorhangs, und wenn dieser sich öffnet, ist oft das Gleiche dahinter wie vor dem Ausbruch der Pandemie. Ist das gut, weil es in der Beharrlichkeit von der Bedeutung eines etablierten Systems mit seinen in Stein gehauenen Denkmälern ausgeht? Ist das schlecht, weil man in einem Jahr gelernt hat, dass jene Bedeutung keineswegs so etabliert ist, wie es das System selbst gerne sieht?
Wir hatten nun ein Jahr Zeit, uns zu überlegen, wohin wir mit dem Theater wollen. Welchen geschützten Rahmen, frei von Diskriminierungen, können wir uns intern schaffen? Und wie können wir uns das Instrument, in der Öffentlichkeit wirksam zu sein, zurückerobern?
Ein Ort, wo wir alle frei sein können. Diese positive Zukunft möchten wir für uns und uns alle imaginieren.
Dieser Text ist die subjektive Wahrnehmung von zwei im Sprechtheater agierenden Menschen und keine Ansammlung von Fakten. Denn die Pandemie lehrt uns, dass alles vorläufig gedacht werden muss. Ständig gibt es Anpassungen.
Anmerkung
1Emcke, Carolin (2021): Journal. Tagebuch in Zeiten der Pandemie (Originalausgabe). S. Fischer Verlag, S. 20.