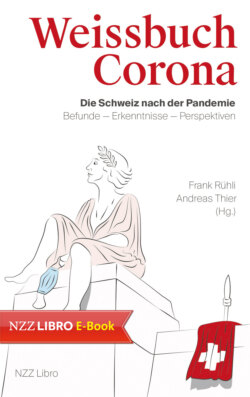Читать книгу Weissbuch Corona - Группа авторов - Страница 9
ОглавлениеMarianne Hochuli
Die Schweiz nach der Pandemie – die Perspektive einer Nichtregierungsorganisation
I. Armut und prekäre Lebenssituationen werden sichtbar
Menschen stehen in Schlangen stundenlang für Essen an. Dieses Bild, das bis anhin mit ärmeren Ländern in Verbindung gebracht wurde, erschien nun auch in der reichen Schweiz. Es erschütterte die vielerorts herrschende Gewissheit, dass in der Schweiz mindestens die Notversorgung für alle garantiert sei. Ein Bild vermochte der breiten Öffentlichkeit vor Augen zu führen, dass auch wir in der Schweiz ein Armutsproblem haben. Eigentlich ist dies längst bekannt. Das Bundesamt für Statistik veröffentlicht seit über einem Jahrzehnt regelmässig Armutszahlen: 735 000 Menschen lebten 2019 offiziell unter der Armutsgrenze, davon 115 000 Kinder, und jede fünfte Person kann eine Rechnung von 2500 Franken nicht innerhalb eines Monats bezahlen.1 Das Bild mit den für Essen anstehenden Menschen zeigt also nur die Spitze des Eisbergs von prekären Lebenslagen, die nun immer deutlicher zutage treten. Die Coronakrise hat die Armut in der Schweiz sichtbar gemacht und weiter verschärft.
II. Nichtregierungsorganisationen nehmen zentrale Rolle in der Unterstützung wahr
Unmittelbar nach Beginn des ersten Lockdowns stiegen bei Hilfswerken die Anfragen um Informationen für finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten und konkrete Hilfegesuche sprunghaft an. Die Hilferufe waren auch dann nicht rückläufig, als der Bundesrat staatliche Unterstützungsmassnahmen ankündigte, die er laufend erweiterte. Auf den ersten Blick schien sich der Sozialstaat Schweiz zu bewähren und gab vielen Menschen Hoffnung, die Krise überstehen zu können. Die Gesuche bei den Hilfswerken zeigten jedoch bald, dass viele prekäre Alltagssituationen nicht mitbedacht wurden, oder etwas auf den Punkt gebracht: Die Menschen mit kleinem Einkommen und ungesicherten Arbeitsverhältnissen wurden ganz einfach vergessen.
Einen umso grösseren Stellenwert bekam darum die Corona-Hilfe von privaten Organisationen, die wiederum nur dank der grossen Solidarität und Spendenbereitschaft der Schweizer Bevölkerung durchgeführt werden konnte. Damit bauten die Organisationen in kürzester Zeit – oft in diversen Partnerschaften – Nothilfestrukturen vor Ort auf oder dehnten bereits vorhandene Beratungsangebote aus. Sie berieten und unterstützten die Hilfesuchenden persönlich, was umso notwendiger war, als vielerorts die Schalter bei den öffentlichen Anlaufstellen geschlossen und nur noch online zugänglich waren. Dies bereitete vielen grosse Mühe. Sie waren verzweifelt und wussten nicht, wohin sie sich wenden sollten. So agierten die privaten Organisationen noch mehr als sonst als Triagestellen und Scharnier zu den staatlichen Stellen. Je nach Kanton beteiligten sich allmählich auch der Kanton oder die Städte an der Finanzierung dieser sozialen Aktivitäten der Hilfswerke. Der Staat konnte in dieser Krise auf deren grosse Erfahrungen mit basisnaher Tätigkeit zählen.
III. Es klaffen Lücken im Sozialsystem
Das Hilfswerk Caritas führte seit dem Frühling 2020 schweizweit seine grösste Hilfsaktion für Armutsbetroffene durch. Seit über zwei Jahrzehnten mit der wachsenden strukturellen Armut in der Schweiz beschäftigt, genügte es ihm nicht, Hilfe vor Ort zu leisten. Er analysierte laufend seine Erfahrungen, um daraus sozialpolitische Erkenntnisse ziehen und an Politik und Öffentlichkeit gelangen zu können. Die private Corona-Hilfe wurde subsidiär geleistet, also nur an Personen, die keine staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen konnten. Wer konnte denn nicht auf die staatlichen Corona-Massnahmen zählen? Aus welchen Gründen? Welche Lücken zeigten sich im Sozialsystem?
Der Grossteil der Menschen – viele Familien –, die Hilfe suchten, lebten bereits vor der Coronakrise in schwierigen finanziellen Verhältnissen. Sie zählen zu den Working Poor, die trotz Arbeit ihre Existenz nur mit Mühe bestreiten können. Oder sie arbeiten in tiefen Pensen, obwohl sie mehr arbeiten möchten. Hinter dieser Unterbeschäftigung, die mehr die Frauen betrifft, versteckt sich eine zunehmende Arbeitslosigkeit, die noch zu wenig wahrgenommen wird.2 Arbeitnehmende haben auch immer öfter Arbeit lediglich auf Abruf mit stark schwankenden Arbeitsstunden, und sie sind schlecht bezahlt. Die zuvor schon sehr prekären Arbeitsverhältnisse wirkten sich in der Coronakrise sofort aus und hatten akute finanzielle Probleme zur Folge. Angestellte wurden auf Kurzarbeit gesetzt oder verloren gar ihre Stelle. Die 80-Prozent-Entschädigung ihres bisherigen niedrigen Lohns reichte nicht mehr. Im Stundenlohn Angestellte erhielten weniger Arbeitseinsätze und Selbstständigen brachen die Aufträge weg. Viele verloren ihre kleinen Nebenverdienste, die geholfen hatten, sich über Wasser zu halten. Nun reichte das bereits vorher knappe Budget nicht mehr, um die Rechnungen bezahlen zu können.
Man hätte erwarten können, dass die Anmeldungen bei der Sozialhilfe explodieren würden. Dem war nicht so. Bis man sozialhilfefähig ist, braucht es viel. Oftmals ist ein zweijähriger Gang durch die Arbeitslosigkeit mit vermindertem Arbeitslosengeld nötig. Dies bedeutet nebst finanziellen Einbussen gerade für Menschen mit einem kleinen Bildungsrucksack vergebliche Stellensuchen mit immer neuen Absagen, wachsenden Zweifeln an sich selbst, eine immer grössere Existenzangst, an der auch die einem Nahestehenden leiden. Nie wurde deutlicher als in dieser Krise, dass die Sozialhilfe wirklich das letzte Sicherungsnetz ist. Eine schwerwiegende Versorgungslücke gibt es für alle, deren Einkommen knapp über der Grenze zur Sozialhilfe liegt. Viele Haushalte, die ihre Rechnungen für Miete, Krankenkassenprämien und Steuern kaum oder nicht mehr bezahlen können, benötigen ein Budget, das nicht zum Bezug von Sozialhilfe berechtigt. Der Bedarf eines Menschen im untersten Mittelstand liegt also noch einiges über der sehr tief definierten Armutsgrenze. Die Armutsgrenze richtet sich an den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe SKOS aus und ist für viele Haushalte nachweislich zu tief und reicht nicht aus, um den grundlegenden Bedarf zu decken. Bestehen noch finanzielle Reserven, müssen diese vor dem Gang zur Sozialhilfe praktisch aufgebraucht werden. Aufgrund dieser strikten Bedingungen verzichten viele Menschen darauf, Sozialhilfe zu beziehen, sogar wenn sie das Recht dazu hätten. Nicht zuletzt haben die politischen Attacken auf die Sozialhilfe dazu geführt, dass Armut in der Schweiz noch immer als individuelles Versagen empfunden wird. So schämen sich viele und versuchen lieber, irgendwie durchzukommen. Auch trägt die Aussicht, später die Sozialhilfe zurückzahlen und also in Raten abstottern zu müssen, nicht dazu bei, dass Menschen ihr Recht auf Unterstützung wahrnehmen.
Gar riskant ist der Gang auf das Sozialamt für Migrantinnen und Migranten. Bei ihnen hat eine kürzliche Verschärfung des Ausländer- und Integrationsgesetzes dazu geführt, dass sie um ihren Aufenthaltsstatus fürchten müssen, wenn sie längerfristig Sozialhilfe beziehen. Zwar haben Bund und Kantone versichert, dass diese Verknüpfung in der Coronakrise nicht gelten soll. Aber wie werden das Staatssekretariat für Migration oder die kommunalen Einbürgerungskommissionen in einem oder zwei Jahren oder später beurteilen, ob die Notlage direkt auf Corona zurückzuführen ist? Diese Unsicherheit führt dazu, dass die sich in Not Befindenden zögern, staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Zu gross scheint ihnen die Gefahr, die Zukunft ihrer Kinder in der Schweiz aufs Spiel zu setzen. Sie suchen stattdessen die Hilfswerke auf. Diese können für kurze Zeit Überbrückungshilfe leisten, aber auf die Dauer niemals die nötige Unterstützung über einen längeren Zeitraum geben, die die Menschen brauchen. Noch verheerender ist die Lage für Sans-Papiers. Sie haben keinerlei Anspruch auf staatliche Leistungen, obwohl sie zum grössten Teil seit Jahren in der Schweiz gearbeitet haben. Etliche wurden von ihren Arbeitgebern buchstäblich auf die Strasse gestellt, fristlos entlassen und haben kein Einkommen mehr. Viele Sans-Papiers waren daher während der Coronakrise komplett von der Unterstützung von Hilfswerken oder spezialisierten Beratungsstellen für Sans-Papiers abhängig. Erst nach und nach haben insbesondere Städte wie Genf und Zürich Unterstützungsfonds geschaffen.
IV. Armut als künftige Herausforderung
Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise werden sich erst noch zeigen – auf die Gesundheitskrise wird eine wirtschaftliche und soziale Krise folgen. Bis Anfang 2021 hat sich die Arbeitslosigkeit in der Schweiz beinahe verdoppelt. Auch wenn Prognosen schwierig sind, wird es mit Sicherheit zu weiteren Entlassungen kommen. Viele Menschen werden ihre Arbeit verlieren, finanzielle Einbussen erleiden und mittel- bis langfristig auf Unterstützung angewiesen sein. Die SKOS geht in ihrer Analyse davon aus, dass es in der Sozialhilfe bis ins Jahr 2022 einen Zuwachs von über 21 Prozent geben könnte.3
Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Armut in der reichen Schweiz die zukünftige sozialpolitische Herausforderung sein wird. Wie hat die Politik auf die bisherigen Auswirkungen der Coronakrise und auf die steigende Armut reagiert? Kleine Bewegungen sind möglich geworden. Vermehrt sind Parlamentarierinnen und Parlamentarier sensibilisiert auf Armutsfragen. So haben die eidgenössischen Räte den Bundesrat im Juni 2020 beauftragt, ein regelmässiges Monitoring der Armutssituation in der Schweiz einzurichten. Ein solches hatte der Bundesrat ein Jahr zuvor noch als unnötig abgelehnt. Ein schweizweites Armutsmonitoring soll Bund, Kantonen und Gemeinden wichtige Erkenntnisse für die Prävention und Bekämpfung von Armut liefern und auf Bestandesaufnahmen der Armutssituation in den Kantonen aufbauen. Denn es sind die Kantone, die für viele Bereiche einer umfassenden Armutspolitik verantwortlich sind. Dazu gehören etwa die Bildungs- und Wohnungspolitik, die Gesundheits-, Familien- und Finanzpolitik. Viele Kantone wissen noch viel zu wenig, wer bei ihnen armutsgefährdet ist, nur die Hälfte der Kantone hat in den letzten zehn Jahren Armutsberichte erstellt. Um vorzuführen, wie sinnvoll solche Bestandesaufnahmen sind, haben die Berner Fachhochschule und Caritas ein Modell für ein kantonales Armutsmonitoring erarbeitet, das auf vorhandene Daten, inklusive Steuerdaten, zurückgreift.4 So kann nebst der Einkommensarmut auch das Vermögen erfasst werden. Auf diese Weise gewinnt ein Kanton ein genaueres Bild, welche Bevölkerungsgruppen besonders von Armut bedroht sind und wie die bereits vorhandenen Instrumente wirken.
Das Modell ist bei einzelnen Kantonen, aber auch beim Bund und in der Politik auf Interesse gestossen. Dies zeigt, wie fruchtbar eine Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft, öffentlicher Verwaltung und Politik sein kann, um in der Armutsbekämpfung einen Schritt weiterzukommen.
V. Es bedarf kurz- und längerfristiger Perspektiven
Um nicht noch mehr Menschen in die Armut abzudrängen, werden kurz- und langfristige Perspektiven benötigt. Dazu sollte die Politik ideologische Grabenkämpfe überwinden und diejenigen vor Augen haben, die im Moment daran sind, alles zu verlieren. Dass die aktuellen Hilfsprogramme und Massnahmen des Bundes bis zum Ende der Krise weitergeführt werden müssen, darüber herrscht allgemeine Einigkeit. Sie müssen aber nicht nur bis zum Ende der Gesundheitskrise, sondern darüber hinaus andauern. Viele Massnahmen zielen zudem stark auf den Mittelstand, und die KMUs, die «kleinen Menschen», stehen nicht im Fokus der Politik. Für Menschen, die finanziell nicht mehr zurechtkommen und doch noch nicht in der Sozialhilfe sind, müssen neue Instrumente wie beispielsweise unbürokratische Direktzahlungen eingeführt werden.
Dies kann in der Form von Ergänzungsleistungen sein, wie dies bereits vier Kantone für Familien praktizieren. Menschen mit niedrigem Einkommen, die auf Kurzarbeit gesetzt wurden oder gar ihre Arbeit verlieren, benötigen Kurzarbeits- oder Arbeitslosenentschädigung, die zu 100 Prozent ihrem bisherigen Lohn entspricht. Und zentral ist für viele, dass ihre Haushaltsbudgets entlastet werden. Würden Bund und Kantone ihre Prämienverbilligung stark erhöhen, würden sie damit einen entscheidenden Beitrag leisten. Die in den letzten Jahren stark gestiegenen Krankenkassenprämien bringen viele Menschen in prekären Situationen in die Schulden. Viele Kantone haben in den vergangenen Jahren bei der Prämienverbilligung gespart.
Die Coronakrise hat auch dazu geführt, dass sich die Digitalisierung stark beschleunigt hat. Dadurch sind bereits weitere Arbeitsplätze für Menschen mit geringer Bildung oder nicht mehr genügender Qualifizierung verloren gegangen. Die Regionalen Arbeitsvermittlungen RAV und die Sozialdienste werden darum die Begleitung und Coachings stark ausbauen und sich viel intensiver mit Bildungsfragen auseinandersetzen müssen. Bis jetzt richtete sich der Blick vor allem darauf, möglichst schnell wieder eine Arbeit zu finden. Ohne entsprechende Weiterbildungen werden viele keine Chancen auf dem sich schnell verändernden Arbeitsmarkt mehr haben. In der Schweiz leben über 800 000 Menschen mit ungenügenden Grundkompetenzen in Lesen, Schreiben und IT-Kenntnissen. Sie dürfen nicht sich selbst überlassen werden. Armut bedeutet nicht nur, zu wenig finanzielle Mittel zu haben. Armut bedeutet fehlende Perspektiven, Verlust des Selbstvertrauens, Ausgrenzung von allem, was in einer Gesellschaft als üblich angesehen wird. Wir alle werden in den nächsten Jahren unseren Beitrag leisten müssen, um dem Zusammenhalt in der Schweiz Sorge zu tragen und jedem und jeder in dieser Gesellschaft einen Platz zuzugestehen, um ein Leben in Würde leben zu können. Die Schweiz kann und muss sich dies leisten. Sie steht – trotz aller Krise – wirtschaftlich an einem ganz anderen Ort als viele ärmere Länder, die diese Möglichkeit nicht haben. Weltweit werden laut Weltbank in den nächsten Jahren zusätzliche 150 Millionen Menschen um die nackte Existenz und 150 weitere Millionen Menschen gegen akuten Hunger kämpfen müssen. Auch gegen die weltweit zunehmende Ungleichheit kann die Schweiz einen Beitrag leisten. Aber dies wäre der Inhalt eines eigenen Beitrags.
Anmerkungen
1BFS: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-82382.html (Zugriff: 20. 7. 2021).
2BFS: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-frau-mann/erwerbstaetigkeit/unterbeschaeftigung.html (Zugriff: 20. 7. 2021).
3SKOS: Analysepapier zur Corona-Pandemie: Aktuelle Lage und zukünftige Herausforderungen für die Sozialhilfe. Bern, 7. Januar 2021.
4Fluder, Robert; Hümbelin, Oliver: Ein Armutsmonitoring für die Schweiz: Modellvorhaben am Beispiel des Kantons Bern, Bern, September 2020.