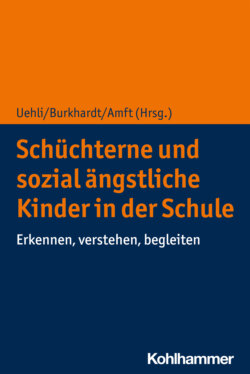Читать книгу Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule - Группа авторов - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3 Soziale Risikofaktoren
ОглавлениеWelchen Einfluss können soziale Risikofaktoren noch haben, nachdem deutlich wurde, wie viele differenzierte biopsychische Faktoren, also in der Person liegende, wirksam sind und einen deutlichen Einfluss auf die Entwicklung einer sozialen Angststörung ausüben? Im Sinne der nächstliegenden sozialen Einflüsse sind neben Gleichaltrigen vor allem die Familie bzw. Eltern zu betrachten (Büch et al., 2015). Da auf den Einfluss von Gleichaltrigen bereits im Rahmen von Abschnitt 1.1 eingegangen wurde, sollen nachfolgend die Eltern im Blickpunkt stehen.
Elterliches Verhalten hat immer eine Vorbildwirkung und zudem einen bekräftigenden Einfluss. Da knapp jedes zweite Kind mit einer psychischen Störung einen Elternteil hat, der ebenfalls eine psychische Erkrankung aufweist, ist sowohl von genetischen als auch von sozialen Faktoren als Wirkgrößen auszugehen (Mattejat & Remschmidt, 2008).
Mütter von schüchternen, sozial unsicheren und ängstlichen Kindern beurteilen sich selbst als äußerst ängstlich, wie Melfsen et al. (2000) in ihrer Studie herausfanden. Sind oder fühlen sich Eltern belastet, so kann ihr Alltags-Stressmanagement eingeschränkt sein und sie schätzen sich eher negativ in ihrer Erziehungskompetenz ein. Dies gilt insbesondere für Mütter (Essex et al., 2010). Unter diesen Bedingungen zeigen Eltern Verhaltensweisen, die ein ungünstiges Vorbild für ein Kind bieten. Sozial ängstliche Familien haben wenig Sozialkontakte. Bedrohlich erlebte soziale Situationen werden gemieden. Damit imitieren die Kinder solches Rückzugsverhalten, sie übernehmen die negative Bewertung der Eltern gegenüber Sozialkontakten, und darüber hinaus erlernen sie keine altersangemessenen Verhaltensweisen für den Umgang mit anderen. Soziale Kompetenzen, wie Kontakt anbahnen und aufrechterhalten, sich einfühlen in andere, aber auch sich behaupten und abgrenzen können, bis hin zur Fähigkeit, soziale Herausforderungen anzunehmen, werden nicht eingeübt. Die Kinder lernen also über das Vorbild der Eltern nicht nur sozial inkompetentes Verhalten, sondern auch verzerrte Wahrnehmungen wie zum Beispiel zweideutige oder neutrale Situationen als bedrohlich einzustufen (Petermann & Petermann, 2015).
Die schüchternen, sozial ängstlichen Kinder werden von ihren Eltern weder ermutigt noch unterstützt, eine soziale Herausforderung, wie in einer Gleichaltrigengruppe oder bei Besuch oder vor der Klasse etwas zu äußern, nicht zu meiden, sondern sich ihr zu stellen. Es liegt also oft ein überbehütendes bis überkontrollierendes Erziehungsverhalten vor. Die Eltern nehmen ihrem ängstlichen Kind Probleme bzw. herausfordernde Aufgaben ab. Dem Kind wird von den Eltern in der Regel unabsichtlich vermittelt: Wir trauen dir nichts zu! Stattdessen wird vermeidendes und an die Eltern anklammerndes Verhalten des Kindes positiv bewertet und damit bekräftigt. Nicht mutiges, sondern ängstliches Verhalten wird fälschlicherweise von den Eltern verstärkt. Das ängstliche, gehemmte und hilflose Verhalten des Kindes bekräftigt wiederum die Eltern in ihrem überfürsorglichen Erziehungsverhalten. Somit liegt ein ungünstiger Kreislauf von dem Temperamentsmerkmal Verhaltenshemmung auf Seiten des Kindes und dem zu behütenden sowie auch verwöhnenden Erziehungsverhalten der Eltern, vor allem wiederum der Mutter, vor (Lewis-Morrarty et al., 2012).
Schließlich können schüchterne, sozial ängstliche Kinder und Jugendliche das überfürsorgliche und überkontrollierende elterliche Verhalten auch ganz anders erleben, nämlich als wenig akzeptierend. Vielmehr nehmen die Kinder ihre Eltern als stark einschränkend wahr. Sogar zurückweisend wirken Eltern auf ihre Kinder dann, wenn ein Elternteil selbst unter einer psychischen Störung leidet. Dadurch kann die Erziehungskompetenz noch mehr eingeschränkt sein. Dies ist besonders bei einer depressiven Störung der Fall. Diese Störung bringt für ein Kind im Alltag unvorhersehbare und unkontrollierbare Bedingungen mit sich. Geht es dem Elternteil gut, reagiert dieser emotional positiv auf das Kind; tritt eine depressive Verstimmung auf, reagiert dieser Elternteil abweisend bis aggressiv gegenüber dem Kind (Seligman, 2016). Dadurch tritt eine große Verunsicherung beim Kind auf, was sozial ängstliches Verhalten verstärkt.