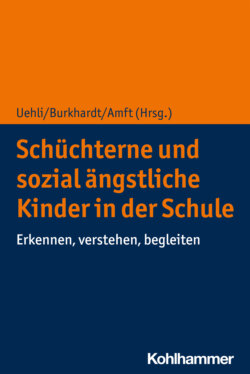Читать книгу Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule - Группа авторов - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.4 Bedingende und aufrechterhaltende Faktoren: Ein integratives Modell
ОглавлениеDie bisherigen Ausführungen zeigten, dass drei sehr unterschiedliche Einflussfaktoren, nämlich biologische, psychische und soziale Wirkgrößen, die Schüchternheit eines Kindes verursachen und aufrechterhalten. Diese drei Faktoren gehen in einem pathogenetischen Prozess komplizierte Wechselbeziehungen ein, die keine einfachen Interaktionen darstellen, sondern biopsychosoziale Transaktionen. Dabei müssen im Laufe einer Entwicklung mehrere Risikofaktoren zusammenkommen, bis sich eine psychische Störung aufbaut. Unterschiedliche Entwicklungspfade sind hierbei denkbar. Sroofe (1997) zeigt vier generell mögliche Verläufe auf. Sie werden am Beispiel schüchterner Kinder verdeutlicht.
• Kontinuierliche Fehlanpassung: Ein Kind zeigt von Anfang an extrem schüchternes Verhalten, zum Beispiel ausgeprägtes Fremdeln im ersten Lebensjahr, und ist die gesamte Kleinkind- und Vorschulzeit hindurch sehr verhaltensgehemmt. Die Eltern zeigen überbehütendes Erziehungsverhalten und geben kein sozial kompetentes Vorbild ab. Das Ergebnis ist eine Störungsentwicklung der sozialen Ängstlichkeit, die spätestens im Grundschulalter sehr deutlich hervortritt.
• Kontinuierliche positive Anpassung: Ein Kind zeigt ein übliches, das heißt altersangemessen fremdelndes und schüchternes Verhalten während der Säuglings- und Kleinkindzeit. Die Eltern interagieren mit ihrem Kind ermutigend, unterstützend, ohne ihm Aufgaben abzunehmen, die es schon selbst bewältigen kann, und bekräftigen es für sozial kompetentes und nicht vermeidendes Verhalten. Eine positive Entwicklung ist bei dem Kind durchgängig zu beobachten.
• Anfängliche Fehlanpassung, gefolgt von positiven Veränderungen: Ein Kind zeigt von Anfang an sehr schüchternes und anklammerndes Verhalten, zum Beispiel ausgeprägtes Fremdeln im ersten Lebensjahr, ist sehr verhaltensgehemmt und versucht, unvertraute soziale Situationen, soziale Hervorhebung sowie fremde Personen zu vermeiden. Die Eltern ermutigen ihr Kind zu Sozialkontakten, bekräftigen es für nicht-vermeidendes Sozialverhalten, sind sozial kompetent in Kontaktsituationen mit anderen und bewerten diese positiv. Dadurch ist das Kind trotz des Temperamentsmerkmals Verhaltenshemmung sowie schüchternen Verhaltens zu sozial kompetentem Verhalten in der Lage. Eine Störungsentwicklung bleibt aus.
• Anfänglich positive Anpassung, gefolgt von negativen Veränderungen: Ein Kind zeigt ein übliches, das heißt altersangemessen fremdelndes und schüchternes Verhalten während der Säuglings- und Kleinkindzeit. Im Laufe der frühen bis mittleren Kindheit tritt schüchternes, sich leicht schämendes und sich nichts zutrauendes Verhalten auf, auf das die Eltern besorgt und umsorgend reagieren, Rückzugsverhalten des Kindes akzeptieren sowie das Kind mit seinem vermeidenden Verhalten anderen gegenüber in Schutz nehmen. Damit liegt ein falsch verstärkendes Interaktions- und Erziehungsverhalten der Eltern vor. Das Risiko für die Entwicklung einer Störung mit sozialer Ängstlichkeit steigt deutlich an, obwohl wahrscheinlich genetische Aspekte die geringste oder gar keine Rolle spielen. Was das verlegen-schüchterne Verhalten in früher bis mittlerer Kindheit ausgelöst hat, kann sehr unterschiedlich sein, zum Beispiel eine negative Erfahrung mit (öffentlicher) Kritik, mit Gehänselt-Werden oder sozialem Ausschluss. Ebenso kann ein schlechtes Selbstbild mit geringer Selbstwirksamkeitsüberzeugung eine Bedeutung haben. Dieses schüchterne Verhalten erinnert an den Typ verlegene Schüchternheit, die Buss (1986) dem Typ ängstliche Schüchternheit gegenüberstellt (siehe Abschnitt. 2.2) und welche in der Studie von Poole und Schmidt (2020) untersucht werden sowie eine Bestätigung finden.
Abb. 1: Integratives Ursachenmodell sozialer Angststörungen im Kindes- und Jugendalter (Petermann & Petermann 2015, S. 54)
Die vier beispielhaften Entwicklungspfade verdeutlichen, unter welchen Voraussetzungen sich eine Störung mit sozialer Ängstlichkeit bei schüchternen Kindern entwickeln kann. Die Multikausalität ist biopsychosozial, je nach Einzelfall mit unterschiedlichen Gewichtungen zu sehen. Die nachfolgende Abbildung 1 zeigt mögliche Zusammenhänge und Abläufe verschiedener, verursachender Faktoren, die zu einer Störung mit sozialer Ängstlichkeit führen können.