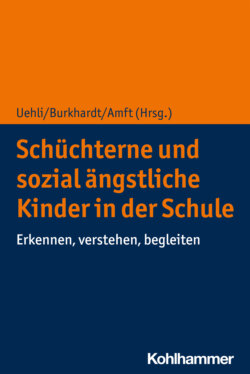Читать книгу Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule - Группа авторов - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2 Anwendung in der Schule
ОглавлениеAbschließend werden zwei evidenzbasierte Präventionsprogramme zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen im schulischen Unterricht aus dem deutschen Sprachraum skizziert. Eine dritte Intervention, die vorgestellt wird, stammt zwar aus dem therapeutischen Setting, enthält jedoch spezifische Materialien für schüchterne, sozial unsichere und ängstliche Kinder, die mit ein paar Modifikationen flexibel im Schulkontext von der Lehrkraft oder einem Schulsozialarbeiter bzw. einer Schulsozialarbeiterin eingesetzt werden können.
Bei dem ersten Präventionsprogramm, das vorgestellt wird, handelt es sich um das »Verhaltenstraining in der Schule« von Petermann et al. (2019). Es ist für Kinder in der 3. und 4. Grundschulklasse konzipiert und wird von einer Lehrerin oder einem Lehrer durchgeführt. Es umfasst 26 Einheiten, die im Laufe eines Schulhalbjahres mit einem oder zwei Terminen pro Woche realisiert werden. Für eine Trainingseinheit benötigt man eine Unterrichtsstunde, je nach Schülerzusammensetzung auch eine Doppelstunde. Die Ziele des Verhaltenstrainings sind unter anderem die
• Sensibilisierung für die Selbst- und Fremdwahrnehmung von Emotionen,
• Verbesserung der Selbstkontrolle und Selbststeuerung,
• Förderung der sozialen Wahrnehmung und
• Sensibilisierung für soziale Interaktionsprozesse.
Eine Rahmenhandlung führt die Schülerinnen und Schüler durch das Präventionsprogramm. Sie ist in Form eines Hörspiels mit dem Thema »Abenteuer auf Duesternbrook« aufbereitet. Vier neunjährige Freunde erleben diese Abenteuer, die sogenannten Leitfiguren, mit denen sich die Schulkinder identifizieren können. Entsprechend unterschiedlich sind die vier Leitfiguren des Hörspieles gestaltet: Zwei Mädchen, zwei Jungen mit je unterschiedlichem sozialem und kulturellem Hintergrund sowie verschiedenen Stärken und Schwächen (Abbildung 2). Gemeinsam wollen sie die Geheimnisse der Burg lüften. Das Hörspiel, viele Materialien und ein Rap-Song befinden sich auf einer DVD im Buch und helfen mit wiederkehrenden Ritualen und Verhaltensübungen, das Präventionsprogramm durchzuführen.
Das zweite Präventionsprogramm für den schulischen Einsatz, das vorgestellt werden soll, ist das »Emotionstraining in der Schule« (Petermann et al., 2016). Es richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Klassen, wird von der Lehrkraft im Unterricht durchgeführt und verfolgt das Ziel, emotionale Kompetenzen im Jugendalter gezielt zu stärken und damit internalisierenden Problemen im Jugendalter, nämlich Ängsten und Depressionen, vorzubeugen. In den elf Sitzungen werden das Emotionsbewusstsein, das Emotionsverständnis, die Emotionsregulation und die Empathiefähigkeit multimethodal bearbeitet. Jede Unterrichts-Einheit bzw. Sitzung ist hoch ritualisiert aufgebaut. Nach der Begrüßung und Erinnerung an die vorherige Sitzung folgt zum Einstieg die sogenannte Tonübung. Hierbei handelt es sich um eine Achtsamkeitsübung (s. a. die Studienergebnisse von Caldwell et al., 2019, in Abschnitt 3.1), die akustisch mit Hilfe der DVD realisiert wird. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich mit geschlossenen Augen auf einen Ton konzentrieren, der langsam ausklingt. Wer ihn nicht mehr hört, soll die Hand heben. Damit wird die Aufmerksamkeit auf sich und die eigenen Gefühle gelenkt. Es schließt sich dann der Hauptteil, nämlich die Arbeitsphase mit Arbeitsblättern, an, die mit der Besprechung der Hausaufgaben zu den Sitzungsinhalten endet. Hier kann je nach Entwicklungsstand der Schüler/-innen zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden der Arbeitsblätter gewählt oder auch Zusatzblätter eingesetzt werden (Abbildung 3). Mit der Kunstsprache Emola werden auf akustischer Ebene von acht Gefühlen die charakteristischen Merkmale herausge-arbeitet. Mit einem Gefühlsquiz, mit dem die Lerninhalte der Einheit wiederholt werden, wird jede Sitzung abgeschlossen. Dazu wird eine Klasse in zwei Hälften geteilt und jede Gruppe erhält Basisfragen und Masterfragen. Die Mitglieder der beiden Klassenhälften bleiben während der elf Sitzungen konstant.
Abb. 2: Die vier Freunde des Hörspiels »Abenteuer auf Duesternbrook« (Petermann et al., 2019, S. 76; Zeichnung von Irene Stetzka und Iris Walter)
Abb. 3: Gefühle – Gedanken – Verhalten: eine Zuordnungsaufgabe (Petermann et al., 2016, S. 146; Zeichnung von Lara Petersen und Julia-Katharina Rißling)
Einen auf die Störung mit sozialer Ängstlichkeit speziell bezogenen Ansatz bietet das »Training mit sozial unsicheren Kindern« (Petermann & Petermann, 2015) mit seinen vielfältigen Arbeitsmaterialien, Fotogeschichten und Rollenspielvorlagen. Es handelt sich zwar bei dem Training um ein Behandlungsprogramm für Kinder mit unterschiedlichen Angststörungen; es kann jedoch auch als selektive oder indizierte Präventionsmaßnahme von fortgebildeten Pädagogen und Pädagoginnen, Beratungslehrerinnen und -lehrern, Schulpädagogen und -pädagoginnen sowie Schulpsychologinnen und -psychologen angewendet werden. Viele Themen und Arbeitsmaterialien berühren direkt die Probleme sozial ängstlicher Kinder im Kontext Schule und Vorschule. So sind die psychoedukativen Geschichten von Marie und Sophie bzw. von Niklas und Max in der Schule angesiedelt und beinhalten sowohl Aspekte sozialer Hervorhebung als auch solche einer neuen und fremden Umgebung mit fremden Personen. Die Fotogeschichten greifen Themen auf wie Vorlesen vor der Klasse oder Die Beleidigung oder Der Deutschaufsatz oder aufgerufen werden in der Schule. Alle Geschichten und Materialien sind jungen- und mädchenspezifisch ausgestaltet. Darüber hinaus sind die Materialien nicht nur angststörungsspezifisch, sondern auch altersspezifisch aufbereitet.
Das Vorgehen gliedert sich in Einzel- und Gruppenkontakte, wobei die Themen des Einzeltrainings auch in einer Kindergruppe bearbeitet werden können. Auch hier gibt es ein klares Sitzungsritual mit sitzungsübergreifenden, also wiederkehrenden, Elementen sowie Leitfiguren, die die Kinder durch das Training geleiten, ihnen Sicherheit geben, Mut zusprechen und mit ihnen gemeinsam Fortschritte erzielen. Eine zusätzliche Unterstützung sind die 60 Bildkarten, die bunt und altersspezifisch die Leitfiguren in verschiedenen herausfordernden Alltagssituationen zeigen (Petermann & Petermann, 2016).
Für den Alltagstransfer haben sich schon sehr lange Instruktionskarten für Kinder bewährt und als effektiv erwiesen (Abbildung 4). Die Kinder erlernen in Rollenspielen für unterschiedliche Alltagssituationen sich in angemessener Weise zu instruieren, um die verzerrte Wahrnehmung und die irrationalen Gedanken zu verändern und mit Selbstbewusstsein eine soziale Situation zu meistern (siehe Abschnitt 2.2).
Ein kurz gefasster Ratgeber informiert Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher über soziale Ängste und Leistungsängste, woran man sie erkennen kann, was die Ursachen sind, was die Ängste aufrecht hält, was bei Jugendlichen anders als bei Kindern ist und was man tun kann (Büch et al., 2015b). Diese kurzen und präzisen Informationen helfen, sich im Umgang mit und bei der Förderung von schüchternen, sozial ängstlichen Kindern sicher zu fühlen, was eine gute Voraussetzung für erfolgreiches Arbeiten mit diesen Kindern ist.
Abb. 4: Mutmacher-Selbstinstruktion von Sophie und von Max (Petermann & Petermann, 2015, S. 271 u. S. 272; Zeichnungen von Claudia Styrsky)