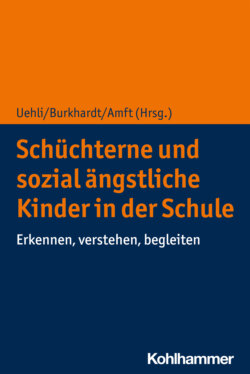Читать книгу Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule - Группа авторов - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.1 Prävention: Soziales Kompetenztraining
ОглавлениеWie in den bisherigen Ausführungen deutlich wurde, fehlt es schüchternen, sozial ängstlichen Kindern unter anderem wegen ihres Vermeidungsverhaltens an sozial kompetentem Verhalten. Dieses haben sie zu wenig gelernt und geübt, so dass das mangelnde Zutrauen in eigene soziale Kompetenzen bei manchen schüchternen Kindern durchaus einen realen Hintergrund haben kann. Die soziale Ängstlichkeit, die oft als biologische und psychische Basis das stabile Temperamentsmerkmal Verhaltenshemmung aufweist, kann als solche nicht verändert werden. Jedoch bedeutet Sicherheit in sozialen Situationen durch soziale Kompetenz zu gewinnen, einen Schutzfaktor aufzubauen, der die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung von der bloßen Schüchternheit zur Störung mit sozialer Angst minimiert.
Wie sich in einzelnen Studien (Ginsburg et al., 2020; Petermann et al., 2016; Petermann et al., 2019), Meta-Analysen (Johnstone et al., 2018) und systematischen Reviews (Caldwell et al., 2019) zeigte, weisen die Ergebnisse teilweise in unterschiedliche Richtungen. Prinzipiell kann festgestellt werden, dass universelle Präventionsmaßnahmen Effekte haben, die sich eher zu Follow-Up-Messzeitpunkten zeigen (d. h., zwischen durchschnittlich sechs bis zwölf Monaten nach Maßnahmenende) als direkt nach Ende der Durchführung eines Präventionsprogrammes (Ginsburg et al., 2020, Johnstone et al., 2018).
Auch sind die Effekte klein, was aber für universelle Präventionen nichts Außergewöhnliches ist. Eine universelle, schul-basierte Prävention schließt immer den gesamten Klassenverband ein. Das bedeutet, dass viele Schüler keine Probleme mit Schüchternheit oder sozialer Angst haben. Also kann es bei solchen Kindern auch zu nur wenig bis gar keinem Zuwachs an sozialer Kompetenz und Verringerung von sozialer Ängstlichkeit kommen. Treten dann in einer Studie oder Meta-Analyse nachweislich Effekte auf, wie in der Meta-Analyse von Johnstone et al. (2018) zum australischen FRIENDS-Programm von Barrett und Turner (2001), dann kann von einer klinischen wie praktischen Bedeutsamkeit ausgegangen werden. Dieses Präventionsprogramm mit einem kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansatz wird im Gruppensetting im Rahmen von zehn bis 12 Sitzungen mit ängstlichen Kindern im Alter von sieben bis 16 Jahren und deren Eltern durchgeführt. Allerdings sind in dieser Meta-Analyse die Ergebnisse uneinheitlich, da sich die einbezogenen Studien unter methodischen Aspekten, die angewendeten Präventionsprogramme (FRIENDS war eines von dreien), die Ziele (Angst- und/oder Depressionsprävention) und die Anzahl der Sitzungen unterschieden. Neben einem strukturierten, modularisierten, kognitiv-verhaltenstherapeutischen Vorgehen scheint auch die Sitzungsanzahl nicht unwichtig zu sein. Mehr Sitzungen haben einen positiven Effekt, besonders hinsichtlich der langfristigen Wirkung von Präventionsmaßnahmen (Ginsburg et al., 2020; Johnstone et al., 2018).
Bei im Widerspruch zu vielen Studien und Meta-Analysen stehenden Ergebnissen des systematischen Reviews kombiniert mit einer Netzwerk-Meta-Analyse von Caldwell et al. (2019) werden bei den universellen Präventionsmaßnahmen keine oder nur sehr schwache positive Tendenzen festgestellt, und zwar für Kinder im Primarschulalter. Für den Sekundarschulbereich werden etwas deutlichere positive Effekte berichtet, je nach Art der Präventionsmethode in einer Studie. Interessanterweise waren nach dieser Studie nicht die kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansätze im Sekundarbereich die wirksamsten bei Angstsymptomen, sondern Achtsamkeits- und Entspannungsmethoden. Die Ergebnisse deuten auf einen Alterseffekt hin. Zum einen ist die kognitive Entwicklung bei Sekundarschülern fortgeschrittener als bei Primarschüler/-innen, so dass die älteren Kinder und Jugendlichen mehr von solchen Maßnahmen profitieren können. Zum anderen sind Angstsymptome bei älteren Schüler/-innen deutlicher ausgeprägt, so dass präventive Interventionsmaßnahmen auch größere Wirksamkeit entfalten können. Schließlich deuten die Ergebnisse von Caldwell et al. (2019) darauf hin, dass für die Effektivität von Präventionsprogrammen der sozio-ökonomische Status der Schüler/-innen und ihrer Familien eine Rolle spielt. Ein höherer sozio-ökonomischer Status trägt scheinbar zu besseren Ergebnissen bei, allerdings nur bei den Sekundarschüler/-innen. Bei den Kindern aus dem Primarbereich macht sich dieser Effekt noch nicht bemerkbar.