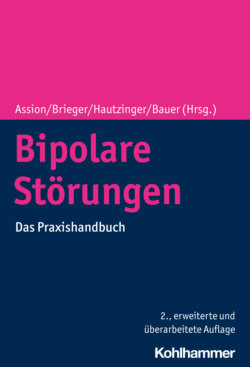Читать книгу Bipolare Störungen - Группа авторов - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Von der griechischen Antike bis zur Neuzeit
ОглавлениеZustände von Depression und Exaltation wurden zwar erstmalig von Hippokrates und den Hippokratikern wissenschaftlich beschrieben, sie waren aber bereits den prähippokratischen Ärzten, Philosophen und Dichtern des Altertums bekannt.
Hippokrates (ca. 460–370 v. Chr.) beschrieb jedoch als Erster systematisch die beiden Zustände und führte sie vor allem auf körperliche Ursachen zurück. Seine Schilderungen von Melancholie und Manie unterscheiden sich nicht so deutlich von den heutigen, wie manche Autoren meinen, sondern sie stellen eher eine breitere Gruppe von Erkrankungen dar als die aktuellen. Auch andere antike Ärzte, wie Galenos von Pergamon, Soranus von Ephesos oder Aurelianus, ergänzten und bereicherten die hippokratischen Beschreibungen.
Eine ganz besondere Stellung in der Reihe der Gründer der wissenschaftlichen Medizin nimmt Aretäus von Kappadokien ein. Aretäus, ein berühmter griechischer Arzt der Antike in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts, war der Erste, der ein Alternieren von Melancholie und Manie annahm. Somit hat er erstmals bipolare Erkrankungen beschrieben (Marneros 2004b). Es ist verwunderlich, dass manche Autoren, so etwa Berrios (1988) oder Fischer-Homberger (1968), ihn nicht als den Erstbeschreiber der bipolaren Erkrankungen sehen. Das Studium der entsprechenden Kapitel seines Buches »Über Ursachen und Symptome der chronischen Krankheiten« (1. Buch, Kap. V und VI) lässt jedoch keinen Zweifel daran. Das Argument, die Begriffe Manie und Melancholie meinten damals etwas anderes als das, was wir heute darunter verstehen, ist unserer Meinung nach nicht haltbar. Sie definierten etwas Breiteres und Umfassenderes, aber nicht etwas grundsätzlich anderes.
Das Aufeinanderfolgen von Manie und Melancholie wurde auch von späteren Autoren vor allem im 17., 18. und 19. Jahrhundert beschrieben. Repräsentativ seien hier Willis (1672), Esquirol (1820), Heinroth (1818), Griesinger (1845) sowie andere europäische Psychiater (vgl. Stone 1977) erwähnt. Griesinger (1845) beschrieb nicht nur den Übergang der Melancholie zur Manie, den er als gewöhnlich bezeichnete, sondern er vertrat auch die Auffassung, dass die Erkrankung aus einem Zyklus beider Formen besteht, mit regelmäßigem Alternieren.
Wie Haugsten (1995) in seiner Darstellung der Geschichte der bipolaren Erkrankungen schreibt, erkannten Willis (1672), Morgagni (1761) und Lorry (1765) bereits im 17. und 18. Jahrhundert die longitudinale Verbindung von Manie und Melancholie. Stone (1977) berichtete, dass Mead (1673–1754) in England – genau wie Aretäus von Kappadokien – vermutete, Manie und Melancholie seien unterschiedliche Erscheinungsformen ein und desselben Prozesses. Chiarugi (1759–1820) aus der Toskana notierte: »Der Maniker ist wie ein Tiger oder wie ein Löwe, und man kann annehmen, dass die Manie das Gegenteil zu echter Melancholie ist.« Im Frankreich des 19. Jahrhunderts, wie Pichot (1995) schreibt, florierte eine exakte deskriptive Psychopathologie, die jedoch traditionalistisch war, und so vertraten prominente Psychiater der damaligen Zeit, wie Pinel oder Esquirol, noch die Auffassung, dass melancholische und manische Episoden Erscheinungsformen unterschiedlicher psychischer Störungen seien. Die Autoren des 17. und 18. Jahrhunderts, die ein Alternieren der beiden Formen berichteten, zogen jedoch nicht die Schlussfolgerung, dass es sich hierbei um eigene Entitäten handelt. Dieser Schritt wurde erst mit Falret (1851) vollzogen.
Im Jahr 1851 erschien in der Gazette des Hôpitaux ein dreizehnzeiliger kurzer Absatz (»De la folie circulaire ou forme de maladie mentale characterisée par l’alternative régulière de la manie et de la mélancholie«), in welchem Falret (1794–1870) erstmals eine eigene Form der psychischen Erkrankung, also eine nosologische Entität, beschrieb, die er folie circulaire (im Deutschen als zirkuläres Irresein übernommen) nannte. Die folie circulaire ist gekennzeichnet durch einen kontinuierlichen Zyklus von Depression, manischer Exaltation und einem unterschiedlich langen freien Intervall. Dieses Konzept wurde in den darauffolgenden Jahren vervollkommnet, sodass im Jahre 1854 zunächst eine ausführlichere Darstellung in den »Leçons cliniques de médecine mentale faites à l’hospice de la Salpêtrière« erschien, die wenige Wochen später in einer Sitzung der Académie de la Médecine in Form einer Abhandlung unter dem Titel »Mémoire sur la folie circulaire, forme de maladie mentale characterisée par la reproduction successive et régulière de l’état maniaque, de l’état mélancolique, et d’un intervalle lucide plus ou moins prolongé« weiter ergänzt wurde. In den genannten Arbeiten wehrte sich Falret gegen die Auffassung, den Übergang der Manie in die Melancholie und umgekehrt als ein zufälliges Ereignis anzunehmen. Er meinte, dass eine bestimmte Kategorie von psychischen Erkrankungen bestehe, bei welchen sich kontinuierlich und in regelmäßiger Art und Weise die Aufeinanderfolge von Manie und Melancholie manifestiere. Dies betrachtete er als eine Grundlage zur Anerkennung einer besonderen Form von psychischer Erkrankung, eben der folie circulaire. Obwohl auch von früheren Autoren die Kontinuität und die Regelmäßigkeit des Aufeinanderfolgens von Melancholie und Manie beschrieben wurden, war Falret wohl der Erste, der aus dieser Tatsache das Vorliegen einer »besonderen« Form von Erkrankung erkannte (Langer 1994; Pichot 1995). Im Jahre 1854 präsentierte Baillarger sein Konzept der folie à double forme sowohl im Protokoll der Sitzung der Académie de la Médecine, in der auch Falret seine Abhandlung über die folie circulaire gelesen hat, als auch in der Arbeit »De la folie à double forme« in einer überaus polemischen Art und Weise gegenüber dem Falret‘schen Konzept. Die Dramatik der Auseinandersetzung zwischen Falret und Baillarger – auch in ihren menschlichen Dimensionen – sind von Pichot in faszinierender »plutarchischer Art und Weise«, wie er selbst sagte, als »Drama in drei Akten« – in einer, trotz mancher Ungenauigkeiten, etwa was Kahlbaum und die deutsche Psychiatrie betrifft, sehr lesenswerten Arbeit – dargestellt (Pichot 1995). Die Schlussfolgerungen, die beide Autoren gezogen haben, sind sehr unterschiedlich. Baillarger nimmt eine Art von Krankheitsanfall an, in der Manie und Melancholie ineinander übergehen, und postuliert Unterbrechungen, die zwischen den Episoden liegen. Der longitudinale Aspekt, der auch freie Intervalle berücksichtigt und für Falret von so großer Bedeutung ist, wird für die Diagnose einer Krankheitseinheit von Baillarger nicht mehr akzeptiert, sondern nur der Übergang von Manie zur Melancholie und umgekehrt. Eine tatsächliche Weiterentwicklung der Ansichten von Aretäus von Kappadokien, Mead oder Chiarugi stellen die Ansichten Falrets über die folie circulaire dar, während Jules Baillargers Konzept der folie à double forme den Anschauungen seines Lehrers Esquirol sehr ähnlich ist (Pichot 1995; Marneros und Angst 2000).