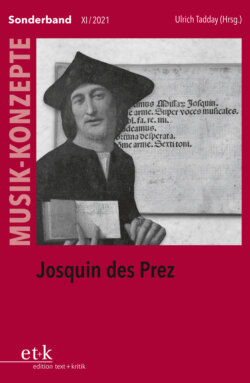Читать книгу MUSIK-KONZEPTE Sonderband - Josquin des Prez - Группа авторов - Страница 21
I
ОглавлениеIn der Allgemeinen Musikalischen Zeitung erschien 1837 die spöttische Rezension einer im Jahr zuvor in der Revue et Gazette Musicale gedruckten Novelle.1 Sie trägt den Titel La vieillesse de Guillaume Dufay. Der Rezensent fasst die für ihn absurde Handlung kurz zusammen: Die Geschichte spiele im März 1465, »in einer schönen Julinacht am Quai des Ormes zu Paris«. Als die nach dem Tod ihres Mannes und ihres Kindes wahnsinnig gewordene Protagonistin Helene, Geliebte von Dufays Schüler Josquin und im Hause Dufays lebend, in ihrer Verzweiflung zu singen beginnt, hört der alternde Komponist ihr zu:
»Dufay erstaunt über den Gesang, denn er wurde gewahr, dass er bei der Wiederholung sehr verschieden wurde, doch so, dass beide Weisen zusammenpassten. Natürlich theilt er diese seltsame Erscheinung seinem lieben Josquin mit. Beide sind höchst begierig und begeben sich zur Kranken. Sie singt; die Veränderungen der Melodie lassen sich abermals hören; vor Lust sind beide Meister ganz der Erde enthoben, vergessen die Kranke und alles um sich her, und in der Entzückung stimmen Beide zugleich laut und frisch den Doppelgesang an, von dessen Wirkung selbst die Kranke und Marion wundersam ergriffen werden. Die begeisterten Meister aber stürzen einander selig in die Arme, denn ›in demselben Augenblicke war der Contrapunkt entdeckt.‹ (Le contrepoint venait d’étre découvert!).«2
Autor der Novelle ist der Musikkritiker Jean Baptiste Nicolas Madeleine (1801–1868), der unter dem Pseudonym Stéphen de la Madeleine gesangspädagogische Schriften veröffentlichte, aber auch eine stattliche Zahl von historischen Erinnerungen und Erzählungen. Durch die deutsche Zusammenfassung erregte La vieillesse de Guillaume Dufay offenbar ein gewisses Aufsehen, der Text wurde noch von Franz Xaver Haberl 1885 in seiner Dufay-Monografie als Kuriosum, als »Abschweifung« zitiert.3 Es ist einigermaßen unklar, woher Madeleine seine Anregungen tatsächlich bezog, wahrscheinlich aber aus dem umfangreicheren Josquin-Aufsatz, den François-Joseph Fétis 1834 in seiner Revue Musicale herausgebracht hatte.4 Etwas später, im Jahr 1837, erschien noch Madeleines Novelle Les Psaumes de Josquin, in der die vom Kontrapunkt genesene Helene als Ehefrau des Komponisten wieder begegnet – und in der als weitere Quelle die in Glareans Dodekachordon überlieferten Anekdoten aufscheinen.5 Bemerkenswert an La vieillesse de Guillaume Dufay sind jedoch, unabhängig vom vollständig fiktiven Charakter der Geschichte, zwei Aspekte: Josquin und Dufay werden als Entdecker des Kontrapunkts gefeiert, also einer Satztechnik, die gleichsam in der Materie der Musik liegt und erst aufgefunden werden musste; zudem ist die Entdeckung dieses musikalischen Wunders, getreu einer romantischen Idee von Entgrenzung, auf eine verwickelte Weise an den Bewusstseinsverlust gebunden. Und doch, dies die seltsame Pointe der Erzählung, heilt die durch den Wahnsinn hervorgerufene Entdeckung am Ende sogar diesen, die geheime Protagonistin wird also wieder gesund.
Josquin des Prez galt im 19. Jahrhundert als »vielleicht der grösste, jedenfalls der bewundertste Contrapunktist der vorpalestrina’schen Zeit«.6 Die Verknüpfung seines Namens mit dem Kontrapunkt war jedoch keineswegs eine Erfindung des historistischen Zeitalters. Gute 100 Jahre früher zeigt sich dieselbe Verbindung auch bei Johann Mattheson, für den Josquin aber nicht der Erfinder des Kontrapunkts war, sondern derjenige, der ihn auf schreckliche Abwege gebracht habe. In seiner Critica Musica von 1722 hielt er fest, dass Obrecht, Ockeghem und insbesondere »Josquinus die harmonis.[che] Künsteley per Fugas ad Canones (i. e. extrema) getrieben/ und die sonst/ lange Zeit zuvor/ in den Moteten frey einhergegangene Fugen mit Ketten und Banden/ in seinen Missen/ beleget hat«.7 Immerhin teilte Mattheson dabei mit, dass er zum Beweis seiner Behauptung reichlich Material gesammelt habe, dies aber jetzt nicht weiter ausführen könne. Ob und welcher Art diese Belege waren, lässt sich daher höchstens vermuten.