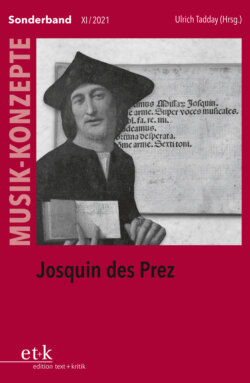Читать книгу MUSIK-KONZEPTE Sonderband - Josquin des Prez - Группа авторов - Страница 25
V
ОглавлениеEine zentrale Frage für das 15. Jahrhundert war das Verhältnis zur Antike, die sich auf die verschiedenste Weise und in einer denkbar großen Vielfalt beantworten ließ – nur nicht in der Musik, da es keine Musik aus dem Altertum gab, auf die man sich dabei produktiv hätte beziehen können. Offenbar entstand aber der Gedanke, eine Klärung wenigstens auf indirektem Wege herbeiführen zu können, durch die Vertonung von antiken Texten. Während der Rückgriff auf solche Texte im 15. Jahrhundert praktisch keine Rolle spielte, mehren sich um 1500 die Anzeichen zu einer verstärkten musikalischen Auseinandersetzung – wenn auch in offenbar gezielt herbeigeführten Einzelfällen. So vertonte Heinrich Isaac 1492 im Andenken an seinen Gönner Lorenzo de’ Medici einen Seneca-Text (Quis dabit pacem populo timenti). Oder es gibt die Versuche, in der Odenkomposition, wesentlich ausgehend von der Sammlung des Petrus Tritonis (1507), den weitgehend homophonen Satz auf die antiken Versmaße zurückzuführen.
Aus derselben Zeit stammt aber auch eine Gruppe von acht Werken, in denen ein ganz anderer Weg gesucht wird. Die Zusammengehörigkeit dieser Gruppe, die wohl an den Hof der Isabella d’Este gehört, wird wenigstens in Teilen der Überlieferung nahegelegt, und trotz der gewissen Unsicherheiten um die Zuschreibungen kommt dem Beitrag von Josquin dabei eine besondere Rolle zu. Im Mittelpunkt steht ein Ausschnitt aus der Klage der verlassenen Dido (Dulces exuviae) aus dem vierten Buch der Metamorphosen des Ovid (IV, 651–654). Es ist ein Schlüsselmoment der Episode, denn es geht um Didos Entschluss zum Selbstmord.25 Josquins Vertonung ist außergewöhnlich, es handelt sich um eine cantus-firmus-lose vierstimmige Komposition, die formal, satztechnisch und tonal experimentell wirkt – allerdings ohne den normativen Rahmen des vierstimmigen polyphonen Satzes infrage zu stellen, im Gegenteil. Der Satz unterscheidet sich nicht von dem einer Motette.26
Das musikalische Verhältnis zur antiken Vorlage, das hier gesucht wird, ist also gerade nicht das einer strukturellen Anpassung – wie es die Tritonius-Oden auszeichnet. Im Gegenteil, auf den ersten Blick wirkt es sogar so, dass im musikalischen Satz jeglicher Bezug zur Antike vorsätzlich gemieden wird. Auch in diesem Fall steht folglich, wie bei den groß besetzten Liedern, kein nachahmendes, sondern ein distantes Verhältnis zum Text im Vordergrund, offenbar allerdings in einem abweichenden Begründungszusammenhang. Es geht, anders als in den Liedern, nicht um musikalisch-poetische Evidenz durch die Erzeugung eines ästhetischen Eigenwertes, sondern um die musikalische ›Beschreibung‹ eines antiken Textes. In einem solchen Verfahren wird der historische Abstand also gerade nicht aufgehoben, sondern willentlich betont. Die Klage der Dido wird mit jenen kompositorischen Mitteln dargestellt, welche die Zeit um 1500 bereithielt, sie wird ›beschrieben‹.
In der antiken Rhetorik wurde eine solche Beschreibung als ›ekphrasis‹ oder ›descriptio‹ bezeichnet. Damit sollten v. a. abwesende Bildwerke anschaulich vermittelt werden, der Zuhörer sollte sich folglich in einen Zuschauer verwandeln. In der Kunsttheorie des 15. Jahrhunderts wurde die ›ekphrasis‹ zu einem wichtigen Moment, um gewissermaßen ästhetische Präsenz erst erzeugen und vermitteln zu können.27 Durch das Verfahren in Dulces exuviae partizipiert damit auch die Musik an der Möglichkeit zu einer solchen Präsenz, aber auf eine unerwartete Weise. Ein Vergleich mag das veranschaulichen: Um 1495 malte Sandro Botticelli seine Verleumdung des Apelles, eine komplexe Auseinandersetzung mit dem Problem, dessen erste Schicht die Übertragung einer Beschreibung Lukians in die optische Wirklichkeit um 1500 bildete.28 Josquins Musikalisierung eines antiken Textes steht einer solchen Engführung nahe. Im Gemälde Botticellis wird die antike Beschreibung mit den visuellen Mitteln der Gegenwart erfahrbar gemacht, in Dulces exuviae sind es die kompositorischen Mittel. In beiden Fällen verschwimmen die Grenzen, nämlich in der Frage, was denn nun eigentlich der ›Gegenstand‹ und was seine ›Beschreibung‹ ist. Jedoch ›verschwindet‹ bei Botticelli der Text, auf den sich der Maler bezieht, während er durch Josquins Komposition erst wirklich zur Geltung kommen soll. Es geht eben nicht um einen Text, der selbst ›ekphrasis‹ ist, sondern um einen, der die Auffassung auslöst, Musik könne ›ekphrasis‹ sein.
Josquins ›ekphrasis‹ richtet sich auf das Verhältnis zur Antike, um sie mit den Mitteln der Gegenwart erfahrbar zu machen. Anders als in den Oden geht es nicht um eine bloße Nachahmung oder Wiederentdeckung, sondern, hierin Botticelli (und anderen) wenigstens vergleichbar, um eine Klärung im Sinne eines ästhetischen Eigenwertes. Die Musik der Gegenwart vermag damit auf eine Weise zu wirken, die derjenigen der Antike nicht nur vergleichbar, sondern ihr wohl auch überlegen ist. Gerade eine solche grundsätzliche Klärung verstärkt den Charakter des Experiments, denn sie richtet sich auf das Außergewöhnliche, auf einen Ausnahmezustand gewissermaßen. Daraus erklärt sich die Textwahl, gebunden an die affektive Extremsituation der zum Suizid entschlossenen Dido. Akzeptiert man diese Deutung, handelt es sich bei einer solchen Ovid-Vertonung zwar um einen isolierten Einzelfall, aber mit dem Anspruch einer paradigmatischen Klärung. Dies könnte dann auch erklären, warum daraus, wiederum im Gegensatz zu den Oden, kein funktionierender Gattungszusammenhang (etwa vierstimmiger Sätze über antike Texte) erwachsen sollte. Die vollkommen neue Art, über das musikalische Verhältnis zur Antike nachzudenken, sollte dennoch Konsequenzen haben für das Verständnis aller Musik.29