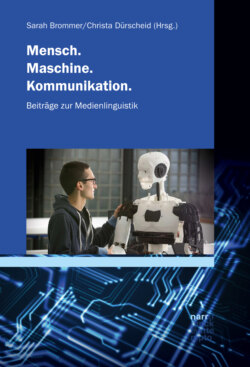Читать книгу Mensch. Maschine. Kommunikation. - Группа авторов - Страница 10
1 Einleitung
ОглавлениеDie internetbasierte Kommunikation ist ein beliebter Untersuchungsgegenstand der Medienlinguistik, und dies nicht zuletzt deswegen, weil das Feld sehr produktiv ist und sich stetig wandelt. Entsprechend löst die sprachwissenschaftliche Forschung dazu nicht nur Konsens im fachwissenschaftlichen Diskurs aus. So weist beispielsweise Androutsopoulos (2010: 425) darauf hin, dass es falsch sei, in linguistischen Untersuchungen «technisch-mediale[n]» Kontextaspekten gegenüber «sozialen» den Vorrang zu geben – wie dies seiner Meinung nach allzu häufig getan wird. Demgegenüber stellt er die Forderung auf, dass sprachanalytische Zugänge zur Internetkommunikation sowohl die technischenTechnik als auch die soziokulturellen Umstände und die entsprechende Verwobenheit zu berücksichtigen haben (vgl. ebd.: 419). Ziel des vorliegenden Beitrags ist, das Verhältnis zwischen den technischen Gegebenheiten (den ‹Affordanzen›) und dem tatsächlichen (empirisch belegbaren) kommunikativen Verhalten kritisch zu reflektieren. Dazu werden die zwei Messaging-Dienste WhatsAppWhatsApp und iMessageiMessage sowie die Kommunikationsform E-MailE-MailE-Mail1 auf zwei Aspekte hin untersucht und miteinander verglichen: den ‹Grad an SynchronizitätKommunikationsynchrone› und die ‹Verfügbarkeit semiotischer Ressourcen›. Ersteres bezieht sich auf die Frage, in welcher Geschwindigkeit Konversationen ablaufen (können), Letzteres auf die unterschiedlichen multimedialen und multimodalenMultimodalität Möglichkeiten der Textgestaltung.
Die hier vorgenommene Auswahl (WhatsAppWhatsApp, iMessageiMessage und E-MailE-Mail) ist nicht zufällig: Betrachtet man die Literatur der letzten zehn Jahre, so lässt sich feststellen, dass sich medienlinguistische Untersuchungen zu nicht-öffentlicher Kommunikation im Internet zu einem auffallend hohen Anteil dem Thema WhatsApp widmen (vgl. z.B. Arens 2014, Dürscheid/Frick 2014, Pappert 2017). Dieser Messenger-Dienst wurde 2009 von Brian Acton und Jan Koum gegründet und erfreut sich bis heute grosser Beliebtheit. So wurden im Jahr 2020 weltweit 2 Milliarden monatliche NutzerNutzer*in*innen gemessen (vgl. statista.com). Dafür gibt es vermutlich zwei ausschlaggebende Gründe: Erstens vereint WhatsApp die Mobilität der SMS und die quasi-synchrone KommunikationKommunikationquasi-synchrone, wobei die Dienstleistungen den Nutzenden kostenlos zur Verfügung gestellt werden (vgl. Arens 2014: 82). Zweitens ist es irrelevant, ob die Nutzer*innen iOS, Androidandroid oder ein anderes Betriebssystem verwenden, jede*r Smartphonebesitzer*in kann es nutzen. Diese Beliebtheit und die weite Verbreitung der AppApp führten dazu, dass die Kommunikation über WhatsApp zu der zu untersuchenden Kommunikationsform in linguistischen Arbeiten wurde. Mit anderen Worten: Allein schon die Tatsache, dass WhatsApp so viele aktive User*innen hat, macht den Dienst zum legitimen Ausgangspunkt von Untersuchungen.
iMessageiMessage bietet hinsichtlich der Affordanzen sprachwissenschaftlich sogar noch mehr Untersuchungsfelder als WhatsAppWhatsApp, und trotzdem finden sich kaum linguistische Untersuchungen dazu. Das geht vermutlich mit der geringeren Popularität dieses Dienstes einher. In diesem Beitrag wird deshalb auch der Frage nachgegangen, warum iMessage weniger genutzt wird als WhatsApp, obwohl es technischTechnik mehr Möglichkeiten bietet.
Die E-MailE-Mail-Kommunikation gehört klassischerweise nicht zu den Instant-MessagingInstant-Messanging Kommunikationsformen. Es wird sich allerdings zeigen, dass diese Einordnung der E-Mail als asynchroneKommunikationasynchrone Form der Kommunikation heute überholt ist oder zumindest hinterfragt werden muss. Die E-Mail-Kommunikation hat sich in den vergangenen zehn Jahren stark verändert und ist in spezifischen Kontexten mit WhatsAppWhatsApp und iMessageiMessage durchaus vergleichbar, weswegen sie in der folgenden Untersuchung ebenfalls berücksichtigt wird.
Der vorliegende Beitrag ist thematisch zweigeteilt. Zunächst werden die Termini ‹Synchronie› und ‹semiotische Ressourcen› bzw. ‹Multimedialität› und ‹MultimodalitätMultimodalität› aus medienlinguistischer Sicht reflektiert und auf die drei hier zur Diskussion stehenden Messaging-Dienste angewendet: Welchen Grad an SynchronizitätKommunikationsynchrone erlauben die Dienste? Welche Möglichkeiten der multimedialen bzw. multimodalenMultimodalität Kommunikation werden geboten (und welche nicht)? Der zweite Teil ist empirisch bzw. analytisch ausgerichtet. Anhand von je acht Beispielen aus einer privaten Textsammlung wird untersucht, ob die technischenTechnik Möglichkeiten (so) genutzt werden, wie dies erwartbar wäre. Dazu sei an dieser Stelle bereits angemerkt: Natürlich lässt ein aus 24 Beispielen bestehendes Korpus keine verallgemeinerbaren Aussagen zu, Tendenzen und Trends sind jedoch ablesbar. Zum aktuellen Zeitpunkt stehen leider keine im deutschsprachigen Raum erfasste, umfassende Korpora zur Verfügung, die dem gegenwärtigen technischenTechnik Stand entsprechen würden und die sich auf alle drei hier untersuchten Kommunikationsformen beziehen. Die häufig verwendeten Daten des Dortmunder-Chatkorpus2 beispielsweise wurden in den Jahren 2002 bis 2008 erhoben und sind damit für gegenwartsbezogene Fragestellungen nur bedingt aussagekräftig (vgl. Storrer 2017: 257). Ein SNF-Projekt3 widmete sich dem Erstellen eines SMS-Korpus’. Das Projekt dauerte von 2011 bis 2014 und startete damit kurz bevor die SMS als mobile Kommunikationsform des Alltages deutlich an Relevanz zu verlieren begann. Einzig interessant für die Forschungsinteressen dieses Beitrags ist ein Korpus, das aus WhatsAppWhatsApp-Daten besteht.4 Dieses Korpus war zum Zeitpunkt der Abfassung des vorliegenden Beitrags jedoch noch nicht verfügbar.