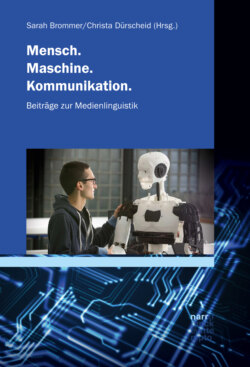Читать книгу Mensch. Maschine. Kommunikation. - Группа авторов - Страница 5
2 Maschinen – Automaten – Roboter
ОглавлениеIn einem Artikel in der Wochenzeitung DIE ZEIT ist zu lesen: «Mit der Vielfalt der Einsatzgebiete wachsen auch die Ansprüche an die Mensch-Maschine-KommunikationMensch-Maschine-Kommunikation. Ein Therapie-RoboterRoboter muss nicht nur andere Aufgaben bewältigen als ein IndustrieIndustrie-RoboterRoboter.»1 Diese Aussage legt die Vermutung nahe, bei den Ausdrücken MaschineMaschine und RoboterRoboter handle es sich um Synonyme. Intuitiv wissen wir, dass das nicht der Fall ist. Doch wo liegen die Unterschiede? Und wie grenzt man diese beiden Bezeichnungen von dem Terminus AutomatAutomat ab? Geht man davon aus, dass eine MaschineMaschine Arbeitsvorgänge in eine Folge wiederholbarer Schritte teilt, dann ist dies durchaus vergleichbar mit dem Einsatz von Automaten. Es stellen sich hier also einige Fragen, die uns dazu bewogen haben, zunächst auf die Spezifika von MaschinenMaschine, Automaten und RoboterRobotern einzugehen. In einem zweiten Schritt werden wir auch auf die Stichworte Künstliche IntelligenzKünstliche Intelligenz und Anthropomorphismusantropomorph Bezug nehmen und auf die Frage eingehen, wie sich der Sprachgebrauch in der Mensch-Maschine- von der Mensch-Mensch-Kommunikation unterscheidet.
Kommen wir zunächst zur Definition von MaschineMaschine: Eine MaschineMaschine (lat. machina, deutsch ‹WerkzeugWerkzeug›, ‹künstliche Vorrichtung›, ‹Mittel›) ist eine mit einem Antriebssystem «ausgestattete oder dafür vorgesehene Gesamtheit miteinander verbundener Teile oder Vorrichtungen, von denen mindestens eines bzw. eine beweglich ist und die für eine bestimmte Anwendung zusammengefügt sind» (vgl. die europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Artikel 2 Abs. a). Mit anderen Worten: Eine MaschineMaschine wird als eigenständige funktionsfähige Einheit dazu eingesetzt, eine bestimmte Tätigkeit auszuführen. Wenn sie diese Tätigkeit automatisch, d.h. selbsttätig, ausführt, spricht man von AutomatAutomat. Im Alltag zeigt sich die Unterscheidung zwischen MaschineMaschine und Automat beispielsweise bei alltäglichen Verrichtungen wie der Zubereitung von Kaffee: Während eine (Filter-)Kaffeemaschine als Werkzeug eingesetzt wird, das zwar bei der Zubereitung unterstützt, aber das händische Einfüllen von Kaffee und Wasser verlangt und auch nur der Herstellung von Filterkaffee dient, bereitet ein Kaffee(voll)automat auf Knopfdruck verschiedene Kaffeespezialitäten selbständig zu. Der Einsatzbereich eines Automaten ist jedoch beschränkt, da er nur eine bestimmte Tätigkeit ausführen kann und nutzlos wird, sollte eben diese Tätigkeit nicht mehr benötigt werden. Das wiederum unterscheidet den Automaten vom RoboterAutomatRoboter:2 Ein RoboterRoboter ist immer wieder programmierbar und dadurch in der Lage, verschiedene Tätigkeiten zu erledigen, und er zeichnet sich im Vergleich zu anderen MaschinenMaschine durch seine Komplexität aus. Seine universelle Einsetzbarkeit findet sich auch in den Richtlinien des Vereins Deutscher Ingenieure, in denen (IndustrieIndustrie-)RoboterRobotik definiert werden als «universell einsetzbare Bewegungsautomaten mit mehreren Achsen, deren Bewegungen hinsichtlich Bewegungsfolge und Wegen bzw. Winkeln frei (d.h. ohne mechanischen bzw. menschlichen Eingriff) programmierbar und gegebenenfalls sensorgeführt sind. Sie sind mit Greifern, WerkzeugenWerkzeug oder anderen Fertigungsmitteln ausrüstbar und können Handhabungs- und/oder Fertigungsaufgaben ausführen» (VDI-Richtlinie 2860). In eine ähnliche Richtung geht die Aussage von Christaller et al. (2001: 19). Die Autoren definieren RoboterRoboter als «sensumotorische MaschinenMaschine zur Erweiterung der menschlichen Handlungsfähigkeit. Sie bestehen aus mechatronischen Komponenten, Sensoren und rechnerbasierten Kontroll- und Steuerungsfunktionen. Die Komplexität eines RobotersRoboter unterscheidet sich deutlich von anderen MaschinenMaschine durch die größere Anzahl von Freiheitsgraden und die Vielfalt und den Umfang seiner Verhaltensformen.» Diese Definition greift den WerkzeugcharakterWerkzeug von RoboternRoboter auf (vgl. auch den begrifflichen Ursprung des Wortes, abgeleitet von tschechisch robota, deutsch ‹Fronarbeit›).AutomatRoboter3 Was hingegen nicht Bestandteil der Definition ist, sind anthropomorpheantropomorph Zuschreibungen, die sehr häufig Teil des Alltagsverständnisses von RoboterRoboter sind (siehe dazu weiter unten).
Die Frage, ob die hier beschriebenen begrifflichen Abgrenzungen auch heute noch Bestand haben, kann an dieser Stelle nicht diskutiert werden. Hingewiesen sei aber auf neuere technischeTechnik Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass es mit dem technischen Fortschritt zu weiteren Überschneidungen kommen wird, die die Abgrenzung von RoboternRoboter und MaschinenMaschine immer schwieriger machen. So wurde Ende 2019 von ABB und B&R, zwei Unternehmen für AutomatisierungstechnikTechnik, eine erste vollständig integrierte Lösung für die Synchronisierung zwischen RobotikRobotik und Maschinensteuerung präsentiert.MaschineTechnikRobotik4 Möglicherweise wird sich diese Annäherung von RoboterRoboter und MaschineMaschine (und AutomatAutomat) künftig im Sprachgebrauch niederschlagen und dafür nur noch ein Terminus im Gebrauch sein; es ist aber auch zu vermuten, dass vor allem zwischen MaschineMaschine und RoboterRoboter weiter sprachlich differenziert werden wird, nämlich um die unterschiedlichen Einsatzbereiche (s.u.) zu berücksichtigen.
Wir selbst verwenden als Oberbegriff das Wort MaschineMaschine, wir sind uns aber bewusst, dass damit andere Assoziationen einhergehen als beim Wort RoboterRoboter. Eine diskurslinguistische Analyse des Sprachgebrauchs wäre in diesem Zusammenhang auf jeden Fall erkenntnisreich. Sie könnte z.B. Aufschluss darüber geben, ob die Bezeichnung MaschineMaschine stärker den WerkzeugcharakterWerkzeug fokussiert und eine emotionale Distanz zum Ausdruck bringt und im Vergleich dazu mit dem Ausdruck RoboterRoboter eine grössere Handlungskompetenz und damit einhergehend auch die Möglichkeit zur InteraktionInteraktion assoziiert wird. Unstrittig ist, dass die Verwendungshäufigkeit von RoboterRoboter in den letzten 30 Jahren kontinuierlich zugenommen und sich in dieser Zeit laut dem DWDS-Zeitungskorpus verdreifacht hat (siehe Abb. 1). Demgegenüber wird der Ausdruck MaschineMaschine zwar aktuell nach wie vor oft gebraucht, aber von 1950 bis zum Anfang der 1990er Jahre ist die Verwendungshäufigkeit um rund 60 Prozent markant gesunken, und seitdem stagniert sie weitgehend. Die folgende Abbildung stellt diese Entwicklung auf anschauliche Weise dar. Hier ist auch zu sehen, dass sich im Hinblick auf die Verwendung des Wortes AutomatAutomat keine Veränderungen abzeichnen.
Abb. 1:
Verwendungshäufigkeiten von RoboterRoboter, MaschineMaschine, AutomatAutomat von 1950 bis heute
Die Zunahme der Verwendungshäufigkeit des Wortes RoboterRoboter ist im Zusammenhang mit der fortschreitenden RobotertechnikTechnik (= RobotikRobotik) zu sehen, die dazu geführt hat, dass es für RoboterRoboter immer mehr industrielleIndustrie und private Einsatzmöglichkeiten gibt, was sich wiederum in stetig wachsenden Verkaufszahlen zeigt. Wie aus dem aktuellen Welt-Roboter-Report der International Federation of Robotics (IFR) hervorgeht, kommen IndustrieroboterRoboter am häufigsten in der AutomobilindustrieIndustrie, der Elektro- und Elektronikindustrie sowie der Metallindustrie und im Maschinenbau zum Einsatz.5 Hier haben sich die Verkaufszahlen in den letzten zehn Jahren mehr als versechsfacht. Das grösste Wachstum ist aber im Bereich der Nutzung von ServiceroboternRoboterService- für den gewerblichen und den persönlichen/häuslichen Gebrauch zu verzeichnen. Laut dem IFR-Welt-Roboter-Report stieg die Anzahl verkaufter ServiceroboterRoboterService- im Vergleich zum Vorjahr um 61 % auf 271000,6 wobei rund ein Viertel davon ServiceroboterRoboterService- für den privaten Einsatz waren. Zu den privat eingesetzten ServiceroboternRoboterService- zählen bspw. solche, die beim Hausputz und der Gartenarbeit helfen; sie erfüllen aber auch andere Aufgaben, wie die folgende exemplarische Übersicht zeigt.7
Abb. 2:
Übersicht über den vielfältigen Einsatz von ServiceroboterRoboterSex-nRoboterPflege-
Wie die Abbildung zeigt, werden (soziale) RoboterRobotersozialer und speziell ServiceroboterRoboterService- mittlerweile auch von Privatpersonen zu verschiedenen Zwecken eingesetzt.Roboter8 Entsprechend unterschiedlich sind die Situationen, in denen es zu einer Kommunikation zwischen Mensch und RoboterRoboter kommt. Doch kann man überhaupt von einer Kommunikation sprechen? Je nachdem, welchen Aufgabenbereich ein RoboterRoboter erfüllt, stellen sich auf kommunikativer Ebene unterschiedlich komplexe Herausforderungen. Während sich die Mensch-Mensch-Kommunikation zwar in Abhängigkeit von der Kommunikationssituation gestaltet, aber prinzipiell offen und grenzenlos verläuft, korreliert die Mensch-Maschine-KommunikationMensch-Maschine-Kommunikation mit dem Einsatzbereich der MaschineMaschine, ist dadurch eingeschränkt und in gewisser Weise auch vorherbestimmt. So ist es bei einer Vielzahl von Servicetätigkeiten ausreichend, dem RoboterRoboterService- seine «Aufgabe mitzuteilen», die dieser dann mittels seiner ProgrammierungProgrammierung und ggf. künstlichen IntelligenzKünstliche Intelligenz (s.u.) erfüllt. In diese Kategorie fallen z.B. ReinigungsroboterRoboter wie SaugroboterRoboter und Saug-Wisch-RoboterRoboter. Die Kommunikation beschränkt sich hier auf vergleichsweise einfache Befehle (vom Menschen zum RoboterRoboter) und Meldungen (vom RoboterRoboter zum Menschen). Demgegenüber liegt es auf der Hand, dass ein RoboterRoboter, der zu Therapiezwecken eingesetzt wird, nicht nur andere Aufgaben als ein ReinigungsroboterRoboter oder ein IndustrieIndustrie-RoboterRoboter bewältigen muss, sondern dass er mit den Menschen in seinem Umfeld auch anders kommunizieren muss. Er (oder sie?) muss zum einen in der Lage sein, individuellen sprachlichen Input zu verarbeiten, und zum anderen, auf diesen Input zu reagieren.Mensch-Maschine-KommunikationRoboter9
Eine andere, aber ähnlich komplexe kommunikative Herausforderung stellt sich bei autonom fahrenden Autosautonom fahrendes Auto. Neben allen rechtlichen und ethischenEthik Aspekten, die in diesem Kontext zu klären sind,10 ergeben sich hier auch kommunikative Fragen. So müssen sich einerseits Fussgänger*innen, Radfahrer*innen und Autofahrer*innen mit dem autonom fahrenden Autoautonom fahrendes Auto abstimmen können, sei es am Zebrastreifen oder an einer gleichberechtigten Kreuzung, d.h. sie müssen ihre Absichten dem Fahrsystem kommunizieren und dieses muss den Input verarbeiten können. Andererseits muss das Auto umgekehrt signalisieren können, dass es autonomautonom fahrendes Auto fährt und die anderen Verkehrsteilnehmer*innen wahrgenommen hat. Auch muss es je nach Situation sogar eine Aktion ankündigen können (z.B. Vorfahrt gewähren).
Nun noch etwas zur Terminologie: Je nachdem, ob der Schwerpunkt auf die InteraktionInteraktion zwischen Mensch und MaschineMaschine oder spezifischer auf die (sprachliche) Kommunikation zwischen Mensch und MaschineMaschine gelegt wird, ist von Mensch-Maschine-InteraktionMensch-Maschine-Interaktion (MMI), im Englischen «human-machine interaction» (HMI), oder von Mensch-Maschine-KommunikationMensch-Maschine-Kommunikation bzw. «human-machine communication» (MMK bzw. HMC) die Rede. Häufig werden die beiden Bezeichnungen auch synonym verwendet. Auf jeden Fall zählen dazu beide Perspektiven, d.h. sowohl die Mitteilungen des Menschen an die MaschineMaschine als auch die der MaschineMaschine an den Menschen. Es geht also um die wechselseitige Verständigung zwischen Mensch und MaschineMaschine. Dies ist der Aspekt, der in unserem Sammelband primär Berücksichtigung findet, daneben wird es aber auch – wie bereits erläutert – um die Mensch-Mensch-Kommunikation mittels MaschineMaschine gehen. In beiden Fällen ist es notwendig, dass der Mensch (in unterschiedlichem Ausmass) der TechnikTechnik und der Kommunikation mit der Technik vertraut. Damit kommen wir zum nächsten Abschnitt, zum Thema VertrauenVertrauen.