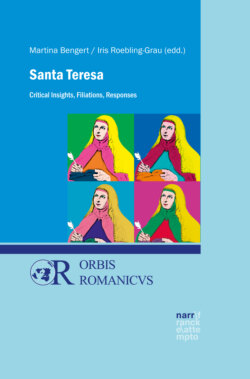Читать книгу Santa Teresa - Группа авторов - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Bekehrungs-Prozess
ОглавлениеDabei wird das „Turmerlebnis“ von 1519 als punktuelles Bekehrungsereignis bzw. als Anfang des Protestantismus und Loslösung von der mittelalterlichen Theologie und Spiritualität entmythologisiert. In seiner Luther-Biographie bringt Leppin es in Zusammenhang mit anderen autobiographischen Berichten Luthers, die den Einfluss seines Beichtvaters Johannes von Staupitz unterstreichen (etwa als dieser 1513 Luther sagte, dass Gott „außerhalb Christi“ nicht erfasst sein will,1 womit das Solus Christus ansetzt, oder ihm 1515 klar machte, dass wahre Buße allein mit der Liebe zur Gerechtigkeit und zu Gott beginne), und kommt zum Schluss, dass es sich um einen schleichenden Bekehrungsprozess handelte, der schon in seiner monastischen Zeit ansetzte und das Zentrum im existentiellen Vorgang der Buße hatte.
Dass bei der autobiographischen Rückblende von 1545 das „Turmerlebnis“ gegenüber der Erfahrung von der wahren Buße für den reformatorischen Durchbruch als entscheidend gesehen wird, hängt für Leppin mit der besonderen Bedeutung zusammen, die die Rechtfertigungslehre unterdessen gewonnen hatte. Denn solche Bekehrungsberichte gehören zu der von Augustins Confessiones geprägten Gattung und darin werde die Vergangenheit immer unter der Perspektive der Begründung der eigenen Gegenwart dargestellt:2
Ich war von einer wundersamen Leidenschaft gepackt worden, Paulus in seinem Römerbrief kennenzulernen, aber bis dahin hatte mir nicht die Kälte meines Herzens, sondern ein einziges Wort im Wege gestanden, das im ersten Kapitel steht: ‚Die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm [d.h. im Evangelium] offenbart‘ (Röm 1,17). Ich hasste nämlich dieses Wort ‚Gerechtigkeit Gottes‘, das ich nach dem allgemeinen Wortgebrauch aller Doktoren philosophisch als die sogenannte formale oder aktive Gerechtigkeit zu verstehen gelernt hatte, mit der Gott gerecht ist, nach der er Sünder und Ungerechte straft […]. Endlich achtete ich in Tag und Nacht währendem Nachsinnen durch Gottes Erbarmen auf die Verbindung der Worte, nämlich: ‚Die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm offenbart‘, wie geschrieben steht: Der Gerechte lebt aus dem Glauben‘ (Hab 2,4). Da habe ich angefangen, die Gerechtigkeit Gottes als die zu begreifen, durch die der Gerechte als durch Gottes Geschenk lebt, nämlich aus Glauben: ich begriff, dass dies der Sinn ist: Offenbart wird durch das Evangelium die Gerechtigkeit Gottes, nämlich die passive, durch die uns Gott, der Barmherzige, durch den Glauben rechtfertigt […]. Da zeigte sich mir sogleich die ganze Schrift von einer anderen Seite.3
Wenn man primär auf die Sprache achtet, ist es verständlich, dass Erwin Iserloh von einer großen Kontinuität der Mystik Luthers von der Theologia Deutsch (1515) bis zu den letzten Schriften spricht.4 Luther kennt und benutzt u.a. die mystischen Theologoumena vom „fröhlichen Tausch“, von der „theosis“ und der Idiomenkommunikation.5 Fragt man, worin die Transformationen mittelalterlicher Mystik liegen, die Luther in diesem Prozess vorgenommen hat, so kann man mit Leppin auf drei hinweisen: (1) Das Verhältnis von Gesetz und Evangelium wird so verstanden, dass Gott eindeutiger als bei den Mystikern des Mittelalters „der Handelnde im gesamten Heilsprozess“ ist; damit zusammenhängend betont Luther stärker als sie den worttheologischen Zusammenhang und somit auch das „Extra nos“ des mystischen Prozesses.6 (2) Die Rechtfertigungslehre ist bei aller Nähe zur Immediatisierung des Gottesverhältnisses in der mystischen Literatur neu, sofern die unio mystica nun deutlich dem Glauben entspringt und nicht einer affektiven Liebesfunktion.7 (3) Schließlich gehört zu diesen Transformationen auch die Lehre vom allgemeinen Priestertum: Während dies etwa in den Predigten Taulers als Möglichkeit für mystisch lebende oder „inwendige“ Menschen anklingt, wird es nun von Luther demokratisiert, d.h. auf jeden bezogen, „der aus der Taufe gekrochen ist“8 – was bekanntlich zum Systemumbruch in der Sozialgestalt des Christentums führte.