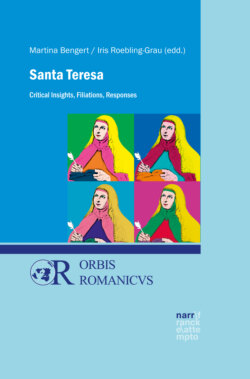Читать книгу Santa Teresa - Группа авторов - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Abschließende Überlegungen
ОглавлениеIn den Augen Teresas wäre Luther ein letrado oder studierter Theologe gewesen, während Luther sie – wie viele Theologen und Kirchenfürsten ihrer Zeit – als eine ‚Einfältige‘ betrachtet hätte bzw. als nur eine Frau, ohne jegliche Autorität in geistlichen Dingen. Es ist nicht so, dass Luther verglichen mit den spanischen Theologen der Zeit in seiner Haltung gegenüber den Frauen besonders schlecht dastünde. Aber selbst wenn wir von seinen polternden Sprüchen in den Tischreden absehen, muss man feststellen, dass seine Sicht der Frau als Ehefrau und als Christin eher konventionell war. Die Frau sei von Gott dazu geschaffen, „Kinder zu gebären, die Männer zu erfreuen, barmherzig zu sein“.1 Seine Frau Katharina bezeichnet er nicht ohne Ironie „als eine kluge Frau und Doktorin“ bzw. als „sehr beredt“, dass sie ihn fast übertreffe. Aber im selben Augenblick fügt er hinzu: „Aber die Beredsamkeit bei Frauen ist nicht zu loben. Für sie ziemte es sich vielmehr, nur zu stammeln und zu lallen; das stünde ihnen wohl besser an“.2 Dies entspricht dem biblischen Befund – etwa nach den berühmten Stellen des Apostels Paulus in 1 Kor 14,33–34 und 1 Tim 2,11–15.
Auch im Umgang mit Luther hätte sich Teresa in der Kunst der Verstellung in frommer Absicht üben müssen, um ihre Bildung und ihre spirituelle Erfahrung zu verstecken. Und sie hätte im Gebet Zuflucht zum Herrn gesucht, von dem sie 1571 diese tröstliche Botschaft vernahm, als sie mit Bezug auf den Apostel Paulus von Klerus und Theologen immer wieder in die Schranken gewiesen wurde: „Sag ihnen, dass sie nicht nur auf einem Text der Schrift herumreiten, sondern auch andere anschauen sollen, und ob sie mir denn die Hände binden könnten“ (CC 16).
Eine weitere Unterscheidung, die mit dem Phänotyp, d.h. mit dem Stand als Mann oder Frau, Theologe oder Laie in Kirche und Gesellschaft zusammenhängt, ist der Umgang mit der Schrift. Diese bleibt ‚der‘ Interpretationsbezug der mystischen Erfahrung, die primär immer Glaubensmystik ist, Antwort auf das „Hören des Wortes“, auch wenn sie sich als Liebesmystik kleidet. Als Theologe und Bibelwissenschaftler konnte Luther dabei aus dem Vollen schöpfen. Bei Teresa ist erstaunlich genug, dass sie so klug und treffend mit Schriftzitaten umgeht, obwohl ihr die Bibellektüre verwehrt und sie auf die liturgische Predigt und das geistliche Gespräch mit ihren Beichtvätern angewiesen war. Sie bedauert, dass sie nicht theologisch gebildet ist, um die Bibel besser zitieren zu können (7 M 3,13). Ihre Erfahrung des Herrn als „lebendiges Buch“ kam ihr dabei zur Hilfe und ist ein typisch weiblicher Zugang zur Schrift in der Frauenmystik dieser Zeit. Es erinnert uns zugleich daran, dass Gottes Wort nicht „Schrift“ geworden ist, sondern Fleisch/Mensch in Jesus Christus – und er teilt es den Seinen selbst unmittelbar mit, wenn die sozial verfasste Kirche den freien Zugang zur Schrift verwehrt, wie dies im katholischen Spanien zur Zeit Teresas der Fall war.
Zum Phänotyp gehört auch die Sprache, wie wir nun anhand der Brautmystik bei Luther und Teresa näher beleuchten möchten.
Anklänge auf die „Brautmystik“ fehlen bei Luther nicht, sind aber immer in die oben genannte Glaubensmystik eingebettet, am eindrucksvollsten etwa in der Schrift Von der Freiheit eines Christenmenschen (1520). Vom inwendigen geistlichen Menschen heißt es hier, dass kein äußerliches Ding ihn frei und fromm zu machen vermag. Eine solche Seele könne alle Dinge entbehren, „ausgenommen das Wort Gottes […] Wo sie aber das Wort Gottes hat, so bedarf sie auch keines anderen Dinges mehr, sondern sie hat in dem Wort Gottes Genüge: Speise, Freude, Friede, Licht, Wissen, Gerechtigkeit, Wahrheit, Weisheit, Freiheit und alles Gut überschwenglich“.3 Der Glaube bewirke nicht nur, „dass die Seele dem göttlichen Wort gleich wird“, „sondern es vereinigt auch die Seele mit Christus“, und zwar durch einen fröhlichen Tausch, der an den Sermon von der Betrachtung des heiligen Leidens Christi erinnert.4 Bereits in der Vorlesung über den Hebräerbrief (1517–1518) bezeichnet Luther die Bindung des Glaubens an das Wort als „geradezu eine Verlobung“ und verweist dabei auf die klassische Belegstelle der unio mystica in 1 Kor 6,17: „Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm.“5 Gegen Ende seines Lebens rekurriert Luther erneut auf die Brautmystik, um den Glaubensvollzug mit der mystischen Liebesvereinigung zu vergleichen:
Der Glaube ist eine experimentale Erkenntnis und findet Ausdruck in dem Wörtchen: ‚Adam erkannte sein Weib‘, d.h. in der Erfahrung (sensu) erkannte er sie als sein Weib, nicht spekulativ und historisch, sondern experimentaliter. Der historische Glaube sagt zwar auch: Ich glaube, dass Christus gelitten hat, und zwar auch für mich, aber er fügt nicht diese sensitive und experimentelle Erkenntnis hinzu. Der wahre Glaube aber statuiert dieses: ‚Mein Geliebter ist mein, und ich ergreife ihn mit Freude.‘6
Ebenso ist in der späten Schaffensphase davon die Rede, dass zwischen Braut und Bräutigam kein „Zwischending“ sein soll.7 Aber bei aller Sprachmächtigkeit bleibt Luther in der Beschreibung der Brautmystik sehr konventionell, quasi im Rahmen eines theologischen Sprachspiels. Er schöpft nicht den allegorischen Reichtum des Hohelieds aus, verwendet wenige Metaphern für die unio mystica, und wo er das tut, wie in der Freiheitsschrift, übernimmt er Bilder aus der mystischen Tradition: Wenn allein das Wort und der Glaube in der Seele regieren, so wird die Seele „gleich wie das Eisen aus der Vereinigung mit dem Feuer glutrot wie das Feuer“.8
Teresa versteht Christus als Bräutigam der Seele, die unio mystica als geistliche Verlobung und Vermählung. Die Sprachbilder, die sie dafür verwendet, sind einerseits der Bibel und der mystischen Tradition entlehnt, andererseits auch sehr originell und der alltäglichen Beobachtung ihres Erfahrungsraumes entnommen. Sie erlebt den Transformationsprozess, die conformatio in Christo wie eine Liebesgeschichte, in der Gott der Handelnde ist, und ringt um Worte, um dies verständlich zu machen. Der Bräutigam richtet in der Seele so viel an, „dass sie vor Sehnsucht geradezu vergeht und nicht weiß, worum sie bitten soll, da es ihr klar zu sein scheint, dass ihr Gott bei ihr ist. Nun werdet ihr mir sagen: Wenn sie das also erkennt, wonach sehnt sie sich dann oder was tut ihr dann noch weh? Was möchte sie noch Besseres? Ich weiß es nicht; ich weiß nur, dass dieser Schmerz ihr bis in die Eingeweide vorzudringen scheint und sich – sobald derjenige, der sie verwundet – den Pfeil aus ihnen herauszieht – tatsächlich so anfühlt, als würde er sie mit sich herausreißen, entsprechend dem Liebesschmerz, den sie empfindet. Ich habe gerade gedacht, ob vielleicht vom Feuer des glühenden Kohlenbeckens, das mein Gott ist, ein Funke übersprungen sei und die Seele derart getroffen habe, dass sie diese Feuersglut zu spüren bekam. Und da es noch nicht ausreichte, um sie zu verbrennen, das Feuer aber so beseligend ist, bleibt dieser Schmerz in ihr zurück und richtet in ihr all das an, sobald es sie berührt. Das ist, glaube ich, der beste Vergleich, mit dem es mir gelungen ist, es auszudrücken“. Und dennoch bleibt es wieder ein vorläufiger, unzulänglicher Vergleich für das Erfahrene. Aber Teresa bleibt die Gewissheit, dass dieses Feuer vom Seelengrund ausgeht, „wo der Herr weilt, und der zieht nicht mehr aus“ (6M 2,5). Teresa spricht vom „Sakrament der Ehe“ als Sinnbild für die geistliche Verlobung, weil sie, „auch wenn es ein plumper Vergleich sein mag“ (5M 4,3), keinen besseren findet – bevor sie in der siebten Wohnung zwischen Verlobung und Vermählung unterscheidet und auf andere Metaphern zurückgreift. Das Einswerden im Zustand der Verlobung ist es, „wie wenn zwei Wachskerzen so nahe zusammengebracht würden, dass es ein einziges Licht wäre, oder wie wenn der Docht, das Licht und das Wachs zu einem verschmolzen wären. Nachher aber kann man die eine Kerze wieder leicht von der anderen lösen, und es sind wieder zwei Kerzen, und so auch mit dem Docht und dem Wachs“ (7M 2,4). Für die geistliche Vermählung benutzt sie aber ein anderes Bild: „Hier ist es aber, wie wenn Wasser vom Himmel in einen Fluss oder eine Quelle fällt, wo alles zu einem Wasser wird, so dass man es nicht wieder aufteilen oder voneinander trennen kann, was nun Flusswasser ist oder vom Himmel fiel; oder wie wenn ein Raum zwei Fenster hätte, durch die ein starkes Licht einfällt, auch wenn es getrennt einfällt, wird doch alles zu einem Licht“ (7M 2,4). Diese Metaphern klingen nach ‚Verschmelzung‘, nach Aufhebung des immer bleibenden Unterschiedes zwischen Gott und Mensch, sind aber nicht so gemeint. Denn Teresa verweist anschließend auf die klassische biblische Stelle in der Brautmystik, die auch von Luther zitiert wird: „Vielleicht ist es das, was der heilige Paulus sagt: ‚Wer sich an Gott festmacht und sich ihm nähert, wird ein Geist mit ihm‘ (1 Kor 6,7)“. Bei Teresa finden wir also für die Gotteinung eine Fülle von oft originellen Metaphern, die sie aus der Alltagserfahrung und ihren spirituellen Lektüren nimmt: nicht nur die des Feuers und der Ehe, sondern etwa auch die der Wachskerzen, der Verbindung des Wassers vom Himmel/Fluss und Meer oder der Sonnenstrahlen in einem Raum.
Mit ihrer spirituellen Sprache und Metaphorik prägte Teresa nachhaltig die geistliche Literatur des 17 Jahrhunderts.9 Als schreibende Frau wurde sie zudem für andere Frauen zum Vorbild. Sie schrieben Autobiographien im Stil Teresas10 oder beriefen sich auf ihre Autorität, um über geistliche Dinge reden und schreiben zu können, wie dies etwa Sor Juana Inés de la Cruz Ende des 17. Jahrhunderts in Mexiko reklamiert. Als 1690/91 der Bischof von Puebla das Recht und die Fähigkeit der Frauen dazu bezweifelt, da gemäß dem Pauluswort die Frauen nicht lehren dürfen und im Stillen lernen sollten, hebt Sor Juana Inés de la Cruz u.a. auch das Lehrbeispiel Teresas hervor: „[…] ich wünschte, diese Interpreten und Exegeten des heiligen Paulus würden mir erklären, wie sie dies verstehen: ‚Lasset die Frauen schweigen in der Gemeinde‘ [1 Kor 14,34]. Entweder verstehen sie darunter konkret Kanzel und Pult oder allgemein die Kirche als Gesamtheit der Gläubigen. Wenn sie das erstere meinen […] – warum tadeln sie dann diejenigen, die privat Studien betreiben? Wenn sie das Verbot des Apostels im übertragenen Sinne verstehen, daß es den Frauen nämlich nicht einmal erlaubt ist, privat zu schreiben oder zu studieren – wieso hat dann die Kirche einer Gertrude, einer Teresa, einer Brigida, der Klosterfrau von Agreda und vielen anderen erlaubt zu schreiben?“11