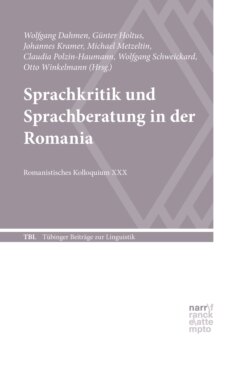Читать книгу Sprachkritik und Sprachberatung in der Romania - Группа авторов - Страница 9
3 Kritik
ОглавлениеWas ist nun von diesem Pamphlet im Ganzen zu halten? Jacques Olivier Grandjouan ist durchaus ein Linguist und verfügt über exzellente sprachhistorische Kenntnisse. Er zitiert Du Bellay, dessen Vorliebe für Wortneubildungen er teilt. Seine Glossen erinnern an den Stil Malherbes, ein fingierter Dialog mit einem Puristen gemahnt ebenfalls an prominente Vorbilder in der Sprachgeschichte. Die linguistischen Analysen des Vf. sind in der Sache stets nachvollziehbar. Dennoch wählt er für sein Buch den Essai-Stil und rechnet sich selbst nicht der Gruppe der Sprachwissenschaftler zu, wodurch der Text in der Mitte zwischen Laienlinguistik und wissenschaftlicher Prosa anzusiedeln ist. Der Vf. argumentiert aus seinem untrüglichen Sprachgefühl heraus – was er übrigens den Puristen vorwirft – und verzichtet auf sprachhistorische Nachweise seiner Monita. Mal verwendet er phonetische Transkriptionen, mal nicht. Mal verwendet er konventionelle linguistische Termini, dann bezeichnet er Verbalabstrakta als maçdar (78 u.ö.), also mit einem Terminus aus der arabischen Grammatik. Der Vf. beherrscht zahlreiche Fremdsprachen, darunter Arabisch und exotische Sprachen, und scheint eine enorme Übersetzungspraxis zu besitzen. Zweifellos kennt er alle Finessen des genuin französischen Wortschatzes. Auffällig ist, dass der Vf. an mehreren Stellen die Beeinträchtigung der Normaussprache durch phonetische Merkmale des Midi kritisiert. Sein Familienname Grandjouan deutet hingegen darauf hin, dass er selbst aus Südfrankreich stammt. Es handelt sich hierbei um eine Art linguistischer Selbstgeißelung, die man ansonsten vor allem aus Belgien kennt.
Was kann man dem Vf. vorwerfen? Er ist zweifellos ein besserer Beobachter des Sprachgebrauchs als ein Entwickler konstruktiver Ideen zur Verbesserung des Ist-Zustandes des Französischen, die ihm vorschwebt. Die ihm eigene Metaphorik macht die Lektüre oft amüsant, doch die zentrale, das ganze Buch durchziehende Metapher der Sprache als kranker Organismus ist weder neu noch originell,4 ebensowenig der Rückgriff auf das Konzept des génie de la langue française. Die dem Vf. vorschwebende Instanz eines nationalen Sprachschiedsrichters erinnert stark an ihn selbst: „… un philologue compétant auquel la langue du temps sera aussi familière que la langue d’autrefois. J’aimerais penser qu’il saura aussi une ou deux langues étrangères et qu’il sera un peu linguiste“ (298). Was bleibt, ist die brillante Analyse der Sprache der französischen Presse und Publizistik. Der Linguist André Haudricourt lobte das Buch in seiner Kurzanzeige als eine der besten Einführungen in die Sozio- und Ethnolinguistik, was der Vf. gar nicht angestrebt hatte. Vielmehr handelt es sich um eine auch heute noch über weite Strecken äußerst lesenswerte Abhandlung über französische Stilistik: Dem Leser wird zum einen der Ist-Zustand der französischen Mediensprache bewusst gemacht, zum anderen erhält er Fingerzeige auf nachzuahmenden und zu vermeidenden Sprachgebrauch. Dass etwa Doppeldeutigkeiten (équivoques), falsch gebrauchte Phraseologismen, unnötige locutions verbales und vermeintliche Synonyme5 auch die französische Mediensprache von heute kennzeichnen, wird niemand in Abrede stellen.