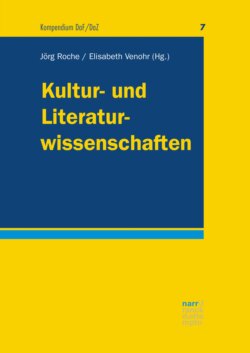Читать книгу Kultur- und Literaturwissenschaften - Группа авторов - Страница 37
2.1.4 TranskulturalitätTranskulturalität und kulturelle FigurationFiguration
ОглавлениеMit dem Konzept TranskulturalitätTranskulturalität soll der Prozesscharakter der Begegnung von Kulturen von der Binarität und Statik multi- und interkultureller Konzepte abgelöst werden. Offenheit, Flexibilität und Dynamik sind die entscheidenden Merkmale des begonnenen Paradigmenwechsels.
Das viel zitierte Transkulturkonzept von Welsch (2005), das diesen Paradigmenwechsel markieren soll, ist in neuerer Zeit selbst stärker in die Kritik geraten, weil sich hinter den Begriffen der transkulturellen Identitätsbildung und der transkulturellen Identitätsmuster der Begriff der Kultur als Einzelkultur verberge (Merz-Benz 2007: 200f).
Den konzeptuellen Widerspruch, TranskulturalitätTranskulturalität als Zustand abzubilden (etwa in „transkulturelle Gesellschaft“) und nicht als kontinuierlichen Prozess zu verstehen, kann das etablierte Transkulturkonzept in der Tat nicht auflösen. Ein erreichter transkultureller Zustand kann konsequenterweise nur ein kurzzeitiges Ergebnis sein, das zum Ausgangspunkt für weitere Prozesse der transkulturellen Entwicklung werden muss, wenn es nicht im Sinne von Merz-Benz (2007) zu einer Einzelkultur erstarren soll. Die darin implizierte Statik des Kulturbegriffs vermeidet der von Ortiz (1995 [1947]) eingeführte Begriff Transkulturation, indem er den Prozesscharakter der Kulturentwicklung und -konstruktion betont. Transkulturation wird damit als Konstruktion und Aushandlung individueller Bedeutungen von Kulturen verstanden. Mit Onuki und Pekar können Kulturen somit als Figurationen und Defigurationen von sich prozessual konstituierenden (figurierenden) Einheiten verstanden werden, die sich zugleich in einer ständigen Veränderungsbewegung befinden. Veränderbarkeit und Dynamik sprengen die Grenzen gängiger, auch transkultureller Kulturkonzepte (Onuki & Pekar 2006a).
Und weil sich zum anderen, in Hinsicht auf unsere eigene kulturelle ‚Verortung‘ (oder auch ‚Ortlosigkeit‘), jede spezifische Kultur selbst als eine ‚Figuration‘ begreifen lässt, d.h. als eine prozessual sich konstituierende Einheit, die sich jedoch in einer ständigen Veränderungsbewegung befindet. Die Rede von ‚Figuration‘ (kultureller Figuration) soll darauf aufmerksam machen, daß sich jede Kultur in einem permanenten und unaufhebbaren Spannungsfeld von De- und Refiguration befindet. Dieser besondere zeitlich-dynamische Aspekt unterscheidet im übrigen ‚Figuration‘ am klarsten von Begriffen wie Struktur, Gestalt, Form etc. (Onuki & Pekar 2006a: 9)
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass ein radikal konstruktivistisches Modell der Subjektkonstitution, wie es gerne zur Begründung eines autonomen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Handelns herangezogen wird, im Konflikt mit dem ebenfalls angestrebten gesellschaftlichen Ziel Transkulturalität steht, weil das Selbst in diesem Modell als abgeschlossenes, auf sich selbst bezogenes (selbstreferenzielles) Subjekt verstanden werden müsste. Bei dieser Subjektorientierung könnte Verstehen nur durch Rekurrenz auf das Eigene erklärt werden. Es entstünde eine pluralistisch-relationale Einstellung, die nur eine reduzierte Auseinandersetzung mit der Außenwelt ermöglichen würde und damit der Transkulturation abträglich wäre.
Kultur ist kein autopoietisches System, das in ausschließlicher Selbstbezüglichkeit die eigenen Elemente selbst produziert und in diesem Prozessieren die konstitutive System / Umweltgrenze affirmiert und perpetuiert, sondern ein prozessuales Produkt der Interaktion von Systemen, deren Grenzen freilich erst in diesem Austauschvorgang gezogen und beständig revidiert werden. (Lösch 2005: 33)
Die Austauschvorgänge der Transkulturation erfordern ein dynamisches Subjekt, das sich (im Sinne des sozial-interaktionistischen Konstruktivismus) im Wechselspiel mit der Umwelt weiterentwickelt.
Kultur ist demzufolge als die denotative Bedeutungsebene von sozialer und sprachlicher Interaktion zu definieren. Sozialisations-, Akkulturations-, und Integrationsprozesse sowie letztlich auch Individuationsprozesse im Sinne soziokultureller Selbstwahrnehmung beruhen auf der Viabilisierung konnotativer Bedeutungen in gesellschaftlichen Kontexten. (Wendt 2002: 42)
Die Bereitstellung denotativen Wissens alleine, zum Beispiel durch die Kontrastierung von Bekanntem und Neuem kann diesen Austausch nicht ersetzen, weil sie den Selbstbezug nicht durchbricht. Wie aber kann das Wechselspiel mit dem Neuen beziehungsweise Fremden in der Umwelt aussehen, wenn die Präsentation denotativen Wissens nicht genügt?