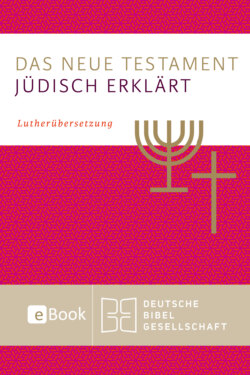Читать книгу Das Neue Testament - jüdisch erklärt - Группа авторов - Страница 79
Redaktionsgeschichte
ОглавлениеIn das späte 1. Jahrundert gehört der Text des Johannesevangeliums, der in den meisten vollständigen Handschriften des Neuen Testaments wie dem Sinaiticus, dem Alexandrinus oder dem Vaticanus gefunden wird. Dieser Text war jedoch das Ergebnis einer langen und komplizierten Entstehungsgeschichte. Wahrscheinlich zirkulierten vor der endgültigen Abfassung für mehrere Jahrzehnte frühere Versionen des Evangeliums. Auf einen solchen längeren Abfassungsprozess deuten Widersprüche innerhalb der Komposition und unpassende Übergänge zwischen einzelnen Abschnitten hin. So spielt beispielsweise die Heilung eines Gelähmten in Joh 5 in Jerusalem, während Joh 6,1 Jesus ganz abrupt „ans andre Ufer des Galiläischen Meeres“ versetzt. Ebenso überraschend ist Joh 14,31, wo Jesus seine Jünger zunächst auffordert: „Steht auf und lasst uns von hier weggehen“, dann jedoch weiterspricht, ohne dass es in den nächsten drei Kapiteln einen einzigen Hinweis auf irgendwelche Ortswechsel gibt.
Es ist möglich, dass das Johannesevangelium in seiner endgültigen Version eine ältere Quelle verarbeitet hat, die die „Zeichen“ (gr. semeia) Jesu auflistete. Die Annahme einer solchen „Semeia-Quelle“ basiert auf der Tatsache, dass die Komposition des Evangeliums durch mehrere „Zeichenerzählungen“ gegliedert ist: Die beiden ersten dieser Zeichen, die Verwandlung von Wasser in Wein auf der Hochzeit zu Kana (Joh 2,1–11) und die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten werden durchnummeriert. Die abschließende Zweckangabe des Evangeliums (Joh 20,30–31) verweist auf „viele andere Zeichen …, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, …“ Jedoch bestätigen keine weiteren Belege diese Angabe.
Die Authentizität zweier Perikopen des Evangeliums wird seit langem bezweifelt: Die erste ist die Erzählung von der Ehebrecherin (Joh 7,53–8,13), da sie in einigen sehr alten Handschriften fehlt; in anderen neutestamentlichen Textzeugen erscheint sie dagegen im Anschluss an Lk 21,38 (wo sie erzählerisch besser hinpasst). Der Handschriftenbefund legt nahe, dass diese Erzählung ursprünglich unabhängig tradiert wurde und später an verschiedenen Stellen Eingang in das Neue Testament gefunden hat.
Auch die Echtheit von Joh 21 wird angezweifelt. Die eigentliche Erzählung des Johannesevangeliums scheint mit Joh 20,30–31 zu schließen, Joh 21 trägt Züge eines Epilogs. Sowohl aus inhaltlichen als auch aus stilistischen Gründen nehmen einige Fachleute an, dass dieses Kapitel später von jemand anderem als dem Autor bzw. den Autoren des restlichen Evangeliums verfasst und hinzugefügt wurde. Die überlieferten Textzeugen enthalten Joh 21 zwar, aber angesichts der Tatsache, dass die älteste einschlägige Handschrift P66 nicht in die Zeit vor 200 zu datieren ist, lässt sich nicht sagen, ob eine ältere Version des Johannesevangeliums mit Joh 20,31 schloss.