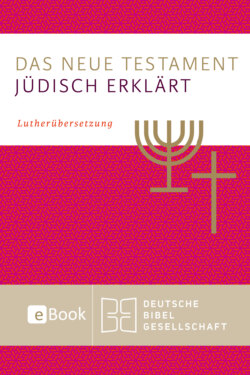Читать книгу Das Neue Testament - jüdisch erklärt - Группа авторов - Страница 80
Urheberschaft und Herkunft
ОглавлениеDas Johannesevangelium selbst bezeichnet den Lieblingsjünger als Verfasser oder wenigstens als die entscheidende Autorität seiner Nacherzählung der Geschichte Jesu (Joh 19,35; 21,24). Diese anonyme Gestalt, die erstmals in der Szene des Letzten Mahls Jesu mit seinen Jüngern auftritt (Joh 13,23), wird als der Jünger beschrieben, der Jesus am nächsten steht (Joh 13,24–25). Am Kreuz nimmt Jesus ihm das Versprechen ab, für seine Mutter zu sorgen (Joh 19,25–27). Seit dem 2. Jahrhundert identifizierte man den Lieblingsjünger mit Johannes Zebedäus, einem der zwölf Jünger, die in den Synoptikern erwähnt werden (s. z.B. ApocJoh, ein gnostischer Text aus dem 2. Jh., sowie Iren.haer. 3,3,1; Eus.h.e. 3,24). Diese Tradition ist wahrscheinlich historisch unzutreffend. Die Söhne des Zebedäus werden im Johannesevangelium nicht vor Joh 21,2 erwähnt, und Johannes wird namentlich gar nicht genannt. Darüber hinaus ist der Lieblingsjünger „dem Hohenpriester bekannt“ (Joh 18,15); solch eine Bekanntschaft wäre für einen galiläischen Fischer wie Johannes Zebedäus unwahrscheinlich.
Der Autor des Evangeliums lässt sich also nicht näher identifizieren. Obwohl seine Anonymität darauf hinweisen könnte, dass es sich bei ihm um eine symbolische Gestalt handelt, halten die meisten Fachleute ihn für eine historische, wenn auch idealisierte Persönlichkeit, die dem ursprünglichen Adressatenkreis des Evangeliums bekannt oder von diesem Kreis sogar als Führungsfigur anerkannt gewesen sein dürfte. Die Erwähnung der Topographie Jerusalems im frühen 1. Jahrhundert wie z.B. des archäologisch gesicherten Teichs von Betesda beim Schaftor (Joh 5,2) legt eine direkte Kenntnis der Stadt und ihrer Umgebung nahe. Es lässt sich aber unmöglich klären, ob der Autor des Evangeliums selbst oder seine Quellen über dieses direkte Wissen verfügten. Eine Herkunft des Evangeliums aus Judäa leitet sich daraus nicht zwangsläufig ab. Die ausdrückliche Erklärung jüdischer Praktiken und gesellschaftlicher Wirklichkeiten (Joh 2,6; 4,9) sowie die Tatsache, dass das Evangelium auf Griechisch geschrieben wurde, weisen auf eine abschließende Abfassung in der Diaspora hin. Auf der Basis von Angaben bei Irenäus (130–200 u.Z.; s. haer. 3,1,2) und Euseb (263–339; s. h.e. 3,1,1) hat man die Endfassung des Evangeliums traditionell mit Ephesus in Kleinasien (in der heutigen türkischen Provinz Izmir) in Verbindung gebracht.