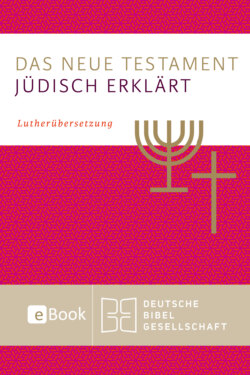Читать книгу Das Neue Testament - jüdisch erklärt - Группа авторов - Страница 82
Das Johannesevangelium und das Judentum
ОглавлениеDas Johannesevangelium offenbart ein tiefes und umfassendes Wissen über das Judentum des Zweiten Tempels, jüdische Bräuche und Methoden der Bibelauslegung. Das Evangelium erwähnt den Sabbat und das Pesachfest ebenso wie das Laubhütten- (Joh 5,1) und das Chanukkafest (Joh 10,22). Es erklärt das rituelle Händewaschen vor dem Essen (Joh 2,6), was für die oben erwähnte Annahme spricht, dass wenigstens ein Teil der ursprünglichen Leserschaft des Evangeliums nichtjüdisch ist.
Am auffälligsten ist, dass das Johannesevangelium in der Sprache sowie den exegetischen Techniken und Vorstellungen Parallelen zu jüdischen Texten seit der Zeit des Zweiten Tempels aufweist. In ähnlicher Weise verwendet der Historiker Josephus, der im 1. Jahrhundert u.Z. schrieb, z.B. häufig den Ausdruck „Zeichen“ (gr. sēmeion), um auf Manifestationen der Gegenwart Gottes hinzuweisen (z.B. Ant. 2,274; Bell. 6,288). Joh 6, oft als „Brotrede“ (Joh 6,25–71) bezeichnet, bedient sich ähnlicher Auslegungsmethoden wie der hellenistische Philosoph Philo von Alexandrien (ca. 20 v.u.Z. – 50 u.Z.) – annähernd ein Zeitgenosse des Autors des Evangeliums. Wie Philo in leg.all. 3,162 verbindet auch Joh 6,31 Ex 16,4 mit einer Anspielung auf die Pesach-Haggada (das Essen des Manna). In Joh 5,17 antwortet Jesus auf die Anschuldigungen der Juden, dass er den Sabbat breche, mit der Feststellung: „Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag, und ich wirke auch.“ Diese Antwort erinnert an Philos Diskussion der Frage, ob Gott auch am Sabbat wirke (Cher. 86–890; leg.all. 1,5–6). (Diese Frage wurde in jüdischen Quellen noch über viele Jahrhunderte erörtert, s. z.B. SchemR 30,9 zwischen einer Gruppe von Rabbinen und einem Sektierer.) Der Prolog (s. „‚Logos’ als ein jüdisches Wort: Der Johannesprolog als Midrasch“) überträgt Vorstellungen, die mit der „Frau Weisheit“ in Spr 8,22–31 und Sir 24 zusammenhängen, auf „das Wort“ (das in Jesus Fleisch geworden ist). Es wird als präexistent und behilflich bei der Erschaffung der Welt dargestellt, nimmt Fleisch an und wohnt in der Welt (Joh 1,14; vgl. Sir 24,8).
Schließlich gibt es zu wesentlichen Elementen des Johannesevangeliums auch enge Parallelen in den Schriftrollen vom Toten Meer. Der Gegensatz zwischen Licht und Dunkelheit (z.B. Joh 1,5; 3,19; 8,12; 12,35.46) im Johannesevangelium, der oft mit den Beschreibungen der beiden Geister im Serech ha-Jachad (Gemeinschaftsregel, 1QS 3,13–4,26) verglichen wird, ist vielleicht das augenfälligste Beispiel dafür.
Trotz der auffälligen Parallelen zwischen Johannes und frühreren oder zeitgenössischen hellenistisch-jüdischen Quellen gibt es keinen Beleg dafür, dass Johannes diese Quellen direkt kannte. Trotzdem tragen Texte aus der Zeit des Zweiten Tempels oder dem 1. Jahrhundert wie die Schriftrollen vom Toten Meer und die Werke eines Philo oder Josephus dazu bei, die Gedankenwelt zu verstehen, in der das Johannesevangelium entstand. Rabbinische Quellen tragen jedoch nicht direkt zu einem tieferen Verständnis des Vierten Evangeliums und seines besonderen historischen, sozialen, politischen und religiösen Kontexts bei. Da sich diese Gemeinsamkeiten in Texten finden, die mindestens ein Jahrhundert (z.B. die Mischna) und manchmal mehrere Jahrhunderte (der Babylonische und Jerusalemer Talmud) später entstanden sind, können sie dem Autor des Evangeliums nicht bekannt gewesen sein. Rabbinische Parallelen lassen jedoch erkennen, dass Ansichten und Probleme, die im Evangelium vorkommen, auch noch Jahrhunderte später von den Rabbinen diskutiert wurden. Das gilt beispielsweise für die Fragen nach dem Wesen des Monotheismus, nach der Möglichkeit von Wesen, die beim Schöpfungsakt mitgewirkt haben, oder nach der Bedeutung des Mannas. Freilich ist damit zu rechnen, dass sich in diesen späteren rabbinischen Quellen zum Teil älteres Material erhalten hat.
Das Johannesevangelium bezieht sich mittels zahlreicher Zitate und Anspielungen auf den Pentateuch (die Tora), die Prophetenbücher und die Schriften (für Beispiele s. die Anmerkungen); sehr wahrscheinlich stammen diese aus einer griechischen Übersetzung. Wichtige biblische Gestalten wie Abraham, Mose und Jakob werden erwähnt. Sehr subtil orientieren sich einige größere Redeeinheiten an bestimmten biblischen Erzählungen. „Frau Weisheit“ und ihre Verbindung mit Gott und der Schöpfung bilden ein wichtiges Thema des Prologs in Joh 1,1–18 (Spr 8; Sir 24; Weish 10; vgl. Philo, opif.). Der Abrahamzyklus (Gen 12–36) liegt Joh 8,31–59 zugrunde, besonders der Gegensatz zwischen Ismael und Isaak (Gen 18; s.a. Joh 8,39–44), Abrahams Gastfreundschaft gegenüber den drei Boten Gottes (Gen 18; s.a. Joh 8,39–44) und die Tradition, dass Abraham eine Vision der Zukunft und der himmlischen Welt (Gen 15,17–20; s.a. Joh 8,53–58) gehabt habe. Der Auszug aus Ägypten steht im Hintergrund des ganzen sechsten Kapitels.
Das Evangelium spielt auch auf nichtjüdische Vorstellungen an, etwa die messianischen Traditionen zu Mose und Josef im samaritanischen Werk Memar Marqa, Lehren Marqas. Die Vorstellung vom Logos als schöpferischer Kraft in der Welt gehört nicht nur in die jüdische Weisheitsliteratur, sondern ist auch in der griechischen Philosophie verbreitet, z.B. in den Arbeiten Heraklits, Aristoteles‘ und der Stoiker. Joh 6 bezieht sich auf das Buch Exodus, der Sprachgebrauch bei der Erörterung seines Hauptthemas aber – die Notwendigkeit, Jesu Leib zu essen und sein Blut zu trinken, um das ewige Leben zu erlangen – erinnert an Praktiken griechisch-römischer Mysterienkulte (z.B. Timotheos, Frag. 4) und spiegelt vielleicht sogar römische Anschuldigungen wider, wonach das Christentum eine subversive Sekte sei, die Kannibalismus und andere inakzeptable Bräuche praktiziere (z.B. Tac.ann. 15,44).