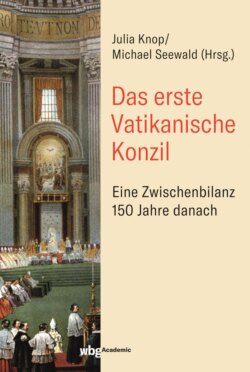Читать книгу Das Erste Vatikanische Konzil - Группа авторов - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Das Verhältnis von Glaube und Vernunft gemäß der dogmatischen Konstitution Dei filius 2.1 Glaubendes und vernünftiges Erkennen: Spezifika zweier Erkenntnisordnungen
ОглавлениеSucht man die durch das Erste Vaticanum vertretene Verhältnisbestimmung von Glaube und Vernunft zu erfassen, so dürfte zunächst von grundlegend-einordnender Bedeutung der Verweis darauf sein, dass Glauben und Erkennen je als noetische Vollzüge sui generis konzipiert werden. Die Rahmenvorstellung, in die diese Überzeugung gekleidet wird, ist die Annahme einer doppelten Erkenntnisordnung, in der die jeweiligen Erkenntnismodi sowohl im principium – hier der übernatürliche Glaube, dort das natürliche Licht der Vernunft – als auch im obiectum verschieden sind, wobei der Erkenntnisgegenstand der Vernunft die natürlich erreichbare Gotteserkenntnis und die praeambula fidei sind, während sich der Glaube zusätzlich auch auf die mysteria in Deo abscondita, also auf die notwendig zu offenbarenden Glaubensgeheimnisse richtet (DH 3015).
In der übernatürlichen Erkenntnisordnung geht es also um die Glaubenseinsicht, die – gestützt auf die dem supranaturalen göttlichen Wirken zuzurechnende Offenbarung – die von Gott erschlossenen Heilsmysterien bejahend anerkennt. Der „Glaube“ im engeren Wortsinn6 ist nach dem Zweiten Vaticanum dabei der „volle Gehorsam des Verstandes und des Willens“ gegenüber dem offenbarenden Gott (DH 3008) und definiert sich durch die Annahme des von Gott Geoffenbarten als „wahr“ (DH 3008) – ein Anerkennungsvorgang, der sich jedoch stets aufgrund „der Autorität des offenbarenden Gottes“ und nicht etwa auf Basis „der vom natürlichen Licht der Vernunft durchschauten inneren Wahrheit der Dinge“ (DH 3008) vollzieht. Es bedarf kaum der Erwähnung, dass dieser eigentliche, heilsrelevante Glaube nach Dafürhalten des Ersten Vaticanums grundsätzlich nicht ohne den Beistand der göttlichen Gnade zustande kommen kann (DH 3010); und dies gilt, wie in antihermesianischer Stoßrichtung festgehalten wird,7 sowohl für das, was im Rückgriff auf Gal 5,6 als fides (viva), quae per charitatem operatur oder fides charitate formata8 bezeichnet wird, als auch für die nicht von den anderen theologalen Tugenden Hoffnung und Liebe begleitete fides sterilis,9 also den bloßen Zustimmungsglauben (vgl. DH 3010).
Die praeambula fidei als Gegenstand der zweiten, der natürlichen Erkenntnis zeichnen sich hingegen dadurch aus, dass sie im Licht der natürlichen Vernunft und ohne unmittelbaren göttlichen Beistand wie etwa die übernatürliche Offenbarung oder das Gnadenlicht zugänglich sind. Freilich betrachtet das Konzil auch diese „natürliche“ Erkenntnis als eine in die von Gott errichtete Heilsökonomie eingeordnete Gegebenheit: Sie ist erst qua Schöpfung ermöglicht und somit prinzipiell als „vernehmende[s] Erkennen“10 zu verstehen; und auch eine Deutung, die in dieser natürlichen Erkenntnis das unthematische Fortwirken einer Uroffenbarung am Werk sieht, kann gerade angesichts der unter den Konzilsvätern verbreiteten Befürwortung eines schwachen Traditionalismus11 wenigstens nicht als ausgeschlossen gelten. Eine aktual übernatürliche Hilfe beim Zustandekommen dieser Erkenntnis wird aber nicht angenommen. Und im Zentrum des konziliaren Verständnisses dieser natürlichen Erkenntnisordnung – wie wohl übrigens auch der Rezeption von Dei filius – steht nun die Aussage, dass Gott als Ursprung und Ziel der Dinge aus der Schöpfung „gewiss“ erkannt werden kann (certo cognosci posse, DH 3004, vgl. DH 3026). Ob und inwieweit das Erste Vaticanum – einer verbreiteten Deutung entsprechend12 – mit dieser Formulierung jedoch tatsächlich eine Beweisbarkeit Gottes im strengen Begriffssinne definiert hat, bleibt zu prüfen.
Auffällig ist dabei zunächst, dass entgegen der vorgeschlagenen Emendation eines Konzilsvaters die Rede von einem Gottesbeweis – konkret also die Verwendung des Begriffs demonstrari – zugunsten des schwächeren Ausdrucks certo cognosci vermieden wird.13 Freilich: In einer anderen Textpassage von Dei filius (DH 3019) findet der hier zurückgewiesene Ausdruck in einem ganz ähnlichen Kontext doch Verwendung, sodass die besagte terminologische Entscheidung kein besonders stabiles Fundament für eine Relativierung des konziliaren Erkenntnisoptimismus hergibt14 – zumal dann, wenn man die (freilich keineswegs unumstrittene) Einfügung des Wörtchens certo im Zuge der Überarbeitung des ursprünglichen Schemas mitbedenkt.15
Durchaus zur Infragestellung einer rationalistischen Maximalauslegung des betreffenden Passus beizutragen geeignet ist hingegen ein Blick auf den Umgang des Konzils mit der quaestio facti, also mit der Frage, ob es im Falle der natürlichen Gotteserkenntnis um geschichtlich konkrete, gar allgemeine Erkenntnismöglichkeiten oder nur um eine der menschlichen Natur theoretisch und prinzipiell erschwingliche Einsicht geht: Selbst wenn nämlich in der späteren neuscholastischen Deutungstradition (unter Berufung auf Dei filius!) jegliche Form des Nichterkennens Gottes „geradezu als Fall für den Psychiater“16 bewertet wurde,17 lässt sich unter Berufung auf die Konzilsdokumentation gut eine gegenläufige Auslegung des Konzilstextes selbst fundieren, die die Auffassung vertritt, dass Dei filius ausdrücklich nicht die individuellen, konkret-geschichtlichen Möglichkeiten, sondern nur die Affirmation angezielt hat, dass der menschlichen Vernunft an sich, also gänzlich unter Absehung von der Frage faktischer Realisierung eine bestimmte Erkenntnispotentialität gegeben ist.18 Besonders – aber keineswegs ausschließlich!19 – neuere Auslegungen von Dei filius „minimieren“ also „den Umfang der Potentialität so weit, dass sie zur bloßen Hypothese wird“;20 in neuscholastischer Diktion: Es geht um die Existenz einer physischen, nicht einer moralischen Möglichkeit natürlicher Gotteserkenntnis.21 Die solcherart affirmierte Potentialität wird damit gewissermaßen zu einem erkenntnistheoretischen Grenzbegriff, der die prinzipielle Würde und Reichweite der menschlichen Vernunft nach dem Willen des Schöpfers offenhält, ohne jedoch eine historisch-faktische Einlösbarkeit dieser Möglichkeit bereits im Vorfeld zur Begegnung mit der übernatürlichen Offenbarung zu postulieren.
Für diese Auslegung des zentralen Passus in DH 3004 spricht zunächst die sich im Konzilstext gleich anschließende (DH 3005) Feststellung, dass auch jene Glaubensgehalte, die „der menschlichen Vernunft an sich nicht unzugänglich“ sind, infralapsarisch nur aufgrund der Offenbarung allgemein, leicht und sicher erkannt werden können,22 während die auf sich gestellte Vernunft die praeambula fidei allenfalls mit großer Anstrengung, mit verbleibenden Zweifeln oder beigemischten Irrtümern erkennt – wenn überhaupt. Es wird also eine faktische Verdunkelung der natürlichen Erkenntnispotenzen und eine damit einhergehende Verschlechterung ihrer an sich gegebenen Erkenntnisaussichten im Blick auf Gott angenommen, die die übernatürliche Offenbarung für einen Großteil der Menschen zwar nicht absolut oder physisch, wohl aber relativ bzw. moralisch notwendig macht.23 Einen starken Beleg für diese Deutung stellen auch mehrere Äußerungen Bischof Vinzenz Gassers, des Relators der Glaubensdeputation, dar, in denen er explizit festhält, dass es bei der Aussage zur natürlichen Gotteserkenntnis nach dem Verständnis der erarbeitenden Kommission um die Prinzipien, nicht aber den konkreten Gebrauch der Vernunft gehe.24
Als Auslegungshintergrund ist des Weiteren auch die Natur-Gnade-Frage zu berücksichtigen, als deren „Teilproblem“25 die Vernunft-Glaube-Verhältnisbestimmung im Zugriff des Ersten Vaticanums reflektiert wird. Dieses Spannungsverhältnis ist hier insofern relevant, als in der neuscholastischen Theologie die Konzeption rein natürlicher geistiger Vorgänge insgesamt ja nur als erkenntnistheoretisches Hilfskonstrukt fungiert: Die Gegebenheit einer rein natürlichen Gotteserkenntnis etwa ist nicht nur durch die konkrete Bedingtheit des infralapsarisch verschlechterten Erkenntnispotentials verschleiert, sondern sie lässt sich charitologisch betrachtet bereits insofern nicht fixieren, als konkret-faktisch nie mit Klarheit entschieden werden kann, welche Einsicht nicht doch auf eine quoad modum übernatürliche, innere Erkenntnishilfe zurückgeht. Rein natürliche Erkenntnisprozesse sind in statu isto, also angesichts der konkretgeschichtlichen Situiertheit menschlichen Erkennens auch unter dem Seziermesser des scholastischen Deutungszugriffs nicht in klarer Abgrenzung zu isolieren, was der Schultheologie an sich auch durchaus bewusst war. Vor diesem Hintergrund erscheint jedenfalls die in den Konzilsakten dokumentierte Debatte darüber, ob je ein heidnischer Philosoph, insbesondere Platon und eventuell Aristoteles, die vom Konzil als möglich postulierte natürliche Gotteserkenntnis erreicht habe,26 akademisch bzw. sogar inkonsistent.27 Es lässt sich jedoch festhalten, dass das Konzil die quaestio facti zumindest offenhält28 und ganz bewusst jede Aussage zu den näheren historischen Umständen der Realisierbarkeit jener natürlichen Potentialität vermeidet, um die es hier geht.29
Damit kann im Hinblick auf die Grundaussagen von Dei filius zu den menschlichen Möglichkeiten der Gotteserkenntnis Folgendes festgehalten werden: Zum einen verweigert das Konzil – in Abgrenzung von der fideistischen und traditionalistischen Leugnung jeglicher valider Quelle von Wahrheitserkenntnis jenseits der Offenbarung – entschieden die Preisgabe eines Grundvertrauens in die der menschlichen Vernunft von Gott eingestiftete „grundsätzliche Befähigung […] zu einer übersinnlichen metaphysischen Wahrheitserkenntnis“30 und vertritt, berücksichtigt man auch den weiteren Darlegungsduktus, einen insgesamt recht starken Erkenntnisoptimismus, der später zum maßgeblichen Vorzeichen für die Wirkungsgeschichte des Konzilstextes wird. Andererseits bleiben in Zurückweisung des Rationalismus jedoch durchaus auch die Grenzen der faktischen Realisierbarkeit dieser natürlichen menschlichen Potenz im Blick, sodass gegenüber der verbreiteten Annahme, Dei filius habe eine rational allgemein nachvollziehbare Beweisbarkeit der Existenz Gottes im strengen Sinne definiert, deutliche Zurückhaltung geboten ist.31 Hier offenbart sich bereits eine spürbare Ambivalenz dieses Dokuments, die sich aus der inhomogenen, apologetisch-polemischen Gemengelage ergibt, in deren Kontext Dei filius entsteht. Festzuhalten ist jedenfalls aber, dass das Konzil, wenn es in atheismus- und agnostizismuskritischer Absicht eine vernunftgemäß begründete Glaubenspflicht formuliert, implizit, aber doch eindeutig zwischen einer allenfalls theoretisch erreichbaren Gotteserkenntnis auf natürlich-rationalem Beweisweg und der nach Dafürhalten der Konzilsväter für alle Menschen annehmbaren übernatürlichen Offenbarung als deren Grundlage differenziert.