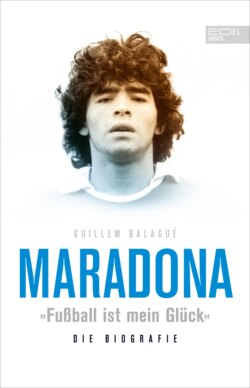Читать книгу Maradona "Fußball ist mein Glück" - Guillem Balague - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 2 Die Mutter – Doña Tota
Оглавление»Er kommt!« Das Publikum im ausverkauften Stadion skandierte erneut seinen Namen.
Dieeeegooooooooooo, Dieeegoooooooo …
Hoch oben von der Tribüne aus konnte man hinter dem riesigen aufblasbaren Wolfskopf mit dem offenen Maul, durch das er ins Stadion gelangen sollte, eine Hand erkennen, die ein weißes Käppi mit einer 10 darauf schwenkte. »Er ist hier!«
Wie ein römischer Gladiator betrat er die Arena, langsam, weil das kürzlich operierte Knie unter seinem hohen Gewicht litt. Wie ein Kämpfer, der schon bessere Tage gesehen hat. Maradona, 57 Jahre alt, war der neue Trainer von Gimnasia y Esgrima La Plata. Das hier war seine neue Bühne, auf der er, dessen Karriere abgebrochen war, noch einmal im Rampenlicht stehen wollte. Es sollte seine letzte Bühne sein. Er hatte angekündigt, Gimnasia y Esgrima La Plata zum Erfolg zu führen. Der Verein wusste, welches Abenteuer ihm mit Maradona bevorstand. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit war garantiert, und das war es, was für den Verein zählte.
Nach Beendigung seiner Spielerkarriere hatte Maradona als Trainer für verschiedene Klubs gearbeitet, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Mexiko für Sinola, für die argentinische Nationalmannschaft. Seine Teams bekamen die Häme der Gegner, die den ehemaligen Weltstar nur zu gerne scheitern sehen wollten, in der Regel besonders zu spüren. Aber was soll’s? Das war immer noch besser, als in der Versenkung zu verschwinden.
Dieeeegooooooooooo, Dieeegoooooooo … Die Jubelrufe schwollen immer weiter an.
Jeder Schritt in Richtung Spielfeld weckte schmerzhafte Erinnerungen. Als Spieler hatte er viele brutale Attacken einstecken müssen, in Spanien wie in Italien. Sie hatten deutliche Spuren an seinem Körper hinterlassen. Sein künstliches Knie schmerzte, ebenso wie seine Schulter. Die Beruhigungsmittel, die er gegen seine Angstzustände nahm, bewirkten eine andauernde Müdigkeit, und der langjährige Kokainmissbrauch hatte seinem schwachen Herzen, das inzwischen häufig verrücktspielte, schwer zugesetzt.
Maradona war es nicht peinlich einzugestehen, dass er verschiedene kosmetische Operationen hinter sich hatte. Die Oberlippe hatte er sich richten lassen, nachdem er von seinem Hund gebissen worden war. Auch das Anlegen von Magenbändern, Leistenbrüche und Nierensteine hatten ihn gezeichnet. All das war nicht zu übersehen. Hinzu kam eine Menge persönlicher Probleme, die ihm Verdruss bereiteten: Er hatte die Vaterschaft von mindestens fünf Kindern anerkannt, sechs weitere Vaterschaftsprozesse waren anhängig. Außerdem stritt er mit Claudia – vor Gericht, im Fernsehen und privat. Er war in Dutzende laufende Verfahren involviert.
Und er hatte seine Eltern verloren.
»Diego, mein Sohn, meine Augen, mein Junge.«
Er glaubte diese Worte zu hören, während er durch den Wolfstunnel schritt, und ein Kloß formte sich in seinem Hals. Dann betrat er das aus allen Nähten platzende Stadion und blinzelte verwirrt in die Sonne.
Dieeegoooooooo!
Als Vereinspräsident Gabriel Pellegrino ihn in den Arm nahm, versuchte Diego, sich zusammenzureißen. Doch es gelang ihm nicht, die Tränen brachen sich Bahn.
»Als ich aus dem Tunnel kam, sah ich plötzlich meine Mutter«, erklärte er später. »Ich glaube, dass es für alles einen Grund gibt.«
Emotional völlig am Boden, aber den Jubel auch irgendwie genießend, tat er einen weiteren schmerzhaften Schritt nach vorn. Er sah aus, als trüge er das Gewicht des gesamten Universums auf seinen Schultern. Erleichtert ließ er sich in ein Golfmobil fallen, dessen Fahrer ihm entgegen dem Protokoll ein Trikot der argentinischen Nationalmannschaft reichte, um sich darauf ein Autogramm geben zu lassen.
»Ich glaube nicht, dass ich je aufgehört habe, glücklich zu sein«, hatte Maradona einmal gesagt. »Die Sache ist nur … meine Eltern sind beide gestorben, das ist mein einziges Problem. Ich würde alles geben, um meine Mutter durch diese Tür kommen zu sehen.«
Und an diesem Tag im Stadion kehrte sie zurück.
La Tota, die Mutter der Nation, war acht Jahre zuvor mit 81 Jahren verstorben.
Die Nachricht war in ganz Argentinien durch die Presse gegangen. Vor jeder Begegnung an jenem Spieltag der Tornero Apertura, der dem Tod folgte, es war der fünfzehnte, wurde eine Schweigeminute abgehalten. So etwas hatte es für die Mutter eines Fußballers noch nie gegeben. Die Spieler der Boca Juniors trugen Trauerbinden, die Fans des SSC Napoli skandierten Doña Totas Namen und schwenkten eine Flagge mit der Aufschrift: »Ruhe in Frieden, Mama«. Eine Zeitung ließ sich zu der Schlagzeile hinreißen: »Die Mutter des Fußballs ist tot«.
Maradona hatte eine 28-stündige Reise von Dubai auf sich genommen, um ihr Lebewohl zu sagen. »Kommen Sie sofort«, hatte die Nachricht von Alfredo Cahe, dem Hausarzt der Familie, gelautet. Doña Tota lag auf der Intensivstation des Los-Arcos-Krankenhauses in Buenos Aires. In den letzten Monaten ihres Lebens war sie aufgrund von Herz- und Nierenproblemen immer wieder intensivmedizinisch behandelt worden. Während eines seiner Besuche in Buenos Aires hatte Maradona ihr das neue Tattoo auf seinem Rücken gezeigt: eine türkisfarbene Rose mit einem in verschlungenen Lettern geschriebenen »Tota te amo« (dt. Tota, ich liebe dich) darunter.
Aber Diego schaffte es nicht mehr rechtzeitig. Noch im Flugzeug erhielt er von Dr. Cahe die Nachricht, dass seine Mutter verstorben sei. Benommen vor Schmerz fuhr er nach Tres Arroyos, zu dem Haus, in dem die Totenwache gehalten wurde. In weißem Hemd, dunkler Krawatte, schwarzem Jackett und einer Sonnenbrille, die seine verquollenen Augen verdeckte, verbrachte er die kommenden Stunden weinend neben ihrem Sarg, an seiner Seite seine neue Partnerin Verónica Ojeda. Trost spendeten ihm auch die anderen Anwesenden: Claudia Villafañe, Dalma, Gianinna, seine sieben Geschwister und sein Vater Don Diego.
»Meine Freundin, meine Königin, mein alles ist gegangen«, sagte Diego, als La Tota an einem heißen Novembertag 2011 auf dem Friedhof Jardín Bella Vista beigesetzt wurde.
Als Sohn einer von Immigranten aus Süditalien und Spanien beherrschten, stark religiös geprägten Kultur, die das Bild der selbstaufopfernden, einzigartigen Mutter verherrlicht, die ihren abtrünnigen Söhnen stets verzeiht, hatte er die Frau verloren, die nie einen Fehler machte, die eine, die ihn vor allen »Windmühlen beschützte«. Maradona, der seinen Ödipuskomplex mit ins Grab nehmen sollte, sagte einmal scherzhaft, dass seine Mutter seinen Vater nur deshalb geheiratet habe, weil sie ihm begegnet war, bevor sie Diego kennengelernt hatte.
La Tota gab etwas zu, das normalerweise ein Tabu ist, nämlich dass Diego ihr Lieblingssohn war. »Sie hat ein Faible für mich«, wusste Maradona. »An meinem 46. Geburtstag sah ich sie an und sagte: ›Du bist die erste Frau in meinem Leben, meine ewige Freundin. Ich habe dir alles zu verdanken, Tota, und ich werde dich immer lieben, mehr und mehr.‹«
Sie war die Mutter, die in Hunderten argentinischen Volksliedern besungen wird, in Tangos, Milongas und Chacareras, die sich alle aus echten Empfindungen speisen, aber zugleich ihre eigene Wirklichkeit konstruieren. Im beliebten »Cómo se hace un tango« (dt. Wie man einen Tango tanzt) wird ihr Folgendes gesungen: »Sei ganz Ohr, der Mensch, der dich verehrt, wird sprechen / heute, morgen, jederzeit, denn für mich / bist du nicht nur meine Mutter, sondern meine Freundin.«
»Der Sänger Joan Manuel Serrat sagte einmal, dass man nicht aufhört, Kind zu sein, um ein Elternteil zu werden, wenn die eigenen Eltern gestorben sind«, erzählt Guillermo Blanco, Pressesprecher Maradonas während seiner Zeit in Barcelona und seinen ersten Jahren in Italien. »Diego hat der Tod seiner Eltern, insbesondere der seiner Mutter, sehr mitgenommen. Die Verbindung zwischen diesen beiden Menschen war eine ganz besondere.«
Die Geschwister akzeptierten den Sonderstatus, den Diego in den Augen ihrer Mutter und der Welt innehatte. Einige von ihnen leben noch heute in der Nähe des Argentinos-Juniors-Stadions – vom Schicksal übergangene, einfache Sterbliche, Verwandte eines Halbgottes. Dieses Schicksal wird man nicht mehr los, ganz gleich, was man tut. Lalo und Hugo stellten sich der Herausforderung, die Erwartungen zu erfüllen, die in sie gesetzt wurden, und versuchten es mit einer Fußballkarriere, aber der zündende Funke sprang nicht über, und sie blieben nichts als »die Brüder von«.
Doña Tota fühlte sich wohl in ihrer Rolle als Mutter, nicht nur der von Maradona, sondern der einer ganzen Nation. Sie war die Sonne, um die alles kreiste, die Anführerin des Rudels. »Wenn Doña Tota etwas sagte, war es beschlossene Sache, und niemand, nicht einmal Diego, traute sich, etwas dagegen einzuwenden«, erinnerte sich Fernando Signorini. Sie war weitaus redseliger als Don Diego, es sei denn, sie sah fern oder huschte geschäftig hin und her, um Teller und Tabletts von und zu einem immer gedeckten Tisch zu tragen.
Obschon sie lange Zeit mit ihrem Sohn in Europa lebte, suchte die allzeit fürsorgliche Mutter stets nach einer Bestätigung dafür, dass sie zurückgeliebt wurde. Sie war eifersüchtig auf Claudia und all die anderen Freundinnen, was deren Leben nicht einfach machte. Diegos Abwesenheit frustrierte sie. Sie beklagte sich oft bei ihm, er habe sie in Buenos Aires »zurückgelassen«. Diego erinnerte sich, wie Doña Tota ihm am Telefon vorjammerte, wie einsam sie sei. Im Hintergrund waren deutlich die Geräusche von Freunden und Familie zu hören, denn sie war ständig von Menschen umgeben.
La Tota dachte, sie habe sich ausreichend gewappnet für das Unvermeidliche: dass ihr die Alte Welt den Sohn nehmen würde, sobald er erwachsen geworden war, und man sein Talent wie einen wertvollen Rohstoff handelte. Nicolau Casaus, Vizepräsident des FC Barcelona, erwähnt sie in seinem Bericht über die Vertragsvorverhandlungen mit Maradona: »Ich vermute, sie ist ungefähr so alt wie ihr Mann, aber angesichts ihres zerknitterten Äußeren ist das schwer zu sagen. Wenn ich mit ihr über den potenziellen Wechsel ihres Sohnes nach Barcelona spreche, sagt sie nur: ›So Gott will.‹«
Fußball bereitete Doña Tota ebenso viel Freude wie Schmerz. Er war die Fahrkarte, die sie aus Villa Fiorito herausbrachte und ihr Leben in ungeahnter Weise beschleunigte. Allerdings erhöhte sich damit auch die Unfallgefahr. »Bei der U-20-Weltmeisterschaft in Japan, die wir im Fernsehen verfolgten, kassierte Argentinien zunächst eine 0:1-Niederlage gegen die Sowjetunion«, erinnert sich Guillermo Blanco. »Und was tat La Tota? Sie war plötzlich nicht mehr bei uns in der Küche, sondern legte sich ins Bett, sie konnte die Anspannung nicht ertragen. Dann kam sie zurück, und Alves verwandelte einen Elfmeter für Argentinien. Davon gibt es sogar ein Foto in der El Gráfico. Danach legte sie sich wieder hin. Sie kam zurück, und Argentinien ging durch ein Tor von Ramón Díaz in Führung. Wieder legte sie sich hin, nur um rechtzeitig wieder dabei zu sein, als Diego ein Freistoßtor erzielte. Es war die totale Euphorie. Alle brüllten und lagen sich in den Armen.«
Maradonas Eltern liebten den Fußball, diese Leidenschaft war ihnen nicht aufgezwungen worden. Don Diego hatte früher sogar selbst für einige Amateurmannschaften in Esquina als Rechtsaußen gespielt. »Fußball war eines der wenigen Dinge, über das die Armen verfügen konnten«, sagt Blanco. Schon als El Pelusa bei den Cebollitas spielte, verpassten seine Eltern nur selten eines seiner Spiele. Chitoro wechselte häufig seine Arbeitsschichten, um dabei sein zu können. Dank José Trottas Pick-up-Taxiservice konnten sie oft zu Grillfesten fahren, wo sie mit anderen Familien aus der Mittelschicht in Kontakt kamen, deren Söhne das Gros der Cebollitas-Spieler stellten. Die meisten von ihnen wohnten ganz in der Nähe des Argentinos-Juniors-Stadions, eine Fahrtstunde, ja eine ganze Welt entfernt vom Haus der Maradonas.
Nachdem er seinen ersten Gehaltsscheck als Profifußballer erhalten hatte, lud Maradona seine Mutter in eine Pizzeria in Pompeya ein. »Nur wir zwei, wie ein Paar. Das ganze Geld ging dafür drauf«, erzählte Diego Jahre später.
Zu Hause gaben Doña Tota und Don Diego den Takt an. Er, der strenge Vater, der durchaus Funken sprühen konnte, sie, die versöhnliche Mutter. Einmal ignorierte Diego ihre Aufforderung, das Haus nicht zu verlassen, und ging zum Fußballspielen nach draußen. Dabei ruinierte er die Flecha-Sneaker, die er vor kurzem erst bekommen hatte. Seine Eltern hatten Wochen darauf gespart. Don Diego schäumte vor Wut und verpasste seinem Sohn eine Abreibung. Als Doña Tota hörte, was geschah, kam sie angerannt, zeigte mit dem Finger auf ihren Mann und drohte: »Wenn du meinem Sohn auch nur ein Haar krümmst, bringe ich dich um, wenn du heute Nacht schlafend im Bett liegst.«
La Tota trug Diego gelegentlich auf, etwas Schweine- oder Rindfleisch zu kaufen, um die Mahlzeiten der elfköpfigen Familie anzureichern. Immerhin mussten acht Kinder, die beiden Eltern und die Großmutter satt werden. Zu diesen besonderen Anlässen erhielt Diego immer die größten Stücke, die Schwestern bekamen stattdessen Unmengen an Salat. »Die armen Mädchen haben wie verrückt Grünzeug gefuttert«, erinnerte sich Maradona in seiner Autobiographie Yo soy el Diego. Aber nicht nur sie. La Tota klagte am Essenstisch gelegentlich über Magenschmerzen, sodass sie auf ihren Anteil verzichtete und das, was übrigblieb, an ihre Kinder verteilte. Don Diego hielt es ähnlich.
»Manchmal wusch ich bis fünf Uhr früh die einzigen Socken, die die Kinder hatten, damit sie ein sauberes Paar zur Schule anziehen konnten«, sagte Doña Tota im Gespräch mit der Zeitschrift Gente. »Ich weiß noch, dass ich sechs Schulanzüge waschen musste. Sechs! Man stelle sich das einmal vor. Wenn es regnete, musste ich sie auf dem Ofen trocknen, und ich stand auf, wann immer es nötig war, um sie zu bügeln.«
Das Wasser, das bei Regen durch die Decke tropfte, sammelte die Familie in Eimern und Töpfen, weil es im Haus kein fließendes Wasser gab. War nicht mehr genug Wasser vorrätig, musste Diego die leeren 20-Liter-Kanister an der öffentlichen Wasserstelle befüllen und nach Hause tragen – das war sein erstes Krafttraining. Das Wasser, das sie holten, wurde zum Kochen, Trinken und Waschen verwendet. Wenn es kalt war, verschob man das Haarewaschen auf einen anderen Tag.
Mit so vielen Personen unter einem Dach zu leben bedeutete ständiges Chaos. Wenn Doña Tota allerdings in dem Raum, der ihnen als Wohnzimmer, Küche und Esszimmer zugleich diente, den Fernseher anstellte und ihre filterlosen Zigaretten rauchte, zogen sich die Kinder in den hinteren Bereich zurück und waren mucksmäuschenstill. Die Mutter sah fern und rauchte, ohne mit der Wimper zu zucken, und wirkte dabei fast wie ein Teil des Mobiliars.
Morgens ging Diego zu Fuß von der Calle Azamor zu seiner Schule, der Remedios de Escalada de San Martín. Er tat es, weil er musste, und wartete nur auf den Tag, an dem der Fußball ihn von allen Verpflichtungen entband.
Nach der Schule verbrachte er seine Zeit auf den Schlammplätzen nahe seinem Elternhaus, er spielte Fußball mit seinen Freunden oder trat in Spielen für die von seinem Vater gegründete Mannschaft Estrella Roja an. Nachts schlief er mit seinem Ball im Arm ein. Es war sein erster, er hatte ihn mit drei Jahren von seinem Cousin Beto geschenkt bekommen, den er bewunderte.
Doña Tota war 30 Jahre alt, als sie sich mit dickem Bauch und unter Wehen zum Evita-Krankenhaus nach Lanús begab. Ihr Mann und ihre Schwägerin Ana María begleiteten sie. Drei Blocks mussten sie laufen, um den Bahnhof von Fiorito zu erreichen. Von dort aus nahmen sie die Bahn nach Lanús. Dort angekommen, lag noch einmal ein Fußweg von zweieinhalb Blocks bis zum Krankenhaus vor ihnen. La Tota hatte stechende Schmerzen und konnte kaum noch stehen. Bevor sie das Krankenhaus betraten, entdeckte sie etwas Glänzendes an der Bordsteinkante und beugte sich hinab, um es genauer zu betrachten. Es war eine sternenförmige Brosche, glänzend auf der einen Seite, dunkel auf der andern. Vielleicht ein Sinnbild ihrer Zukunft. Sie steckte das Schmuckstück ein. 15 Minuten später, um 7.05 Uhr am 30. Oktober 1960, wurde Diego geboren, »mit Haaren am ganzen Körper«.
Diego war Doña Totas fünftes Kind und ihr erster Sohn. Fünf Jahre zuvor war La Tota von Esquina nach Buenos Aires gekommen, um sich dort eine bessere Zukunft aufzubauen, an ihrer Seite ihre Tochter Ana und ihre Mutter Salvadora Cariolichi. Letztere war die Tochter von Mateo Kriolić, der am 29. September 1847 in Praputnjak, einem Ort in der Nähe von Bakar, 150 Kilometer westlich von Zagreb im heutigen Kroatien, geboren worden war.
Das Schicksal all dieser Menschen führte schließlich zur Geburt von Diego Armando Maradona.