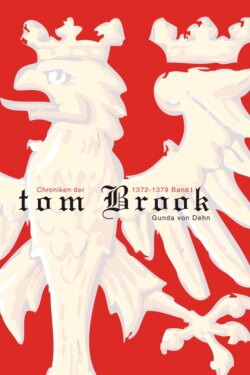Читать книгу Chroniken der tom Brook - Gunda von Dehn - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 23 Das Sielgespenst
ОглавлениеDie Störche sammelten sich schon, kreisten in immer grösser werdendem Schwarm über den Sumpfwiesen am Esch. Welch majestätischer Anblick!
„Die Störche ziehen nach Süden und wir müssen warten, bis uns die große Flut verschlingt”, sagte Adda traurig.
„Aber es kommt keine Flut.” Erstaunt blickte Frauke von ihrer Stickarbeit auf. „Ach so, ja. Aber ich habe es doch gesehen... Merkwürdig... Das ganze Land war überschwemmt und am Turm von St. Marien machten die Schiffe fest.” Addas Stimme klang verträumt, so als spräche sie von einer Vision. Verwirrt schaute Frauke ihre Herrin an, dann bemerkte sie plötzlich, wie ein Lächeln über Addas Gesicht huschte: „Oh, Frauke! Ich glaube schon an meine eigenen Lügen!” Am liebsten hätte Frauke gesagt, dass man damit nicht spaßen solle, doch sie schwieg. Schließlich stand es ihr nicht zu, die Burgfrau zu tadeln. Adda stand auf, tat einen Schritt in die wärmende Sonne. Das silbergeschmückte Haarnetz blitzte auf, als sie den Kopf wandte: „Damit treibt man keinen Scherz, meinst du? Da hast du Recht. Aber ich sage dir, der Zweck heiligt die Mittel - in diesem Fall.”
Eine ganze Woche schon war vergangen, seit Adda dem Fremden das Schweigegeld gezahlt hatte, aber sie hatte nicht den Mut aufgebracht, Lütet Manninga davon zu berichten. Derweil herrschte im Dorf große Unruhe, weil der Fremde aus dem Moor nicht zurückgekehrt war. Sicherlich war er vom Wege abgekommen und im Sumpf ertrunken, vermutete man. Ein schlechtes Omen! Es fand sich auch niemand, der den gefährlichen Weg zur hellsichtigen Hertje noch einmal zu gehen wagte. Unterdessen streute Adda die abenteuerlichsten Gerüchte aus: Schiffe habe man um Mitternacht auf dem festen Land gesehen; Fischschwärme seien aus der See gesprungen und wie Kriegsheere ins Land gezogen und dergleichen mehr. Sogar der Priester von Westeel wurde angesteckt von all dem Geschwätz, und er hielt seinen Schäfchen eine flammende Rede: „... es genügt nicht, meine Kinder, zu beten ‚Gott bewahre Damm und Deiche’, es genügt nicht, zu beten ‚Gott bewahre Siel und Bollwerk und dergleichen’! Es ist nicht damit getan, die Herzen emporzuheben und selbst zu sicheren und höher gelegenen Gestaden hinaufzusteigen. Es ist unrecht, Land und Hof und Vieh dem Widersacher zu überlassen! Legt Hand an! Überlasst nicht tatenlos seinem Schicksal, was der Widersacher in seiner unendlichen Gier und Mordlust zum Untergang bestimmt hat! Tatkräftige Männer und Frauen, die ihr seid, widersetzt euch dem Satan, der mit lüsternen Blicken nach eurem Eigentum schielt! Der Heilige Ludger”, er wies mit ausgestreckter Hand auf den aus Eichenholz geschnitzten Schutzpatron. „Der Heilige Ludger! Seht ihn euch an! Da steht er und kann sich nicht wehren gegen euren Leichtsinn! Er soll euch beschützen? Euch, die ihr zu träge, zu faul, zu geizig seid, euch selbst zu schützen? Ihr solltet euch schämen! Gestern erst vernahm ich des Heiligen Stimme! Ja, jetzt sitzt ihr da und glotzt und glaubt es nicht! Aber ich sage euch, er bat mich, seine Statue nach Norden zu bringen, damit sie nicht ein Opfer des Satans werde. Es ist ernst, sage ich euch! Betet zu Gott, damit er euch Zeit lässt, das Versäumte nachzuholen! Überseht nicht die Zeichen des Himmels! Nur wer sich selbst hilft, dem hilft Gott!” Anderntags wurde der Heilige Ludger in feierlicher Prozession nach Norden geschafft. Trotzdem vermochte auch das die Westeeler weder aufzurütteln noch von der drohenden Gefahr zu überzeugen.
Nachdenklich setzte Adda sich wieder auf die harte Bank in den Schatten der mächtigen Eiche. Sie betrachtete Frauke, dieses liebe, schlichte Ding, das stets freundlich war und bemüht, ihr jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Wider Erwarten war es ein Leichtes gewesen, Lütet Manninga davon zu überzeugen, dass Frauke für den Dorfkrug mit all den lüsternen Männern zu schade sei. Als Schlupfloch bot sich zur Zeit nur die Manninga-Burg an. Hier fand Frauke Unterkunft und ein neues Betätigungsfeld. Es ergab sich dabei irgendwie von selbst, dass Frauke im Besonderen zu Addas Verfügung stand. Manchen Tag verbrachten die beiden jungen Frauen hier draußen unter dem herrlichen Laubdach der uralten Eiche beim Sticken und Plaudern. Oder aber sie gingen hinunter an den Strand und spielten mit den Kindern, die im Wasser herum patschten und Sandburgen bauten.
Wenn das Wetter unwirtlich war, blieben sie den Tag über in der Burg, und Adda unterrichtete Frauke im Schreiben und Lesen. Das machte Spaß! Sie fand, dass Frauke sich durchaus gelehrig dabei anstellte. Ohnehin war sie seither aufgeblüht. Man spürte, dass die Angst, bloßgestellt und in den Schmutz getreten zu werden, von ihr abgefallen war. Ihre Augen flogen nicht mehr unstet umher. Sie witterte nicht überall Gefahr, entdeckt zu werden. Schließlich war auch der Druck von ihr genommen, dieses widerliche Rattengesicht heiraten zu müssen und vielleicht war es auch gut für sie, nicht ständig den Mann vor Augen zu haben, der ihr einmal von Liebe gesprochen und sie dann verstoßen hatte.
Ein Übriges für ihr blühendes Aussehen taten sicherlich das gute Essen, die leichtere Beschäftigung und nicht zuletzt auch die Schwangerschaft, die sie - ungehemmt von Schnürleibchen - von Tag zu Tag rundlicher werden ließ. Übelkeit und Kopfschmerzen machten ihr zeitweise zu schaffen, aber trotzdem war sie fröhlich und sie konnte so hinreißend lachen, dass es ansteckend wirkte. Mit diesem Lachen brachte sie Sonnenschein in das triste Leben der Burgbewohner. „Ich bin so glücklich”, pflegte Frauke oft zu sagen, und dann küsste sie gerührt Addas Hände. „Noch nie im Leben bin ich so glücklich gewesen. Wie soll ich das je danken?” Adda erwiderte dann vielsagend, dass sie dazu schon noch Gelegenheit bekommen werde.
Das alles ging ihr jetzt durch den Kopf und sie sagte Frauke, dass sie nun ihre Hilfe in Anspruch nehmen müsse. Bereit, für Adda tom Brook durchs Feuer zu gehen, erstrahlte Frauke. Wie schön, dass das Burgfräulein ihr so viel Vertrauen schenkte!
„Frauke, sobald Hinnerk seine Wache angetreten hat, gehst du ins Torhaus. Du sagst ihm, dass ich heute Abend noch einmal fort muss und spät in der Nacht heimkomme. Und dann bleibst du da und beschäftigst Hinnerk, damit er mir nicht wieder einschläft und mich dann nicht hereinlässt. Kannst du das?”
Ob der Plan gelingen wird? Adda betrachtete Frauke forschend. Natürlich! Hatte sie doch mit einem erklecklichen Sümmchen nachgeholfen, damit der alte Stiesel seine Neigung für Frauke entdeckte. Schon als Hirtenbub war Hinnerk bei den Manninga in Dienst gekommen. Ein in sich gekehrter und nicht sonderlich freundlicher Mann und besonders gut aussehen tat er auch nicht mit seinen vorstehenden Froschaugen und den Segelohren. Aber Frauke machte das nichts, und sie konnte es sich auch nicht leisten, in ihrer Lage besonders wählerisch zu sein. Hinnerk war ein anständiger Kerl, ein bisschen stur, ein bisschen bockig und eigentlich schon fast scheintot, aber er wollte bei Lütet Manninga um die Heiratserlaubnis nachsuchen und das allein zählte. Dass Adda ihm dafür das Blaue vom Himmel versprochen hatte, wusste Frauke freilich nicht.
Flammende Röte schoss Frauke in die Wangen:„Ich glaub’ schon”, stotterte sie, „Hinnerk..., ich meine, er... wir verstehen uns ganz gut...”
Adda konnte sich ein Lächeln über Fraukes Verlegenheit kaum verbeißen: „Wunderbar! Wenn es dunkel wird, werde ich zum Siel hinuntergehen, dorthin, wo die verliebten Pärchen sich ihr Stelldichein geben. Du weißt schon, wo die Birkengruppe steht.” Frauke nickte. Sie hätte gern gewusst, was ihre Herrin denn dort zu suchen hatte, wagte aber nicht, nach den Gründen zu fragen. Vielleicht ein Stelldichein?
Graue, dampfende, trübe Nacht; dichte Nebel verhüllen Mond und Sterne. Nur selten reißt eine schwache Meeresbrise den Nebel zu Schwaden auseinander und lässt fahl das Mondlicht durchschimmern, das dann für wenige Augenblicke die beiden eng umschlungenen Menschen beleuchtet; Umrisse nur, gleich wieder verschwunden wie ein Spuk hinter wolkiger, trübnebliger Mauer.
Mit Hilfe ihres Pattstocks springt Adda von der steilen Holzsicherung des Deiches hinunter auf den Strand. Viel zu laut knirschen Sand und zersplitternde Muscheln unter ihren Füßen. Lauschend verharrt Adda, ehe sie sich daran macht, ihr weites graues Cape abzunehmen und an der Spitze des Pattstocks zu befestigen. Langsam pirscht sie sich näher heran an das Pärchen - so nah, dass sie dessen Flüstern hören kann.
Den Pattstock hat sie sich von ihrem Onkel Lütet ausgeborgt, der allerdings nichts davon weiß. Er pflegt damit über die allgegenwärtigen Wassergräben zu springen, so wie es fast alle Friesen tun.
„Komm, komm... Wir wollen uns ins Gras setzen.” Der Bursche drängt ungeduldig sein Mädchen.
„Nein, nein, das ist jetzt viel zu feucht, da wird mein Kleid ganz nass.” „Ach, zier’ dich nicht. Das wird es sowieso. - Na gut, ich lege meinen Mantel unter.”
Während Adda im diffusen Licht sieht, wie der Bursche sich seines Mantels entledigt und auf den Boden legt, steckt sie sorgsam die mitgebrachte Rübe auf die zwei Zinken des Pattstocks. - Leider konnte Adda nur eine kleine Runkelrübe unter ihrem Mantel verbergen. Aber die ist ausreichend, stellt sie zufrieden fest. - Die ganze Zeit über ist Adda ziemlich ruhigen Blutes gewesen, jetzt aber spürt sie plötzlich ein unerklärliches Brausen in den Ohren. Ihre Hände sind kalt und feucht von Schweiß und irgendwie klebrig. Fortwährend muss sie die Handflächen an ihrem Kleid trockenreiben.
Es muss gelingen! Es muss! sagt sie sich immer wieder. Auf keinen Fall darf ich mich erwischen lassen. Vorsichtshalber entfernt sie sich wieder ein Stückchen von dem Liebespaar, um sicherer vor Entdeckung zu sein und möglicherweise einen Fluchtvorsprung zu erlangen, denn viel zu laut schlägt der Überwurf im Wind, findet Adda. Unmöglich, dass die beiden Menschen das überhören. Aber sie tun es dennoch, sind wohl zu sehr miteinander beschäftigt, um andere Dinge wahrzunehmen. Endlich findet Adda einen geeigneten Standort für ihren Spuk. Behutsam stützt sie den hergerichteten Pattstock gegen die Holzsicherung des Deiches, legt ihre zitternden Hände an den Mund, formt sie zu einer Sprachtute: „Uhh, uhiee, uhh!” vibriert ihre Stimme, wobei das Zittrige ihrer Aufregung zuzuschreiben ist, was dem ganzen aber einen markverzehrenden Ton gibt. „Was war das?” hört Adda das Mädchen erschrocken fragen. „Nichts, sei still”, erwidert ungehalten eine Männerstimme. - Also zu leise. - Erneut, diesmal etwas lauter, ertönt Addas: „Uhh, uhiee, uhh!”
„Da war doch was!” quengelt das Mädchen. „Du willst nur ablenken. Aber heute kommst du mir nicht aus! Gleich hab ich den Pflock in der Kerbe!” entgegnet barsch der Mann. „Aber so hör doch! Da ist was! Ich schwör’s!”
Abermals wimmert Addas „Uhhu, uhiee, uhh!” durch den dumpfen, wattigen Nebel - wie Hexenschrei. „Du hast recht, jetzt hab’ ich‘s auch gehört!” ruft der Bursche prompt; und Adda hält den Zeitpunkt für günstig, ihr ‚Gespenst’ einzusetzen. „Deicheee! Deiichee! Deiichee!” heult anklagend Addas Stimme dazu.
„Da! Ein Gespenst!” schrillt das Mädchen. „Ein Geist! Sieh’ nur! Oh, heilige Mutter Gottes!”
Sicher bekreuzigt sie sich jetzt, denkt Adda und lacht still in sich hinein. - Das Spiel macht Spaß! Der Wind füllt das Cape unter dem Runkelrübenkopf mit Leben, bläht es schaurig auf, lässt es in sich zusammenfallen, bläst es erneut auf, wiegt es hin und her, lässt es auf- und niederschwingen.
Schauerlich die Töne ziehend, ruft Adda „Deiichee! Deiicheee! Deiicheee!” Dann lässt sie ihr Gespenst hinterm Deich versinken.
„Ein Geist?” schreit der Mann. „Ein Gespenst? Da ist nichts.”
„Aber eben war es doch da! Da oben hab’ ich’s gesehen! So groß war es, Willem!” Schluchzend vor Furcht und Entsetzen verteidigt sich die Deern. „Ein großes Mondgesicht, ganz bleich. - Willem, ich fürchte mich so!”
„Ah, du faselst! Sei endlich still... komm, komm, halt still, so ist’s gut, sei ganz ruhig. Gleich hab ich’s...”
Adda lässt Zeit verstreichen, hockt mit angezogenen Knien im Sand. Es ist kalt, der Nebel kriecht mit nassen Fingern durch die Kleider. Sie erschauert und denkt: Wenn ich nicht bald zurückgehe, hole ich mir noch einen Schnupfen. Bis jetzt ist alles glatt gelaufen, fast zu glatt; also ans Werk!
Erneut schwenkt sie ihr ‚Gespenst’ über der Deichkuppe auf und nieder. Schauderhaft zittert das “Uhhu, uhiee! Deiichee! Deiichee! Uhhuu!“ durch die Nebelnacht.
„Da!” kreischt die Frau. „Da ist es wieder! Halt mich fest, Willem!”
„Ha! Ein Geist? Ein Gespenst?” ruft der Mann. „Das ich nicht lache! Das ist dein Bruder! Den werde ich gleich haben!”
Oh, lieber Gott, hilf mir! Eilig versucht Adda, ihren Mantel von der Stange zu lösen. - Die Deern auf dem Deich greint angstvoll, und sie hört den Mann schimpfen, der sich von ihr befreien will. Offenbar hängt sie wie eine Klette an ihm. Addas klamme Finger verheddern sich in dem ‚blöden’ Band, mit dem der Mantel festgezurrt ist. Nervös versucht sie es abzureißen, aber ihre Finger wollen vor Aufregung nicht gehorchen, zudem ist es viel zu dunkel, um vernünftig etwas sehen zu können.
Das Meer neben ihr flutet rauschend höher auf den Strand. Auflaufend Wasser. Auf der Deichkrone kreischt aufgelöst die Deern, und der Mann müht sich, sie loszuwerden, um das ‚Gespenst’ einzufangen.
Nur einen Fluchtweg gibt es für Adda, den am Deichfuß entlang. - Immer zerfahrener wird sie, immer weniger kann sie ihre Hände beherrschen. Die Zeit drängt, das Wasser steigt, die Wellen eilen den Strand hinauf in den Sand, wo sie im Nichts verschwinden. - Endlich! Endlich gelingt es ihr, das Cape loszufummeln. Mit raschem Schwung wirft sie es um die Schultern, lässt den Rübenkopf ins Wasser rollen. Eine Welle trägt ihn fort.
„Nein!” hört Adda das Frauenzimmer krakeelen: „Lass mich nicht allein! Ich habe Angst, ich fürchte mich so! Bleib bei mir! Willem, bleib hier! Lass uns weglaufen! Es ist ein Geist! Der Geist von dem Kind, das ihr lebendig im Deich begraben habt!”
Adda rennt davon, den Pattstock hinter sich her schleifend. Wird sie verfolgt? Sie wagt nicht, sich umzuschauen. Sie läuft und läuft; wie aufgezogen bewegen sich ihre Beine, immer weiter und weiter, bis sie stolpernd und keuchend in den Sand stürzt. Aus, alles aus, alles vorbei, alles umsonst... Atemlos krallt sie sich in den Sand, erwartet, jeden Augenblick gepackt zu werden. – Stille – unheimliche, tropfende Stille. – Der Nebel dämpft das Rauschen des Meeres; fast lautlos laufen die Wellen auf den Strand, halb versickernd im Sande rollen sie zurück.
Bemüht, ihren rasselnden Atem zu bändigen, liegt Adda bäuchlings auf dem Boden. Aber es will ihr nicht gelingen, ihre gehetzten Lungen zu beherrschen. Statt aufzustehen, statt weiterzulaufen, liegt sie da und horcht auf die Geräusche der Nacht: Irgendwo schreien Möwen, klatscht Flügelschlag - vielleicht auch springen Fische aus dem Wasser, das hört sich gewiss genauso an. Manchmal erzählen Fischer davon. Vielleicht stimmt es doch, was sie sagen? Addas Beine sind schwer wie Blei. Es ist alles so wie in jenen Alpträumen, in denen man verfolgt wird und nicht fortlaufen kann. Ihr ist kalt und zugleich heiß. In ihren Händen fühlt sie feuchtklebrig den Sand und die scharfkantigen Muscheln. Der salzige Grund brennt in den Schürfwunden. Sicher blutet sie auch. – Adda wagt den Kopf nicht zu heben, wagt nicht, ihre Hände anzusehen. Ihr Gesicht in den feuchten Sand gepresst, harrt sie auf irgendein Unglück. Hat sie es nicht geradezu herausgefordert? - Was ist das? Ist das nicht das wilde Kliff und Klaff einer Hundemeute? Bildet sie sich das nur ein? Kommt das Kläffen näher? Ist es in der Luft oder auf der Erde? Vielleicht König Redbad mit seiner wilden Meute? Nur nicht bewegen! Ganz still muss man sein, wenn man ihm begegnet; dann bleibt man unbemerkt. Adda presst sich an den Boden. An ihrem Ohr glaubt sie das Stampfen von Hufen zu spüren. Ja, die Erde bebt! Oder ist es ihr eigenes Herz, das so stampft, das ihr ganzer Körper erzittert? - Täuschung? Einbildung? - Kommt das Schnauben und Hecheln näher? Entfernt es sich? Jetzt tutet auch noch das Hifthorn! Wie vom Meeresgrund klingt es... Unheimlich durchdringt das monotone „Tut-Tut-Tut” den wattigen Nebel. - Vor Angst kann Adda nicht mehr klar denken. Die Legende von König Redbad lähmt ihren Verstand. Sie fühlt sich wie ein Tier in der Falle. Gefangen! Gefangen im eigenen Netz. Gleich, gleich ist sie da - die wilde Meute, dürstend nach Blut, nach meinem Blut. Schon schlägt der heiße Atem der Hunde in ihren Nacken. Die wilde Meute fällt über sie her, will sie zerfleischen! Glühende Augen, aufgesperrte Rachen, Zähne wie Dolche, geifernde Lefzen. Die Höllenhunde, sie sind da! Das ist kein Traum, das ist Wirklichkeit, entsetzliche, scheußliche Wirklichkeit! Ekelhaft läuft Geifer in ihren Nacken, ihr Gesicht... In Wahnsinnsangst schreit Adda auf, und in ihren Schrei hinein hört sie das wiehernde Gelächter des Friesenfürsten...