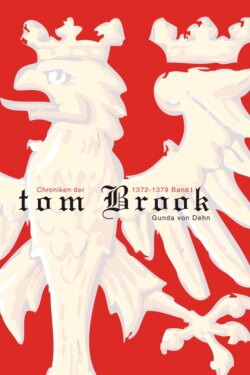Читать книгу Chroniken der tom Brook - Gunda von Dehn - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 24 Dionysiustag - anno 1373
ОглавлениеDer Herbst zog ins Land. Seit Tagen wehte ein warmer Südwestwind, ungewöhnlich für Oktober. Sonst toben um diese Jahreszeit schon Herbststürme über das Meer und peitschen es, bis das Wasser brüllend gegen die Deiche schlägt. In diesem Jahr verhielt sich der Wettergott gnädiger. In Westeel blühten noch die Rosen und schufen mit ihren rot leuchtenden Blüten einen reizvollen Kontrast zu den grün bemoosten, niedrigen Strohdächern. Schläfrig lag das Kirchspiel in der goldenen Herbstsonne. Auf der Dorfstraße balgten sich kläffend ein paar struppige Köter um einen Knochen, im aufwirbelnden Staub kaum noch auszumachen. - Eine Gruppe Frauen ging zum Strand hinunter; blau und weiß gestreifte Schürzen über dunklen Wollkleidern; große Strohhüte zum Schutz gegen die immer noch kräftige Sonne. Jede trug einen Korb voller Vesperbrote bei sich und einen Krug Bier. Schon von weitem sahen die Frauen auf der Deichkrone den Deichvogt Lütet Manninga entlangreiten. Deutlich hoben sich Pferd und Reiter gegen den wasserblauen Himmel ab. Vom Pferderücken aus überwachte er die Deicharbeiten. - Silbermöwen segelten schwerelos über dem Meer, stritten sich kreischend um Beutefische. - Am Deich arbeiteten Männer daran, die von Wühlmäusen und Ratten untergrabenen und ausgehöhlten Deichstrecken auszubessern und - wo nötig - den Deich zu erhöhen. Als der Häuptling die sich nähernden Frauen erblickte, hob er grüßend die Hand. Aber die waren zu sehr damit beschäftigt, aufeinander einzureden, als dass sie seinen Gruß bemerkt hätten. Schmunzelnd verzog Manninga die Mundwinkel. Worüber sie wohl so eifrig schwatzen? Gewiss über das ‘Deichgespenst’. Von nichts anderem ist seit Tagen die Rede. Es muss wohl recht eindrucksvoll gewesen sein, dieses ‚Gespenst’, denn das ganze Seeland sprach davon. Manche erzählten, dass es ausgesehen habe wie der Höllenfürst persönlich, mit glühenden Augen und wehendem Schweif und einem Dreizack. Andere wussten es besser. Sie waren schließlich hautnah dabei gewesen, als es das arme Mädchen bis zum Dorfkrug verfolgt hatte. Ganz in Weiß sei das Gespenst gekleidet gewesen - wie es sich eben für ein richtiges Gespenst gehört - ganz in Weiß also und es hatte den Kopf eines Säuglings. Aber wenn man ganz genau hinsah, dann löste es sich in Nebel auf. Zumindest hatte es mit Grabesstimme gerufen „Deiche! Deiche!” Ob es dabei mit der Sense gedroht hatte, war nicht mehr eindeutig herauszufinden. Auch gab es Leute, die das Sielgespenst zwar nicht gesehen, aber umso deutlicher gehört hatten. Und nicht nur das, sie wollten sogar das fürchterliche Schreien der Verdammten gehört haben, die - man schüttelte erstaunt den Kopf - in der kommenden Flut ertrinken mussten. Eindeutig fest standen aber das schreckliche Schreien und das überwältigende Gelächter des Höllenfürsten. Der Untergang drohte! Die bösen Vorzeichen mehrten sich, waren deutlich, überdeutlich. Wer wollte da noch zweifeln? Das musste wahrlich ein Narr sein! - Ein Narr war Lütet Manninga freilich nicht, wenn ihn die ‚bösen Vorzeichen’ auch ziemlich belustigten, besonders das ‚Sielgespenst’. Als er es nämlich dort unten am Strand - er konnte von hier aus die Stelle gut sehen - mit der Nase im Sand gefunden hatte, war es alles andere als eindrucksvoll gewesen. Da war es nur ein verängstigtes, schmutziges Mädchen, durchgefroren, mit blutverschmiertem Gesicht. - Durch reinen Zufall hatte er erfahren, dass Adda noch spät am Abend die Burg verlassen hatte. Lütet fühlte sich verantwortlich für sie und sah sich genötigt, nach ihr zu suchen. - Nebel ist gefährlich, man kann leicht die Orientierung verlieren. Dass Lütet und vor allem seine freudig kläffenden Hunde das bedauernswerte Sielgespenst so sehr erschreckten, dass alle Welt glaubte, die Verdammten hätten in ihrer Not geschrien, war zwar unbeabsichtigt gewesen, aber doch ein guter Nebeneffekt.
Mit viel Anteilnahme und gut geheucheltem Erstaunen hatte der Häuptling die unterschiedlichsten Berichte in Sachen ‚Gespenst’ angehört und dem Begehren der Bauern zugestimmt, dass nun unverzüglich etwas zur Deichsicherung unternommen werden müsse. Eilends waren Boten in alle Lande geschickt worden, Deicharbeiter anzuwerben. Die Zeit drängte... Jetzt gönnte man sich selbst und jenen Arbeitern kaum eine Pause. Gleich zu Beginn der Arbeiten hatte sich gezeigt, dass die Schäden bedeutend grösser waren, als zuvor angenommen. Nun führte niemand mehr frevelhafte Reden. Zu allem Überfluss blies seit kurzem ein warmer Südwestwind. Der Südwest sammelte das Wasser vor der Küste. Es war bei Ebbe kaum zurückgewichen! Hin und wieder huschten sorgenvolle Blick über den Horizont. Ja, der unheilkündende Südwest versetzte manch einen in Angst.
Pausenlos kamen vollgeladene Wagengespanne aus dem Vorlande und brachten Klei für den Deichbau. Die schweren Oldenburger Pferde stemmten die Lasten mühsam vorwärts in ihren Kummetgeschirren, zogen unter gewaltigen Anstrengungen die mit Grassoden und Stroh, gebündeltem Gestrüpp und Holzpfählen, beladenen Wagen. Ständig wurden die Tiere angetrieben, bekamen Stock und Peitsche zu spüren. Die heiseren Schreie ihrer Antreiber längst missachtend, gehorchten die schweißbedeckten Tiere nur noch der Gewalt.
Die Luft war schwül und die Männer quälten sich, Pfähle für die Fußsicherung des Deiches zu rammen, Klei mit hölzernen Bahren auf den Deich zu tragen, den damit erhöhten Wall mit Grassoden abzudecken. Sie schonten sich nicht, nahmen sich kaum Zeit, den Schweiß abzuwischen.
Und der Wind trug den gleichmäßigen Klang der Hammerschläge ins Binnenland, den Knall der Peitschen, die lauten Rufe der Treiber...
Lütet Manninga wandte seinen Blick zum Meer. Im blauen Dunst der Ferne sah er die Segel der Koggen und Hulke schwanken. Es schien so harmlos, das sanft rollende Meer mit den bezaubernden Schaumkronen auf den Wellen. Nein, man kann ihm nicht trauen. Wer seine Tücke kennt, lässt sich nicht täuschen!
Die Deicharbeiten waren noch lange nicht abgeschlossen. Wenn der Wind jetzt umsprang! Nicht auszudenken, was alles eintreten konnte. Die Flut würde in das unzureichend geschützte Land gedrückt! Selbst die schon instandgesetzten Deichstrecken konnten fortgespült werden, weil der neue Wall noch nicht genügend Zeit gehabt hatte, sich zu setzen und zu festigen.
Zu allem Überfluss reichte nicht einmal das Holz aus für die Sicherung des Deichfußes. Selbst Grassoden waren knapp; so knapp, dass die nicht mit einer Grasnarbe abzudeckenden Flächen durch Stroh gesichert werden mussten. Zu diesem Zweck bedeckte man den Deich mit einer Lage Stroh, worüber querseits Strohbänder gelegt wurden. Die Deichsticker stießen dann diese Strohbänder in gleichmäßigen Abständen mit der zweizinkigen ‚Sticknadel’ in den Deich hinein. Das erforderte das ganze Körpergewicht des Stickers, der seinen Leib deshalb mit einem gepolsterten Lederkissen gegen den Stoß der Nadel schützen musste. Die Sticker kamen mit ihrer Arbeit nur langsam voran. Die Arbeit war schwer und verlangte große Geschicklichkeit. Nicht jeder verstand mit der Sticknadel umzugehen. Drum mangelte es auch an genügend Stickern. Aus diesem Grunde waren teilweise auch die Räume zwischen den aufgelegten Grassoden noch nicht mit Stroh verstopft worden.
Schon sank die Sonne ins Meer. Die Frauen holten ihre Kinder heim. Morgen sei ein neuer Tag, riefen sie den Männern zu; auch sie möchten bald heimkommen.
Am Horizont zogen sich drohend schwarze Wolken zusammen. Mittlerweile war es fast dunkel geworden. Manninga rief einen der Aufseher zu sich: „Lass Schluss machen. Man kann ja kaum noch etwas sehen. Sie sollen alles so gut wie möglich sichern und dann nach Hause gehen. Gute Nacht.”
„Gute Nacht, Herr”, nickte der Aufseher, froh, das Zeichen zum Arbeitsabbruch geben zu können, denn auch er fühlte sich zum Umfallen müde. Wie mochte es erst den Arbeitern gehen!
Auch Lütet Manninga ritt heim zur Burg, wo schon gelbes Licht durch die Fensteröffnungen floss. Ihm fiel auf, wie seltsam still es geworden war, und dass die Möwen binnenwärts flogen. Ein böses Wetter kündigte sich an. Trotzdem, er musste sich ausruhen, um Kraft zu schöpfen für eine möglicherweise lange Nacht. Den ganzen Tag im Sattel – auch kein blankes Vergnügen.
Der Wind hatte sich nun gedreht, war kalt geworden. Aus Nordwest blies er heftig durch die Kleider. Noch konnte man das nicht als Sturm bezeichnen. Es war halt nur eine starke Brise, die – so das Glück ihnen hold war – nicht kräftiger werden würde. Wenn doch, mochte Gott ihnen beistehen. Als Deichvogt fühlte Manninga sich gehalten, schon jetzt entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.
Alle verfügbaren Männer mußten am Deich zusammengezogen werden. In Gruppen zu vier oder fünf Kerlen wurden sie an den gefährdetsten Stellen eingesetzt. Gut ausgerüstet mit Kleisäcken, Pfählen und Spaten hatte Lütet Manninga sie sorgfältig postiert. Nur in allergrößter Not, das hieß, nur wenn ein Deichbruch unmittelbar bevorstand und durchaus nicht mehr abzuwehren war, durften sie ihren Standort verlassen.
Seit Stunden schon trieben die Bauern ihr Vieh auf höher gelegene Landstriche. Ein endloser Zug hochbeladener Wagen strebte der Geest zu, bepackt mit rasch zusammengerafften Habseligkeiten. An diesem Dionysius-Abend schien alles von unschätzbarem Wert, ob Kochtopf oder Tuchballen, Gold- und Silbergeschmeide oder getrockneter Fisch.
Ochsen, Pferde, Esel, ja sogar Ziegen zogen die zumeist überladenen Wagen über morastige Wege. Umsäumt von einer Kette flackernder Pechfackeln, getrieben von kläffenden Hunden und krachenden Peitschen, schob sich der Zug unendlich langsam voran. Immer wieder blieben Fahrzeuge stecken und mussten mit vereinten Kräften herausgezogen werden. - Vom Westeeler Kirchturm klang mahnend die Sturmglocke herüber. Die Dorfkirche von Westeel – auf einer Wurt gebaut – bot bei Sturmflut mehr Schutz als die Manninga-Burg. Frauen und Kinder drängten sich bereits in der kleinen Kirche. Sie bot kaum genügend Raum für all die Menschen. Die Enge, der Geruch, die allgegenwärtige Unruhe, das alles zerrte an den Nerven. Kinder weinten, Säuglinge, ihrem warmem Bett entrissen, greinten in den Armen ihrer Mütter, die sich um die besten Plätze stritten. – Man müsse mehr Rücksicht üben, einander helfen, rief der Herr Kaplan verzweifelt in die wogende Menge...
Heulend fuhr der Sturm um die Manninga-Burg, rüttelte wütend an den Fensterläden, strich jammernd durch Spalten und Ritzen. Unheimlich klagend sang der Wind durch das menschenleere Gebäude. Vrouwe Manninga befand sich mit ihren Mägden längst auf dem Weg ins Dorf.
Wie ausgestorben lag die Burg, nur Adda und Frauke waren noch zurückgeblieben, prüften gewissenhaft jede Luke, jedes Fenster, ob es auch gut verschlossen war, damit der Sturm nicht hineingreifen und womöglich das Dach forttragen konnte. Sorgfältig löschten sie jede Feuerstelle, jedes Talglicht, jede Öllampe. Eine bernsteingelbe Katze folgte den beiden jungen Frauen auf Schritt und Tritt, strich schnurrend um ihre Beine. Nach beendetem Rundgang hüllten Adda und Frauke sich in ihre wollenen Mäntel, wanden sich die Hatte um den Kopf, ein wollenes grünes Tuch, das auch Mund und Nase bedeckte. Während Adda noch nach dem Pattstock griff, löschte Frauke die letzte Fackel. Zischend starb die Glut im Wasser. – Finsternis – nur die Augen der Katze funkelten wie zwei grüne Lichter in der Dunkelheit. Irgendwo klapperten leise Töpfe an der Wand. Das klang fast wie Muschelketten. Plötzlich schoss Adda ein Gedanke durch den Kopf: das Muschelweiblein! Ob denn eigentlich jemand das alte Weib aus ihrer Hütte vom Deich geholt habe, fragte sie. Nein, davon wisse Frauke nichts; die Alte werde gewiss die Sturmglocken gehört haben. Aber Adda meinte nachdenklich, dass der Wind landeinwärts stehe und die Alte zudem fast taub sei. Sie müsse gehen und schauen, ob sie noch da sei.
„Wer? Die Hütte oder das Muschelweib?”
„Das Muschelweib natürlich. Aber es ist wahr, gar leicht kann der Wind die Hütte vom Deich blasen.”
„Sie ist bestimmt längst im Dorf”, erwiderte Frauke ungeduldig. „Die Alte merkt doch eher als alle andern, wenn Sturm aufkommt.”
„Niemand wird daran gedacht haben, sie zu holen. Alle sind viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt.”
„Bestimmt ist sie allein gegangen. Wir müssen auch fort...”
„Die alte Frau allein? Frauke! Du weißt doch genau, dass sie sich kaum auf den Beinen halten kann. Wie sollte es ihr bei diesem Sturm gelingen, allein den Weg hinunter ins Dorf zu schaffen?”
„Bestimmt hat ihr jemand geholfen. Wir müssen gehen...”
„Ja, geh’ nur. Ich werde sie holen.”
Frauke erkannte die Zwecklosigkeit, Adda von ihrem wahnwitzigen Vorhaben abbringen zu wollen. Was die sich in den Kopf gesetzt hatte, verfolgte sie eigensinnig bis zuletzt. Wenn es also nicht möglich war, ihre Herrin umzustimmen, so wollte Frauke sie zumindest begleiten. „Dann komme ich mit”, sagte sie trotzig.
„Nein, Frauke! Ich verbiete es! Denke an dein Kind. Du darfst dich nicht unnötig in Gefahr begeben. Ich will es nicht.”
„So empfindlich bin ich nicht. Ich kann helfen, die alte Frau in Sicherheit zu bringen. Männliche Hilfe haben wir nicht zu erwarten und allein wird es zu schwer für Euch.” Das überzeugte Adda keineswegs. Ungeduldig schob sie Frauke zur Tür hinaus und blitzte sie an: „Ich sage ‚nein’ und dabei bleibt es! Ich wünsche, dass du ins Dorf gehst. Ich kann dich nicht gebrauchen, also geh!” Beinahe hätte sie vor Groll und Unachtsamkeit die Katze in der Tür eingeklemmt, die unentschlossen zögerte. Hinaus in Wind und Wetter oder doch lieber im Schutz des warmen Hauses Mäuse jagen? Adda beförderte das Tier kurz entschlossen mit dem Fuß zurück ins Haus. Die Tür zuschlagend, hörte sie noch das unglückliche Maunzen der Bernsteingelben. Fest den Riegel vorgeschoben, das Schloss vorgehängt und zugesperrt.
Regen klatschte den Frauen ins Gesicht, eisig wie Hagelschlag. Im Nu waren Hatte und Mantel durchnässt. Kräftig schritten die jungen Frauen aus. Noch hatte der Sturm nicht den Gipfel seiner Kraft erreicht, noch konnte man ihm beherzt trotzen.
Wo sich der Weg teilte, bei den schiefen Birken, verabschiedete Adda ihre Freundin. Allein ging es jetzt weiter den Deich hinauf durch den mehr und mehr anschwellenden Sturm. - Ein hartes Stück Arbeit. Ohne Unterlass peitschte jetzt der Wind das Meer gegen die steile, hölzerne Wallsicherung. Von der Deichkrone aus sah Adda entsetzt und doch sonderbar fasziniert die sich auftürmenden Wasserberge heranrollen und übereinander gegen den Deich schlagen. Mit weißen Schaumkronen brausten sie heran, zischende, brodelnde, kochende Wassermassen. Manchmal glaubte Adda, von ihnen verschlungen zu werden, aber dann schlugen die Wellen doch nicht so hoch.
Schwere Regenwolken jagten jetzt über den Himmel, ließen nur selten spärliches Mondlicht durch. Kaum konnten Addas Augen die Dunkelheit durchdringen, und überdies behinderten der herniederstürzende Regen und die Gischt sprühenden Wogen zusätzlich die Sicht. Folgte ihr jemand? Sie wandte sich um, starrte angestrengt in die Finsternis. Ja, tatsächlich! Unbeirrt stapfte Frauke ihr nach. Das Tuch der Hatte unters Kinn schiebend, wollte Adda ihr etwas zurufen, aber der Sturm riss die Worte von ihren Lippen, zerfetzte, zerriss, zerstückelte sie, dass sie ungehört davonflogen. Sie bohrte tief ihren Pattstock in den Grund, vermochte sich nur mit seiner Hilfe aufrechtzuhalten. Ungeduldig wartend, bis Frauke heran war, klammerte sie sich daran. Mit wilder Gestik gebot sie ihr, zurückzugehen. Warum in Gottes Namen war sie überhaupt hier? Gegen ihr Gebot und wider alle Vernunft?! Heftig schüttelte Frauke den Kopf. Nein, sie wollte nicht allein zum Dorf gehen. Schicksalsergeben zuckte Adda die Achseln. Vielleicht war es gut so oder auch nicht - es blieb keine Wahl mehr. So hakte sie denn die Schwangere unter. Gemeinsam konnte man dem Sturm besser trotzen. Der hatte jetzt deutlich an Heftigkeit zugenommen. In Sturzbächen klatschte eisiger Hagelregen hernieder, stach mit Tausenden von Nadeln in ihre Gesichter. Schon leckte die tosende, gierige Flut nach ihnen; der Deich unter ihren Füßen bebte.
Keuchend erreichten die beiden Frauen die ärmliche Hütte des Muschelweibleins. Kaum bekamen sie die morsche Tür auf, konnten sich in den winzigen Raum zwängen. Erschöpft ließen Adda und Frauke sich auf die Sitzbank fallen; ein Möbel, gefertigt aus einem roh behauenen Baumstamm, ein schmales Brett als Rückenlehne. Das alte Weib hockte zitternd am wackligen Tisch vor einem Berg Muschelschalen, die sie immerhin trotz des brüllenden Sturmes bearbeitete. Aufgeregt flackerte die trübe Tranfunzel. Der Wind zog durch sämtliche Ritzen. Im Hintergrund der Alkoven, mit Kohlköpfen unter der Butze. Torfsoden - sorgfältig gestapelt neben der offenen Feuerstelle. Muschelketten an den Wänden. Die durchbohrten und zu Ketten aufgezogenen Muscheln klapperten leise. Die alte Frau verdiente sich ihr karges Brot mit diesen nutzlosen kleinen Schmucksachen. - Wie lange war es her, dass die alte Frau auch für Adda diesen Kinderschmuck hergestellt hatte? Damals war sie noch besser zu Fuß gewesen und konnte die Muscheln selber sammeln, heute war sie darauf angewiesen, dass die Kinder ihr das Rohmaterial in die Hütte brachten.
Adda dachte daran, wie oft sie voller Begeisterung zugeschaut hatte, wenn die hübschen Armbänder und Halsketten entstanden. Ja, schon damals war das Muschelweiblein uralt und gebrechlich gewesen, zumindest in den Augen der Kinder. Manchmal hatten die Kinder helfen dürfen, die Muschelschalen aufzuziehen. Eine schöne Zeit... Noch heute bewahrte Adda ihre unzähligen Muschelketten in einem ‚Schatzkästlein’ auf. - Händeringend sabberte die Alte von ihren Ängsten. Sie habe geglaubt, dass man sie vergessen hätte, wollte sie elendiglich zu Grunde gehen lassen. Ewig schulde sie ihnen Dank. Demütig küsste sie ihnen die Hände.
Schon manchen Sturm habe sie erlebt hier oben auf dem Deich, aber solch einen schrecklichen wie heute noch nie, nicht einmal bei der ‚Großen Manntränke’. Die beiden Frauen hörten nicht zu; die Alte bemerkte es nicht einmal. Schließlich setzte sie ihnen tatsächlich eine heiße Fischsuppe vor, aber die beiden Frauen lehnten dankend ab. Nein, keine Zeit mehr; jeden Augenblick konnte der Deich brechen und dann war der Rückweg abgeschnitten. Das kam einem Todesurteil gleich. Sie mussten zur Kirche ins Dorf. Dort gab es Rettung. Überhaupt - ein Wunder, dass die kleine Hütte auf dem Deich noch nicht fortgeblasen worden war, wütend wie der Sturm gegen das armselige Bauwerk anraste. Bedrohlich knarrte und krachte es in allen Fugen. - Eilig nahm Adda das fadenscheinige Cape der alten Frau vom Haken, warf es ihr wortlos um, während Frauke sich schon gegen die Tür stemmte, um sie zu öffnen. Dann, die Alte in ihrer Mitte, kämpften sie sich durch Sturm und Regen.