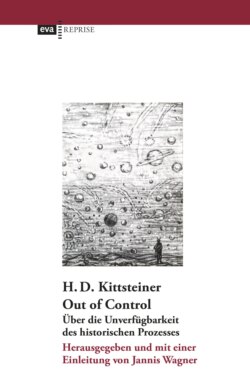Читать книгу Out of Control - H. D. Kittsteiner - Страница 11
IV. Geschichtsphilosophische Zeichendeutung
ОглавлениеDas Plädoyer für eine geschichtsphilosophisch angeleitete Kulturgeschichte behauptet die Unhintergehbarkeit der geschichtsphilosophischen Erfahrung. Mit der längst geleisteten Kritik an der Teleologie der Geschichtsentwürfe zwischen Kant und Hegel ist das Problem nicht gelöst; denn die Teleologie überlagerte nur die Grunderfahrung der Nicht-Verfügbarkeit des Geschehens.31 Paul Ricœurs Einsicht, dass die „Fabel aller Fabeln“ nicht geschrieben werden könne, geht gleichwohl mit einer Trauerarbeit an Hegel einher. Wir können nicht mehr wie Hegel, sondern nur noch nach Hegel denken – so müssen wir von Hegel auf Kant zurückgehen. Die crux aller Geschichtsphilosophie liegt aber schon in ihrem Anfang bei Kant. Seine Orientierung am Geschichtszeichen schiebt paradigmatisch ein Ereignis mit einer moralphilosophischen Überlagerung ineinander. Sollte sich herausstellen, dass wir bei unserer Orientierung in der Geschichte zwangsläufig auch nicht anders verfahren, bleibt nur der Appell zu einem kritischen Umgang mit dieser „geschichtsphilosophischen Zeichendeuterei“.32 Keinesfalls darf es wieder zur Einhüllung der vorfindlichen Empirie in den schützenden Gang eines Geistes kommen. Umgekehrt hat die siegesgewisse Entteleologisierung der Geschichtsphilosophie auch nicht viel erbracht, es ist nur die spekulative Überlagerung von einem durch diese Kritik nicht beeindruckten, unverfügbaren Prozess abgezogen worden. Dieser machthabende Geschichtsprozess spukt seither in unbegriffenen Hintergrundmetaphern durch die Schriften der Historiker und Philosophen.
Der junge Schelling stellt sich in Anschluss an Kant der Frage, ob eine Philosophie der Geschichte überhaupt möglich sei. Im Philosophischen Journal von 1797/98 antwortet er noch mit einem „Nein“. Aber schon zwei Jahre später entwirft er im System des transcendentalen Idealismus selbst eine Geschichtsphilosophie, ja er bezeichnet das Fehlen der Reflexion über Freiheit und Notwendigkeit auf dem Gebiet der Geschichte als das höchste noch nicht aufgelöste Problem der Transzendentalphilosophie. Es besagt, dass ich glaube, mit Bewusstsein zu handeln – aber aus meinem Handeln entsteht mir unbewusst eine objektive Welt, die ich so nicht gewollt habe. Für einen kurzen Moment durchdenkt Schelling rückhaltlos diese Paradoxie, bevor er sie dann mit der „absoluten Synthesis“ wieder glättet.
Das Vertrauen auf die teleologischen Numen schwindet in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Junghegelianer und Feuerbach hatten ihren Anteil an dieser Wende. Nach 1848 war ihr Denken aber nicht mehr gefragt, so dass im 19. Jahrhundert alles zwei Mal gesagt werden musste – einmal vor und einmal nach 1848. Das Denken des Vormärz war revolutionär und stand politisch links; das Denken nach 1848 wird zunehmend ästhetisch-zivilisationskritisch und ist politischen Richtungen nicht eindeutig zuzuordnen. Beiden Linien gemeinsam ist anfänglich noch einen Kritik an Hegel. Daher sind zunächst Jacob Burckhardt und Karl Marx gegenübergestellt.
Jacob Burckhardt als Leser Hegels ist keineswegs der philosophische Laie, als der er sich gerne dargestellt hat. Man sieht an seinen Notizen zu Hegels Geschichtsphilosophie, dass er sich sehr genau den Kernkomplex des Theodizeeproblems in Hegels „Vernunft in der Geschichte“ vorgenommen hatte. Aus der vermeintlich begriffenen Einordnung der historischen Übel als vorwärts treibendes Element im historischen Prozess wird die Vorlesung über „Glück und Unglück in der Weltgeschichte“, die in dem von J.G. Schlosser entlehnten Satz kulminiert: „Die Macht ist böse an sich“. Ein Übel ist ein Übel, und ob aus ihm Gutes hervorkommen könne, ist nur unserer Neigung zum kompensatorischen Denken beim Betrachten der Weltgeschichte geschuldet. Ein Weltplan kann nicht behauptet werden. Aus dem erschlichenen Gesichtspunkt des „Weltgeistes“ wird der Ausgangspunkt vom duldenden und handelnden Menschen; daher wird Burckhardts Standpunkt „gewissermaßen pathologisch“. Und doch lehnt Burckhardt die Arbeit der „geschichtsphilosophischen Centauren“ nicht rundweg ab. Man sehe sie gerne am Waldesrand der geschichtlichen Studien, weil sie in der Lage seien, einzelne mächtige Ausblicke in den Wald zu hauen. Denn den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen – das ist ein weit verbreitetes Schicksal der Historiker.