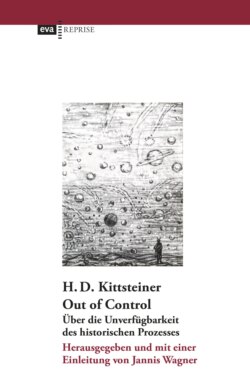Читать книгу Out of Control - H. D. Kittsteiner - Страница 17
II. Trauerarbeit an Hegel
ОглавлениеEs gibt in der neu wieder erwachten Beschäftigung mit „Geschichtsphilosophie“ eine Tendenz, hinter Hegel auf Kant zurückzugehen.5Paul Ricœur hat in seinem Werk „Zeit und Erzählung“ diese Tendenz so umrissen: Es ist gerade die Trauer um das verschwundene absolute Wissen, das uns zu Kant zurückführt. Man musste zuerst Hegel gefolgt sein, um diesen Weg zurück gehen zu können. „Denn welcher Leser Hegels, der sich einmal wie wir von der Macht seines Denkens hat verführen lassen, verspürt nicht den Verzicht auf Hegel als eine Wunde, die im Gegensatz zu denen des absoluten Geistes eben nicht verheilt? Diesem Leser, so er nicht einer matten Sehnsucht verfallen will, ist der Mut zur Trauerarbeit zu wünschen.“6 Was ist Trauerarbeit? Trauerarbeit ist ein „intrapsychischer Vorgang, der auf den Verlust eines Beziehungsobjekts folgt und wodurch es dem Subjekt gelingt, sich progressiv von diesem abzulösen“. Freud präzisiert diesen Vorgang so: „Jede einzelne der Erinnerungen und Erwartungen, in denen die Libido an das Objekt geknüpft war, wird eingestellt, überbesetzt und an ihr die Lösung der Libido vollzogen.“7 Für unseren Fall bedeutet das nichts anderes, als eine Kritik der einzelnen Kategorien der Geschichtsphilosophie. Sie müssen sich befragen lassen, welche Hoffnungen sie erweckten, welche Enttäuschungen mit ihnen verbunden waren, schließlich, wie man sich „progressiv von ihnen ablöst“ – um ein kritisches Verhältnis zu ihnen zu gewinnen.8 Eine partielle Lektüre des sechsten Kapitels des dritten Bandes aus „Zeit und Erzählung“ soll den Übergang in diese Aufgabenstellung bilden.
Ricœur lässt die „Hegelsche Versuchung“ damit beginnen, dass er an die Stelle der vormaligen „Universalgeschichte“ die „Weltgeschichte“ setzt und seine Zuhörer mit einer philosophischen Zumutung konfrontiert. Nachdem er in pädagogischer Absicht die „Arten der Geschichtsschreibung“ durchgegangen ist, geht er zum „Begriff der Philosophie der Weltgeschichte“ über: „Der einzige Gedanke, den sie mitbringt, ist aber der einfache Gedanke der Vernunft, daß die Vernunft die Welt beherrscht, daß es also auch in der Weltgeschichte vernünftig zugegangen ist.“9 Für den Historiker – so Ricœur – bleibt diese abrupte Einführung der Vernunft bloße Hypothese – für den Philosophen Hegel ist sie die Ausführung des Satzes aus der „Rechtsphilosophie“: „Was ist, ist vernünftig – und was vernünftig ist, ist.“ In einem Fußnoten-Kommentar zieht Ricœur die Linie zum Theodizeeproblem aus: So kann nur jemand reden, der mit der Behauptung auftritt, die Rolle des Bösen in der Geschichte begriffen zu haben: „Solange das Böse nicht seine Stelle im großen Weltplan gefunden hat, bleibt der Glaube an den Nous, an die Vorsehung oder den göttlichen Plan in der Schwebe.“ Denn in der Tat endet der Abschnitt über den allgemeinen Begriff der Weltgeschichte mit einer verzeitlichten Theodizee. „Unsere Betrachtung ist insofern eine Theodizee, eine Rechtfertigung Gottes, welche Leibniz metaphysisch auf seine Weise noch in abstrakten, unbestimmten Kategorien versucht hat: das Übel in der Welt überhaupt, das Böse mit inbegriffen, sollte begriffen, der denkende Geist mit dem Negativen versöhnt werden; und es ist in der Weltgeschichte, daß die ganze Masse des konkreten Übels uns vor die Augen gelegt wird.“10
Die denkende Betrachtung der Geschichte soll nicht bei einem abstrakten „Endzweck“ verweilen, der Zweck soll sich durch seine Mittel realisieren. „Und hier stoßen wir denn auch auf die allzu berühmte These von der List der Vernunft.“ Ricœur bettet sie in eine allgemeiner gefasste „Theorie der Handlung“ ein. Das handelnde Subjekt soll und muss zu seinem Recht kommen, indes: „Jeder, der etwas tut, erzielt ungewollte Wirkungen, so daß seine Handlungen seiner Intention entgleiten. Als Regel ist festzuhalten, daß in der unmittelbaren Handlung etwas Weiteres liegen kann als in dem Willen und Bewußtsein des Täters.“11 Wenn man davon ausgeht, dass dies die Erfahrung der Generation gewesen ist, die Zeitgenossin der Französischen Revolution war, dann hat man einen historischen Fixpunkt gewonnen, von dem her diese Frage zunächst bei Kant und Schelling gestellt worden ist.12 Geschichte vollzieht sich im eigentlichen Sinne „bewusstlos“: die Menschen sind einem historischen Verhältnis unterworfen, „kraft dessen (sie) durch ihr freies Handeln selbst, und doch wider ihren Willen, zur Ursache von etwas werden müssen, was sie nie gewollt (…) haben.“13 Dieses Verhältnis zur Geschichte hat jedoch bis heute nicht aufgehört zu existieren – und insofern wird die Größe des Hegelschen Versprechens erst recht deutlich. Ricœur resümiert es in Hinblick auf die Stufen der ursprünglichen und der reflektierenden Geschichte: „Für die ‚ursprüngliche‘ oder die ‚reflektierende‘ Geschichte wäre dieses unbeabsichtigt freilich das letzte Wort. Nicht aber für die ‚List‘ der Vernunft, die gerade das Unbeabsichtigte zur Absicht des Weltgeistes werden läßt.“14 Nicht nur im Sinne Sigmund Freuds gäbe es demnach ein „Unbewusstes“ – es gibt ein Unbewusstes auch in der Geschichte – und der Hegelsche Weltgeist klärt uns über seine Zwecke auf. Der Anspruch ist ungeheuerlich. Seine unmittelbare Folge war die Kritik an Hegel. Andererseits: Geht man auf die ungewollten Nebenfolgen des Handelns zurück, die nicht mehr von einer „List der Vernunft“ vermeintlich erhellt werden, so landet man im Helldunkel von unbegriffenen historischen „Hintergrundmetaphern“. Wir kommen auf dieses Problem zurück.
„Man muß bekennen, daß eine Kritik Hegels unmöglich ist, die mehr zum Ausdruck bringen kann als unsere schiere Ungläubigkeit angesichts des entscheidenden Satzes: ‚Der einzige Gedanke, den sie (die Philosophie) mitbringt, ist aber der einfache Gedanke der Vernunft, daß die Vernunft die Welt beherrscht, daß es also auch in der Weltgeschichte vernünftig zugegangen ist.‘ Dies ist das philosophische Credo, das die List der Vernunft bloß apologetisch verstärkt und das der Stufengang in die Zeit projiziert.“ Man konnte Hegel nur verlassen. Ricœur sieht im Ausgang aus dem Hegelianismus – ob mit Kierkegaard, Feuerbach oder Marx, mit der deutschen Historikerschule oder mit Nietzsche – die Grundlage des uns heute geläufigen neueren Denkens. Was können wir nicht mehr mitmachen? „Für uns fällt ein für allemal auseinander, was sich für Hegel deckt: Geist an sich, Entwicklung, Unterschied, die zusammen den Begriff des Stufengangs der Entwicklung ausmachen.“ Nach Ricœur hat Hegel in einem günstigen Moment des „Eurozentrismus“ geschrieben, in einer Zeit, die für uns hinter den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts verschwunden ist: „Der politische Selbstmord Europas während des Ersten Weltkriegs, die ideologische Spaltung im Gefolge der Oktoberrevolution und die neue Randstellung Europas auf der Weltbühne infolge der Abschaffung der Kolonialherrschaft sowie der ungleichen – und wohl auch antagonistischen – Entwicklung, die die Industrienationen dem Rest der Welt entgegensetzt, all das führte zum Tod“ – nicht nur des Eurozentrismus, sondern auch der Hegelschen Philosophie. Der Unterschied hat gegen den Stufengang revoltiert; der Weltgeist zerfällt nach Zweck und Mittel wieder in die membra disjecta einer unmöglichen Totalisierung. „Der Ausdruck ‚List der Vernunft‘ macht uns nicht einmal mehr neugierig: er stößt uns eher ab, wie der mißratene Trick eines auftrumpfenden Zauberkünstlers.“15
Die „Fabel aller Fabeln“ kann nicht geschrieben werden. „Der Ausgang aus dem Hegelianismus bedeutet, daß man darauf verzichtet, die höchste Fabel zu entziffern.“ Dieser Verzicht – wir können nicht mehr wie Hegel, sondern nur noch nach Hegel denken – ist allerdings schmerzhaft. „Mut zur Trauerarbeit“ soll nun von Hegel auf Kant zurücklenken: „Überdies ist eine Rückkehr zu Kant erst nach einem notwendigen Umweg über Hegel möglich. (…) Hegel (…) hat uns die Geduld des Begriffs gelehrt. (…) Und wenn wir auch nicht mehr daran glauben, daß diese großen Vermittlungen in einem absoluten Wissen kulminieren, das in der ewigen Gegenwart der Kontemplation ruht – so ist es doch gerade die Trauer über das absolute Wissen, die uns zur Kantischen Idee zurückführt, die nunmehr den Horizont der historischen Vernunft bildet.“16 Sicherlich – eine „Idee“, die sich auf das „Ganze“ der Geschichte nur „erstreckt“ (vgl. Anm. 4) ist etwas anderes als die Behauptung einer gewussten Vermittlung von Zweck und Mittel; die Erneuerung einer „Theodizee“ ist massiver als eine „Teleologie in praktischer Absicht“, die letztlich Geschichtsphilosophie nur als Hilfskonstruktion für moralisches Handeln ausweist. Man kann – bei aller Kritik – von der „epistemischen Bescheidenheit“ der Kantischen Geschichtsphilosophie sprechen und betonen, dass für ihn teleologische Prinzipien nur regulativ, nicht konstitutiv für die Systematisierung der Erkenntnis sind.17 Und dennoch: Die Vorformen der „List der Vernunft“ in der Unterordnung der „Mittel“ unter einen „Zweck“ finden sich auch schon im 4. Satz der „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“ – und der Sündenfall der Geschichtsphilosophie, das Ineinanderschieben von Spekulation und Empirie ist hier ebenfalls schon angedeutet: „Man sieht: die Philosophie könne auch ihren Chiliasmus haben; aber einen solchen, zu dessen Herbeiführung ihre Idee, obgleich nur sehr von weitem, selbst beförderlich werden kann, der also nichts weniger als schwärmerisch ist. Es kommt nur darauf an, ob die Erfahrung etwas von einem solchen Gange der Naturabsicht entdecke.“18 Es ist dieser Anspruch an die Erfahrung, etwas vom Gange der Naturabsicht zu entdecken, der Kant in die späte Theorie des „Geschichtszeichens“ hineinführt. Das Geschichtszeichen ist noch keine Vermittlung im Hegelschen Sinne; es überlagert lediglich ein historisches Ereignis – die Französische Revolution – mit einem darüberschwebenden erhabenen Enthusiasmus des nicht-involvierten Königsberger Beobachters.