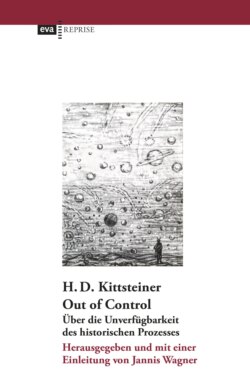Читать книгу Out of Control - H. D. Kittsteiner - Страница 14
VII. Coda
ОглавлениеJedes Musiklexikon weiß es: Coda leitet sich ab vom lat. cauda, Schwanz, Schwänzchen. Dem durchgeführten Motiv fügt sie eine letzte Bestätigung hinzu oder ein Verklingen der Grundtonart. Unser Motiv war die Nicht-Verfügbarkeit der Geschichte, durchgespielt in verschiedenen Sätzen. Der Text über die Frage, ob das Zeitalter der Revolutionen beendet sei, endete mit der Feststellung eines frei flottierenden Enthusiasmus. Der Enthusiasmus, den Kant zuerst an die Revolution gebunden hatte, hat sich mit deren welthistorischem Scheitern wieder von ihr abgelöst. Was wird aus ihm? Er wird an sich selbst revolutionär, der Prophet erschafft sich seine Massen und gebiert das Phantasma der revolutionären „Multitude“. Dem unkontrollierbar rasenden Prozess hat sich ein unkontrollierbar rasendes Denken anverwandelt. Es schleudert Bedenkenswertes, aber auch puren Unsinn aus sich heraus und nivelliert beides in einem kaum zu durchdringenden Wortdickicht. Rhizom. Intermezzo.45 Dieses Zwischenstück ist hier als Endstück, als Coda angehängt. Diese Coda variiert aber nicht den Grundton der hier versammelten Texte, sondern bietet ein kontradiktorisches Scherzo. „In Wahrheit nämlich sind wir die Herren dieser Welt, weil unser Begehren und unsere Arbeit sie fortwährend neu erschaffen. Die biopolitische Welt ist ein unerschöpfliches Zusammenwirken generativer Handlungen, deren Motor das Kollektiv (als Treffpunkt der Singularitäten) ist. Keine Metaphysik (es sei denn eine im Delirium liegende) kann behaupten, die Menschheit sei isoliert und machtlos.“46 Der Leser steht vor diesem Weltwunder ebenso ratlos wie der kleine Beobachter des Kosmos auf dem Titelbild von de Chirico. Unser Sammelband grüßt diese Herren der Welt aus dem Delirium der Metaphysik.
H. D. Kittsteiner
Berlin, 30. Juli 2003
Nachweise
Geschichtsphilosophie nach der Geschichtsphilosophie, in: 19. Deutscher Philosophen-Kongreß Konstanz 1999, erweiterte Fassung in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Heft 1, Berlin 2000, S. 67-77.
Freiheit und Notwendigkeit in Schellings System des transcendentalen Idealismus – Zur Aktualität geschichtsphilosophischen Denkens, in: Moshe Zuckermann (Hg.): Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, Band XXIX, 2000. Geschichte denken: Philosophie, Theorie, Methode, Gerlingen 2000, S. 85-104.
Jacob Burkhardt als Leser Hegels, in: Martin Huber, Gerhard Lauer (Hrsg.): Nach der Sozialgeschichte. Konzepte für eine Literaturwissenschaft zwischen Historischer Anthropologie, Kulturgeschichte und Medientheorie, Tübingen 2000, S. 511-534.
Ist das Zeitalter der Revolutionen beendet? in: Rüdiger Bubner, Walter Mesch (Hrsg.): Die Weltgeschichte – das Weltgericht? Stuttgarter Hegel-Kongreß 1999, Stuttgart 2001, S. 429-447.
Romantisches Denken in der entzauberten Welt, in: Gangolf Hübinger (Hg.): Versammlungsort moderner Geister. Der Eugen-Diederichs-Verlag – Aufbruch ins Jahrhundert der Extreme. München 1996, S. 486 – 507.
Die Form der Geschichte und das Leben der Menschen, in: Alfred Opitz (Hg.): Erfahrung und Form. Zur kulturwissenschaftlichen Perspektivierung eines transdisziplinären Problemkomplexes, Trier 2001, S. 147-160.
Heideggers Amerika als Ursprungsort der Weltverdüsterung, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 4/97. Berlin 1997, S. 559 – 617.
Erkenne die Lage. Über den Einbruch des Ernstfalls in das Geschichtsdenken, in: Karl Heinz Bohrer (Hg.): Sprachen der Ironie. Sprachen des Ernstes, Frankfurt am Main 2000, S. 233-252.
Vom Nutzen und Nachteil des Vergessens für die Geschichte, in: Gary Smith/Hinderk M. Emrich (Hrsg.): Vom Nutzen des Vergessens, Berlin 1996, S. 133-174.
„Gedächtniskultur“ und Geschichtsschreibung, in: Volkhard Knigge/ Norbert Frei (Hrsg.): Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord, München 2002, S. 306-326.
Empire. Über Antonio Negris und Michael Hardts revolutionäre Phantasien. (Originalbeitrag)
1Giovanni Battista Vico: Prinzipien einer neuen Wissenschaft über die gemeinsame Natur der Völker, Hg. Vittorio Hösle, Hamburg 1990, Bd. I, S. 3-39.
2Isabella Far: Giorgio de Chirico, Herrsching 1979, S. 24/124. Es entwickelt sich allmählich zu meinem Lieblings-Titelblatt, denn ich hatte es auch schon für Kittsteiner (Hg.): Geschichtszeichen, Köln, Weimar, Wien 1999 verwendet.
3Arrigo Boito: Mefistofele. Opera in un prologo, quattro atti e un epilogo, 1962 (Ricordi), S. 6 f.
4Immanuel Kant: Allgemeine Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, Akademie-Textausgabe, Berlin 1968, Bd. VIII, S. 30.
5Kant, ebd., S. 17.
6Vico, Prinzipien, a.a.O., Bd. I, S. 142 f.
7Ernst Cassirer: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, Darmstadt 1974, Bd. II, S. 98.
8Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 1965, S. 217.
9Vico, Prinzipien, ebd., S. 149 ff. – Karl Löwith hat diesen Punkt bei Vico herausgearbeitet: „Er begriff den Lauf der Geschichte sehr viel sachgemäßer, nämlich als eine vom Menschen geschaffene Welt, die aber zugleich überspielt wird durch etwas, das der Notwendigkeit des Schicksals näher ist als der freien Entscheidung und Wahl.“ Karl Löwith: Vicos Grundsatz: verum et factum convertuntur. Seine theologische Prämisse und deren säkulare Konsequenzen, in: Ders.: Sämtliche Schriften, Bd. 9, Stuttgart 1986, S. 207.
10H.D. Kittsteiner: Listen der Vernunft. Motive geschichtsphilosophischen Denkens, Frankfurt/M 1998.
11Paul Ricœur: Zeit und Erzählung, Bd. III, München 1991, S. 319 und S. 331.
12Saskia Sassen: Losing Control? Sovereignity in an Age of Globalization, New York 1996, S. XI ff.
13„Yet a global capital market could conceivably be nothing more than a vast pool of money for investors to play with; the power to discipline governments’ economic policy making is not inherent to it.“ Sassen, Losing Control, ebd., S. 41 f.
14Sassen, ebd., S. 49.
15Sassen unter Bezugnahme auf Susan Stranges Buch „Casino Capitalism“, ebd., S. 42.
16G.W.F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts, Hamburg 1955, S. 288 (§ 340).
17Karl Marx: Die deutsche Ideologie, Berlin 1962 (MEW, Bd. 3), S. 37.
18Einige Hinweise finden sich in H.D. Kittsteiner: Geschichtsphilosophie und Politische Ökonomie. Zur Konstruktion der historischen Zeit bei Karl Marx, in: Ders.: Listen der Vernunft, a.a.O., S. 110-131. – H.D. Kittsteiner: Karl Marx. 1968 und 2001, in: Richard Faber/Erhard Stölting (Hrsg.): Die Phantasie an die Macht? 1968 – Versuch einer Bilanz, Berlin 2002, S. 214 – 237.
19H.D. Kittsteiner: Naturabsicht und Unsichtbare Hand. Zur Kritik des geschichtsphilosophischen Denkens, Frankfurt/M, Berlin, Wien 1980, S. 221.
20Um nur ein Beispiel zu geben: E. Günther Gründel: Die Sendung der jungen Generation. Versuch einer umfassenden revolutionären Sinndeutung der Krise, München 1932.
21H.D. Kittsteiner: Die Stufen der Moderne, in: Hertha Nagl-Docekal/Johannes Rohbeck (Hrsg.): Geschichtsphilosophie und Kulturkritik, Darmstadt 2003, S. 91-117. – H.D. Kittsteiner: Die in sich gebrochene Heroisierung. Ein geschichtstheoretischer Versuch zum Menschenbild in der Kunst der DDR, in: Historische Anthropologie. Kultur. Gesellschaft. Alltag, Jg. 2, H. 3 (1994), S. 442-461.
22„Die verschiedenen Formen einer Kultur werden nicht durch eine Identität in ihrem innersten Wesen zusammengehalten, sondern dadurch, daß sich ihnen eine gemeinsame Grundaufgabe stellt.“ Ernst Cassirer: Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der Kultur, Frankfurt/M 1990, S. 337.
23„The determination to extend ‚human empire‘ reflected the most urgent need of an age confronted by dissolving standards of truth and knowledge. Control was the antidote to disarray.“ Theodore K. Rabb: The Struggle for Stability in Early Modern Europe, New York 1975, S. 53.
24„Der Kommunismus unterscheidet sich von allen bisherigen Bewegungen dadurch, daß er die Grundlage aller bisherigen Produktions- und Verkehrsverhältnisse umwälzt und alle naturwüchsigen Voraussetzungen zum ersten Mal mit Bewußtsein als Geschöpfe der bisherigen Menschen behandelt, ihrer Naturwüchsigkeit entkleidet und der Macht der vereinigten Individuen unterwirft.“ Karl Marx: Die deutsche Ideologie.a.a.O. S. 70.
25Karl Marx: Das Kapital, MEW Bd. 23, Berlin 1962, S. 190.
26Friedrich Nietzsche: Nachgelassene Fragmente. Kritische Studienausgabe, Hrsg. G. Colli/M. Montinari, München 1988, S. 45 f. und S. 57. – Letztere Einsicht schreibt Nietzsche Goethe zu.
27Friedrich Nietzsche: Der Wille zur Macht, Hg. Ralph-Rainer Wuthenow, Frankfurt/M und Leipzig 1992, S. 53 (I, 55).
28H.D. Kittsteiner: Erinnern – Vergessen – Orientieren. Nietzsches Begriff des ‚umhüllenden Wahns‘ als geschichtsphilosophische Kategorie, in: Dieter Borchmeyer (Hg.): ‚Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben‘, Frankfurt/M 1996, S. 48-75.
29Vgl. dazu die Interpretation der Gnosis im Lichte von „Sein und Zeit“ bei Hans Jonas und den Umkehrschluss auf gnostische Elemente im Denken Heideggers. Hans Jonas: Gnosis und spätantiker Geist, Erster Teil, Göttingen 1988, S. 107. – Jacob Taubes: Das stählerne Gehäuse und der Exodus daraus oder Ein Streit um Marcion, einst und jetzt, in: Ders.: Vom Kult zur Kultur, München 1996, S. 173.
30Zu erinnern bleibt die tröstliche Versicherung des Jürgen Habermas: „Der Hauptteil des Buches vereinigt sieben Abhandlungen (….). Querverweisungen machen den Zusammenhang der Studien auch äußerlich sichtbar; er selbst muß sich bei der Lektüre erweisen.“ Jürgen Habermas: Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien, Neuwied 1963, Vorwort.
31Das war bereits der Tenor des Sammelbandes: H.D. Kittsteiner: Listen der Vernunft. Motive geschichtsphilosophischen Denkens, Frankfurt/M 1998.
32Vgl. dazu: Georg Lukács: Die Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der großen Epik, Neuwied 1981, S.127.
33Thomas Mann: Briefe, Hg. Erika Mann, Bd.1, 1889-1963, Frankfurt/M, 1961, S. 165.
34Martin Heidegger: Einführung in die Metaphysik, Tübingen 1987, S. 28.
35Heideggers Kehren in den Nationalsozialismus hinein und aus ihm wieder heraus werden genauer befragt in H.D. Kittsteiner: Mit Marx für Heidegger – mit Heidegger für Marx, München 2004 (Fink Verlag).
36Martin Heidegger: Beiträge zur Philosophie. (Vom Ereignis), Frankfurt/M 1989, S. 509.
37Vgl. dazu den Überblick bei Ernst Fraenkel: Amerika im Spiegel des deutschen politischen Denkens, Köln und Opladen 1959.
38„Dieser ‚Save-the-World‘ – Komplex ist die psychologische Grundlage, von der aus sich Roosevelts amerikanischer Angriff auf alle Erdteile und damit der neue Imperialismus der Vereinigten Staaten entwickelt. In ihm vereinigt sich noch einmal jener ganze selbstgerechte Puritanismus, der die Amerikaner veranlaßt, mit naiven moralischen Wertungen die Völker entsprechend ihren eigenen Interessen in gute und schlechte einzuteilen. (…) Die letzte Auswirkung des amerikanischen Mythos mündet also in den Versuch, die ganze Menschheit davon zu überzeugen, daß sie nach amerikanischem Muster leben müsse.“ Giselher Wirsing: Der maßlose Kontinent. Roosevelts Kampf um die Weltherrschaft, Jena 1942, S. 431 f.
39Die „Entstehung des modernen Gewissens“, Kittsteiner, 1991, bricht mit der Spätaufklärung ab. Eine fortsetzende Skizze ist noch erschienen, in: H.D. Kittsteiner: Das deutsche Gewissen im 20. Jahrhundert, in: Richard Faber (Hg.): Politische Religion – religiöse Politik, Würzburg 1997, S. 227-242. Teilweise überschneidet sich dieser Text mit dem hier abgedruckten.
40Rudolf Otto: Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen, München 1979, S. 42 ff.
41Paul Ricœur: Zeit und Erzählung, Bd. III, a.a.O., 1991, S. 303 f.
42Ricœur, ebd., S. 304 ff.
43Ricœur, ebd., S. 344 f.
44Ricœur, ebd., S. 409.
45„Ein Rhizom hat weder Anfang noch Ende, es ist immer in der Mitte, zwischen den Dingen, ein Zwischenstück, Intermezzo.“ Gilles Deleuze/ Félix Guattari: Kapitalismus und Schizophrenie. Tausend Plateaus, Berlin 1992, S. 41.
46Michael Hardt/Antonio Negri: Empire. Die neue Weltordnung, Frankfurt/New York 2002, S. 394.