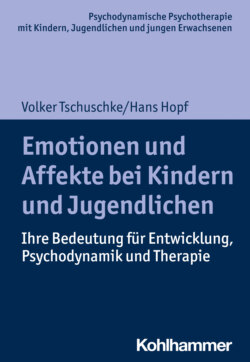Читать книгу Emotionen und Affekte bei Kindern und Jugendlichen - Hans Hopf - Страница 22
4.2 Triebe und Körperreize – Ursprünge der Emotionen?
ОглавлениеWie bereits dargelegt, basiert Freuds Modell auf der Annahme, dass Triebspannungen bei der Entstehung von Affekten entscheidend seien. Er war zu seiner Zeit nicht alleine mit seiner körperbezogenen Auffassung von Emotionen und Affekten, wie die Psyche zu Beginn des letzten Jahrhunderts generell von Psychiatern und Ärzten als grundsätzlich körperverankert angesehen wurde – wenn auch dualistisch – (z. B. Kretschmers Konstitutionspsychologie, 1977), was in weit zurückreichenden Auffassungen vom menschlichen Charakter wurzelte (Hippokrates, 460 bis 377 v. Chr.; Galenus von Pergamon 129 n. Chr.).
Einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Verständnis von Gefühlen stellten die Annahmen von William James und Carl Lange dar. Ihrer Theorie zufolge basieren Gefühle grundsätzlich auf Körpereizen. Der US-amerikanische Psychologe William James von der Harvard University entwickelte die Theorie in seinem Werk »Principles of Psychology« (1890). Körperliche Reaktionen erfolgen demnach direkt auf äußere, aufregende Ereignisse hin, und das Gefühl dieser körperlichen Veränderungen sei die Emotion. Wie genau die Körperwahrnehmung das Gefühl dann produziert, wird in seiner Theorie nicht näher erläutert. Zeitgleich mit James propagierte der dänische Neurophysiologe Carl Lange (1887/2013) einen theoretisch sehr ähnlichen Standpunkt. Die durch die Theorie aufgeworfene und ungeklärte Frage der James-Lange-Theorie – ähnlich dem Henne-Ei-Problem – lautet: Was kommt zuerst?
Auch Walter B. Cannon studierte und lehrte an der Harvard University, allerdings später als James. Cannon und sein Doktorand Bard verwarfen basale Annahmen der James-Lange-Theorie, indem sie der Auffassung waren, dass der Ausfall von Feedback über viszerale Reize offensichtlich keine Auswirkungen auf einen emotionalen Ausdruck hatte. Somit hatte der Körper ihrer Theorie zufolge keine entscheidende Beteiligung am emotionalen Erleben.
Clark L. Hull (1952) ging – wie Freud – von einer Triebtheorie aus, derzufolge alle menschlichen Handlungen »energetisiert« seien durch Triebe. Seine Motivationstheorie basierte auf mathematischen und quantitativen Elementen, die gleichwohl in sich nicht fehlerfrei blieb und weiter keine große Beachtung fand. Allerdings bahnte Hull der Entwicklung einer mathematischen Lerntheorie den Weg und somit auch der später daraus hervorgegangenen Verhaltenstherapie. Eine ebenfalls sehr abstrakt-radikale Position nahm Burrhus F. Skinner ein. Alles, was gefühlt werde, basiere nicht auf einer irgendwie gearteten nichtphysikalischen Welt eines Bewusstseins, Geistes oder sonstigen mentalen Lebens. Was wir Menschen fühlten, gehe nicht auf Introspektion zurück. Stattdessen könnten wir uns nur verstehen, indem wir unsere genetische und umgebungsabhängige Geschichte betrachteten. Mentalistische Sichtweisen hätten die Psychologie beschädigt. Falls das, was ein Individuum tue, auf irgendwelche inneren Prozesse zurückgeführt werde, sei jegliche weitere Untersuchung sinnlos. Diese extrem radikale Position führte nach dem Zweiten Weltkrieg zum Aufschwung der Lerntheorie als eines Gegenentwurfs zur – aus Sicht von Skinner – spekulativen Sichtweise psychodynamischer oder humanistischer Theorien vom Menschen und zum Aufschwung der frühen Verhaltenstherapie.
Philip Zimbardo und Richard J. Gerrig sind die Autoren des bekanntesten Psychologie-Lehrbuchs. Beide forschten an der Stanford University zu unterschiedlichen psychologischen Fragestellungen. Sie sind der Auffassung, dass Triebe interne Zustände des Organismus bewirken, die bestimmte physiologische Prozesse in Gang setzten. Daraus ergebe sich das Motiv für lebende Organismen, einen Zustand der Homöostase bzw. des Gleichgewichts wiederherzustellen (2004). Auch das traditionell immer wieder aktualisierte Dorsch-Lexikon der Psychologie definiert das Affektsystem als mit Organempfindungen verknüpft (Bergius, 2014, S. 102).