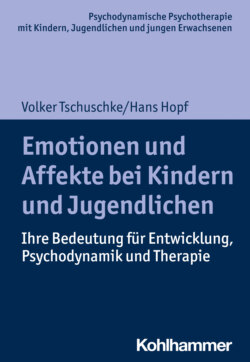Читать книгу Emotionen und Affekte bei Kindern und Jugendlichen - Hans Hopf - Страница 9
1.2 Das Limbische System als Zentrale emotionaler Eindrücke
ОглавлениеDer wichtigste Aspekt der komprimiert dargestellten Informationen zu den für unser Thema wichtigen Hirnfunktionen besteht darin, das Wechselspiel zwischen dem Limbischen System im Zwischen- bzw. Mittelhirn und dem Neocortex zu verstehen. Sinneseindrücke werden zentral im Limbischen System unter Hinzuziehung der im Neocortex abgespeicherten Informationen früherer Erlebnisse und Eindrücke in Gefühle und Handlungsreaktionen umgesetzt. Sinneseindrücke gelangen über verschiedenste Kanäle in das Gehirn.
»Hat die Information einmal den Cortex erreicht, so wird sie auch hier über multiple parallele Systeme weitergeleitet, die ihrerseits unterschiedliche Funktionen haben. Hier sei daran erinnert, dass das visuelle System im Cortex eine ventrale und eine dorsale Route hat, wobei die ventrale durch den Temporallappen und die dorsale durch den Parietallappen führt. Der erstgenannte Weg ist bei der Objekterkennung von Bedeutung, der zweite bei der räumlichen Zuordnung von Objekten. Angesichts dieses allgemeinen Organisationsprinzips des Gehirns gibt es sehr wahrscheinlich auch multiple Systeme – und zwar sowohl auf cortikaler als auch auf subcortikaler Ebene – die zu unserem Erleben von Emotionen beitragen« (Kolb & Whishaw, 1996, S. 355).
Das Limbische System ist – als Teil des Zwischen- bzw. Mittelhirns – auf die vielfältigste Art und Weise mit dem Neocortex verknüpft. Die Hauptbahn zum Neocortex verläuft zur orbitalen Oberfläche des präfrontalen Cortex. Speziell die Bedeutung dieser Verbindung könne man nicht hoch genug einschätzen, so Eccles (1987).
Der Entwicklungsweg von zunächst einmal trivialen Umgebungsreizen des Organismus bis hin zu subjektiv hoch bedeutsamen emotionalen Empfindungen für das Individuum und seinen Reaktionen zeigt Abbildung 1.2 im groben Überblick ( Abb. 1.2; Goeppert, 1996). Alle prozessualen Reizverarbeitungen im Bereich der objektiven Sinnesphysiologie basieren auf naturwissenschaftlich einfach zu erklärenden Reizweiterleitungen und Umschaltungen auf der Basis von elektrophysiologischen und biochemischen Vorgängen.
Abb. 1.2: Bereich der Verarbeitung objektiver Sinneseindrücke und Übergang zu subjektiver Sinnesphysiologie (nach Goeppert, 1996, S. 193)
Die entscheidende psychologische Umschaltung erfolgt dann im Übergangsbereich zur subjektiven Sinnesphysiologie. Hier werden auf bisher nicht vollständig geklärte Art und Weise physiologische und/oder biochemische Prozesse in höchst subjektive Gefühlsqualität verwandelt. Dasselbe Lied kann unter kontrolliert exakt gleichen Bedingungen (Räumlichkeit, Licht- und Temperaturverhältnisse, Tageszeit, Abspielgerät, Lautstärke etc.) abgespielt werden, und die eine Versuchsperson erlebt keine besonderen Gefühle, während die nächste Person einen wohligen Schauer verspürt und sie Gefühle freudiger Erregtheit ergreifen (etwa weil beim Hören des Liedes die Erinnerung an ein schönes Erlebnis wachgerufen wird).
Roth (2001) beschreibt die Abfolge von der Sinneswahrnehmung extraorganismischer Ereignisse bis hin zum bewussten Erleben.
»Ein positiv oder negativ erregendes Ereignis wird zuerst subcortical vorbewusst verarbeitet, und zwar bei einer visuellen Wahrnehmung durch die Retina, den lateralen Kniehöcker des Thalamus und den Colliculus superior des Mittelhirns (um die wichtigsten subcorticalen visuellen Zentren zu nennen). Vom lateralen Kniehöcker und vom Colliculus superior aus laufen unterschiedliche Aspekte des Seheindrucks zu limbischen Zentren, z. B. zur basolateralen Amygdala, und von dort aus unbewusst zu den vegetativen Zentren, wo sie – falls nötig – die notwendigen Reaktionen auslösen.
Gleichzeitig laufen die Erregungen vom lateralen Kniehöcker zur primären Sehrinde und von dort zu temporalen und parietalen visuellen Cortexarealen sowie in einem Umweg vom Colliculus superior aus über das Pulvinar des Thalamus ebenfalls zu visuellen Arealen. Im Cortex verbinden sich diese ›neutralen‹ visuellen Erregungen mit deklarativen Gedächtnisinhalten, die durch den Hippocampus und die ihn umgebende entorhinale, perirhinale und parahippocampale Rinde aktiviert wurden. Aufgrund der Tätigkeit des basalen Vorderhirns werden sie mit erhöhter Aufmerksamkeit versehen, und schließlich werden sie – vermittelt durch die Aktivität von Amygdala und mesolimbischem System und über deren Projektionen in den Cortex – mit Inhalten des emotionalen Gedächtnisses verknüpft.
Aufgrund der komplexen Interaktion vieler corticaler und subcorticaler Zentren entsteht dann in den entsprechenden assoziativen visuellen Arealen die bewusste, inhaltsreiche Emotion« (Roth, 2001, S. 172 f.).
Das Gefühl bzw. die Emotion, die ein Mensch empfindet, ist also stets eine hochkomplexe Kette einer Abfolge von Reizen der Umgebung des Organismus, die über Sinnesorgane in Zentren des Gehirns umgeschaltet werden, wo sie zunächst unter Hinzuziehung basaler unbewusster Einschätzungen der situativen Lage mit abwesender oder gegebener Gefahr bzw. als angenehme oder unangenehme Situation (Stammhirn- und Mittelhirnareale) eingeschätzt werden. Gleichzeitig laufen unter Hinzuziehung präfrontaler Areale blitzschnelle Abklärungen über thalamische Verbindungen zum Großhirn, wo Erinnerungen der subjektiven Lerngeschichte (deklarative Gedächtnisinhalte) hinzugezogen werden, was dann durch efferente Prozesse im limbischen System weiterverarbeitet und letztlich wiederum durch Projektionen in die assoziativen visuellen Bereiche des Cortex unter Hinzuziehung des emotionalen Gedächtnisses zur bewusst empfundenen Emotion wird.
Man kann sich vorstellen, dass Emotionen eine entscheidende Rolle für die Tiefe der Einspeicherung ins Gedächtnis und die Leichtigkeit des Erinnerns spielen (Roth, 1996). Situatives wird leichter und dauerhafter abgespeichert, wenn es für das Individuum emotionale Bedeutung hat (Spitz, 1980).