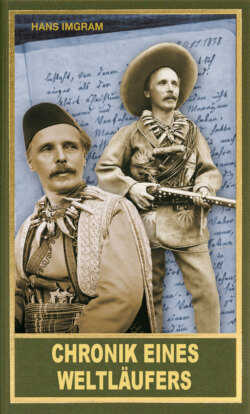Читать книгу Chronik eines Weltläufers - Hans Imgram - Страница 14
7. ZWEITE OSTASIEN-REISE (1865-1866)
ОглавлениеFreitag, 10. November 1865:1
Wir hatten mit unserem guten Dreimaster ‚Poseidon‘ vor nunmehr sechs Wochen Valparaiso verlassen, um nach Hongkong zu segeln. Ungefähr auf der Höhe von Ducir und Elisabeth schlug der Passat in einen Orkan um, wie ich ihn von solcher Stärke und Unwiderstehlichkeit während meiner vielen Fahrten noch niemals erlebt hatte. Jetzt lag unser Dreimaster gestrandet draußen zwischen den verräterischen Korallenklippen. Ich war auf dem Schiff der einzige Fahrgast gewesen, mit dem sich der sonst sehr schweigsame Kapitän Roberts unterhalten hatte. Er nahm mich auch mit, als ihm unser Wächter von der Anhöhe zurief, dass ein Segel in Sicht sei. Durch das Fernrohr sah ich eine malaiische Praue auf unsere Insel zukommen, die von weiteren fünfzehn Booten verfolgt wurde. Wir eilten hinunter, teilten unsere Mannschaft in zwei Abteilungen, denn wir wussten nicht, wie sich die Dinge entwickeln würden. Das erste Boot fuhr durch den Korallenring in das ruhige Wasser der Bucht. Der Verfolgte zog sein Boot halb aus dem Wasser, hing sich den Köcher über, nahm den Bogen zur Hand und griff dann nach seiner Flinte. Ich machte mich bemerkbar und kam mit ihm in ein kurzes Gespräch, wobei er mir erzählte, dass er Potomba heiße, in Papetee der Hauptstadt von Tahiti wohne, ein Ehri, ein Fürst des Landes sei und von seinem Schwiegervater verfolgt werde, der ihn töten wolle, weil er, Potomba, ein Christ sei. Soeben versuchte das erste Boot seiner Verfolger die Einfahrt durch den engen Kanal. Da zeigten sich alle Matrosen. Als die Verfolger sahen, dass die Insel von einer ganzen Truppe europäisch gekleideter Männer besetzt war, zogen sie schleunigst die Segel wieder auf und ruderten von dannen. Um Hilfe herbeizuholen, wollte mich Potomba in seinem kleinen Boot mit nach Tahiti nehmen, das wir vielleicht in zwei Tagen erreichen würden.
Sonntag, 12. November 1865:
Wir langten nach zwei Tagen in Tahiti an. Jetzt nun lag die herrliche Insel vor uns und Papetee hob sich immer mehr hervor. Im Hafen lag eine Reihe von Seeschiffen, die durch die breitere Einfahrt Zugang gefunden hatten. Der Bau des einen kam mir bekannt vor. Droben in den Wanten hing ein Mann, nämlich der sehr wackere und ehrenwerte Kapitän Frick Turnerstick. Er versprach mir, die gestrandete Mannschaft der ‚Poseidon‘ zu holen, sobald er morgen früh mit der Ebbe auslaufen konnte. Dann fuhren wir an Land, wo Potomba von seinem Bruder Potai hörte, dass sein Schwiegervater – der Heiden-Priester Anoui – Potombas Frau Pareyma, entführt hatte, da dieser die Hochzeit seiner Tochter mit einem Christen nicht anerkannte. Dabei hatte er Potombas Mutter erstochen. Pareyma sollte heute noch in Tamai auf der Insel Eimeo mit Matemba, dem Todfeind Potombas, verheiratet werden. Die beiden Brüder wollten auf Turnersticks Schiff Tahiti verlassen und nach Samoa gehen, nachdem alles Hab und Gut verkauft worden war. Doch zuvor wollte Potomba noch auf die Nachbarinsel, um seine Frau wiederzuholen. Ich informierte Kapitän Turnerstick von allem und stieg mit dem Ehri in ein Boot, das wohl vier Personen fassen konnte. Er hisste das Segel und wir flogen über das ruhige Wasser und nahmen dann Kurs auf Eimeo. Wir erreichten eine Brotfruchtpflanzung, die uns gute Deckung gewährte. Vor einem durch seine Größe auffallenden Haus stand ein mit Blumen geschmückter Altar mit zwei Götzenbildern, an dem vermutlich die Trauungsfeierlichkeit vor sich gehen sollte. Ich schlich mich an das Haus heran. Wenn das junge Weib, das ich da erblickte, wirklich Pareyma war, so konnte ich die Liebe begreifen, die Potomba für sie hegte. Sie erschrak zuerst, als ich sie ansprach und ihr sagte, dass Potomba in der Nähe sei und sie retten wollte. Sie solle nur alles tun, was ihr Vater wolle. Als auf der anderen Seite des Hauses ein Tamtam erscholl, kehrte ich zu Potomba zurück. Pareyma wurde zum Altar geleitet, an dem ihr Vater Anoui die Zeremonie beginnen wollte. Diese war in vollem Gange, als sich Potomba durch die Menge der Zuhörer drängte und vor dem Altar erschien. Mit einem raschen Sprung stand er auf dem Altar und zerstörte die Götzenbilder. Wir rannten zum Boot, fuhren weg und landeten später erneut auf Eimeo, in Alfaraeita, wo wir bis zu der bald hereinbrechenden Dunkelheit blieben. Dann brachen wir auf. Der Ehri hatte sich vorher eine beträchtliche Menge Fische gekauft und sie mit ins Boot genommen. Wir ruderten hinaus auf See und er warf nach und nach die Fische ins Wasser, bis sich mehr als ein halbes Dutzend Haie um unser Boot tummelte. Nun warteten wir auf die Hochzeitsflotte, die von Eimeo nach Tahiti hinüberfahren würde.
Montag, 13. November 1865:
Mitternacht war wohl schon vorüber, als wir die beleuchteten Boote bemerkten; im ersten saßen drei Personen: Matemba, Anoui und Pareyma. Wir erreichten es rasch und Potomba rief Pareyma, zu uns zu kommen. Die Gerufene erhob sich und schnellte über den Ausleger zu uns ins Boot. Der Ehri empfing sie mit dem linken Arm und ließ sie niedergleiten, dann bog er sich über Bord und zerschnitt mit zwei raschen Zügen die Baststricke, die den Ausleger des Hochzeitsbootes mit den Querstangen verbanden. Das Boot kenterte, Matemba und der Priester stürzten ins Wasser und wurden augenblicklich von den Haien verschlungen. Die wütenden Insassen der Prauen versuchten uns einzuholen. Es gelang ihnen nicht. In fünf Minuten hatten wir den ‚Wind‘ erreicht, der sein Fallreep niederließ. Am Morgen stachen wir in See.
Samstag, 18. November 1865:
Fünf Tage später befand sich Kapitän Roberts mit seinen Marsgasten und allem geretteten Gut bei uns an Bord, dann segelte der ‚Wind‘ nach Nord bei West, um die Samoa-Inseln zu erreichen.
Freitag, 5. Januar 1866:
Nachdem wir Potomba, den Ehri von Tahiti, seine liebliche Pareyma, seinen Bruder Potai und den Diener Ombi auf der Samoa-Insel Upolu abgesetzt und den Kapitän Roberts vom ‚Poseidon‘ mit seinen Marsgasten da gelandet hatten, waren wir einige Tage vor Anker geblieben und dann nach den Marianen gegangen, von wo aus wir nach den Bonin-Inseln segelten. Wir hatten sie aber noch nicht erreicht, als der Kapitän plötzlich einige Striche mehr nach Südwest abfallen ließ. Ein Taifun war im Anzug und da ich einen solchen einmal ‚hautnah‘ erleben wollte, ließ ich mich am Mast festbinden. Ich hatte noch niemals einen solchen Aufruhr der Naturkräfte erlebt und erwartete alle Sekunden, von meinem Haltpunkt losgerissen und in die kochende See geschleudert zu werden. Jetzt legte der Taifun mit doppelter Kraft los. Ein blendender Blitzschlag zuckte nieder, es erfolgte ein Donnerschlag, unter dem die See erkrachte und die Erde zu bersten schien und dann wühlte sich der Taifun ins Wasser. Wir wurden vom Wogenstrudel gepackt und um unsere eigene Achse gedreht. Ein entsetzliches Krachen und Prasseln und Schmettern, dann schwiegen die Lüfte so urplötzlich, und nur das Branden der Wogen gegen unsere Planken ließ sich vernehmen. Der Fockmast war gebrochen, das Schiff lag nach Starbord hinüber, weshalb die Taue sofort gekappt werden mussten. Auf dem Deck sah es fürchterlich aus. Und es war Wasser im Raum. Bereits nach zwei Minuten waren die Pumpen im Einsatz, während der Schiffzimmermann das Leck aufzufinden und zu verstopfen suchte. Wir mussten den nächsten Hafen anlaufen, um die Taifun-Schäden zu beheben. Das würde bestimmt einige Tage in Anspruch nehmen. Gegen Abend sahen wir die Peel-Insel, die südlichste der drei großen Bonin-Inseln, auf der auch der Haupthafen liegt, vor uns auftauchen, und eine halbe Stunde später gingen wir in Port Lloyd vor Anker.
Samstag, 6. Januar 1866:
Am andern Morgen gab es sehr viel auf unserem braven ‚The Wind‘ zu schaffen. Das Leck konnte nur von außen vollständig beseitigt werden, und da auf Peel-Island von einem Dock keine Rede war, so waren Taucherarbeiten erforderlich. Am Nachmittag ging ich mit Turnerstick auf Ziegenjagd in die Berge. Dabei konnten wir einen Chinesen retten, dessen Dschunke vom Taifun zerstört worden war. Die ganze Besatzung war umgekommen, nur ihn allein hatten die hohen Wellen über eine Felsklippe an einen Binnensee unter einer steilen Felswand gespült. Ohne uns wäre er nie gefunden worden. Er hieß Kong-ni und stammte aus Kanton.
Samstag, 20. Januar 1866:
Der Taifun hatte das ganze Gebäude des Schiffes arg zusammengerüttelt. Um nur die Hauptschäden wiederherzustellen, bedurften wir eines Aufenthaltes in Port Lloyd von zwei Wochen. Dann endlich gingen wir in See nach Kanton, wo die Hauptausbesserungen bewerkstelligt werden sollten.
Dienstag, 30. Januar 1866:
Die Granitfelsen der Insel, auf denen Hongkong erbaut ist, stiegen vor uns empor. Die uns begegnenden Fahrzeuge waren längst immer zahlreicher geworden, und als wir die Landspitze erreichten, hinter der Viktoria liegt, sahen wir im wahrsten Sinn des Wortes Tausende von Dschunken um uns her, teils mit Fischerei und teils mit Küstenhandel beschäftigt. Wir gingen in voller Takelung vor Anker. Kong-ni entpuppte sich als Mandarin und er wollte mir den Weg ebnen, dass ich als ‚angenommener Chinese‘ jederzeit durch das Land reisen konnte, ohne in Lebensgefahr zu geraten. Als er uns für sechs Tage verließ, hängte er mir eine Kette um, die mich vor den Flusspiraten schützen sollte.
Mittwoch, 31. Januar 1866:
Am frühen Morgen holte mich Turnerstick aus der Koje. Er hatte ein Lohnboot gemietet, das uns zuerst nach Hongkong bringen sollte, der Niederlassung der Engländer. Wir spazierten miteinander durch die Straßen der chinesischen Stadt. Nachdem wir etwas Geld gewechselt hatten, wollte Turnerstick weiter, und zwar mit dem gemieteten Boot bis hinauf nach Kanton. Eine Viertelstunde später trieben wir in unserem Bambuskahn mit der Flut stromauf. Unterwegs wollten wir eine von vier Pagoden besuchen. Der Pagodenwärter zeigte uns das Heiligtum, dann spielte ich auf zwei chinesischen Instrumenten unsere westliche Musik, die die Zuhörer zu begeistern schien. Als wir weiterwollten, warnte uns der Pagodenwärter vor den ‚Drachen‘, den Flusspiraten. Wir wurden tatsächlich überfallen und zu einem Gebäude geschleppt, konnten aber nicht nur uns selbst, sondern auch eine holländische Köchin befreien, die mit ihrer portugiesischen Herrin verwechselt worden war. Bei unserem Fluchtversuch verfolgte man uns. Es kam am Ufer zu einem mächtigen Handgemenge und wir konnten uns nur erwehren, indem wir zu den Revolvern griffen und schossen. Die Drachenmänner waren verschwunden und mit ihnen auch unser Boot.
Donnerstag, 1. Februar 1866:
Am Morgen kam eine holländische Pinasse heran, die stromabwärts segelte. Das traf sich glücklich. Ihr gaben wir unsere ‚Meisje‘ mit, während wir beide ja weiter stromaufwärts wollten. Und wirklich kam bereits nach kurzer Zeit eine kleine englische Privatjacht den Fluss heraufgedampft. Der Kapitän versprach, mit uns die Drachenmänner hochzunehmen, und wir durchsuchten die ganze Tempelanlage, fanden aber keinen einzigen mehr; sie waren alle ausgeflogen. Wir bestiegen die Jacht und dampften stromaufwärts. Sie legte in der Nähe der englischen Faktorei an. Wir ließen uns ans Land rudern. In der Menschenmenge, die uns umgab, geriet meine Kleidung in Unordnung, und das Lung-yin-Zeichen kam zwischen zwei Knopflöchern zum Vorschein. Ein Mann sah es. Er gehörte zu den Flussdrachen und sollte alle Genossen, die er traf, um Mitternacht in die ‚Herberge zu den zehntausend Herrschern‘ bestellen. Turnerstick, der trotz meiner Warnung in die verbotene Innenstadt wollte, ließ sich nicht halten. Wir kamen an eine Opiumkneipe, wo wir in eine Schlägerei gerieten, bis die Polizei kam und uns mit in den Gemeindepalast nahm. Ich musste dem Richter von unserem gestrigen Abenteuer mit den Flussdrachen erzählen, und als er unsere Namen hörte, sagte er, dass ihm sein Neffe Kong-ni von uns erzählt habe. Er versprach mir, heute Nacht die ‚Herberge zu den zehntausend Herrschern‘ aufzusuchen und die Drachenmänner zu verhaften. Wir beide aber sollten morgen früh zu Kong-ni nach Li-ting gehen, wo sich meiner Kenntnis nach auch das Oberhaupt der Flussdrachen aufhielt.
Freitag, 2. Februar 1866:
Wir frühstückten mit dem Richter. Er überreichte mir ein Empfehlungsschreiben, das ich seinem Bruder Phy-ming-tsu übergeben sollte. Bis nach Li-ting war es im Palankin (Tragsessel) eine Tagesreise. Das Gefolge bestand aus mehr als dreißig Menschen. Eben als die Sonne unterging, sahen wir Li-ting vor uns liegen. Es war eine kleine Stadt, deren Häuser aber sehr weit auseinanderlagen. Vor dem Ort sah ich ein stattliches Bauwerk, dem man es anmerkte, dass es der Sommersitz eines chinesischen Großen war. Unser Zug trabte weiter, einem burgähnlichen Gebäude zu, vor dessen Tor er anhielt. Wir wurden von Kongni und seinem Vater empfangen. Ich zog das Schreiben seines Bruders hervor und übergab es ihm. Dann wurden uns unsere Räumlichkeiten angewiesen. Anschließend sollten wir mit dem Hausherrn zu Abend essen. Später konnte ich im Garten ein Gespräch zwischen Kong-nis Vater und einem anderen Chinesen belauschen. Im Laufe des Gespräches stellte ich fest, dass der andere der ‚Kiang-lu‘ war, der Anführer der Flussdrachen.
Samstag, 3. Februar 1866:
Am Morgen sagte man uns, dass wir heute zu einem einflussreichen Freund kommen sollten. Ich konnte mich noch ein wenig umsehen und wollte erkunden, wovon ich gestern Abend gehört hatte, denn an der Drachenschlucht, die erwähnt worden war, hing vielleicht mein Schicksal; ich musste sie finden. Als ich sie ausfindig gemacht hatte, stellte ich fest, dass dort eine Frau in einer Senke gefangen gehalten wurde, der ich mein Taschenmesser hinunterwarf. Als ich zum Haus zurückkehrte, wartete man bereits auf mich. Wir bestiegen die Tragsessel und gelangten durch die Stadt nach dem Landhaus, das wir bei unserer Ankunft bemerkt hatten. Man zeigte uns den Garten und Pferde, von denen ich ein wildes, kaschgaraner2 Rassepferd zuritt. Ein Gespräch mit der Tochter des Hauses führte zu einem Eklat. Man nahm mich und Turnerstick gefangen und brachte uns in die Drachenschlucht, wo wir von einem Erker aus in das Loch hinabgelassen wurden. Dort sollten wir elendig verschmachten. Ein Glück, dass ich am Morgen der Gefangenen – es war die Frau des Kianglu, der sie loswerden wollte, weil sie Christin geworden war – mein Messer zugeworfen hatte. Dadurch konnten wir uns schnell von unseren Fesseln befreien und sahen unsere Rettung darin, dass wir versuchten, die Kaminwand hochzuklettern. Geräuschlos erreichten wir den Rand des Kamins. Der Kiang-lu stand mit dem Rücken gegen uns, ganz allein oben auf der Plattform; er fuhr herum und erblickte uns. Er stand am Rand der Plattform. Dorthin durfte er den Kampf nicht tragen lassen, deshalb sprang er mir mit einem Satz entgegen. Er rannte mit der Brust gegen meine vorgestreckten Fäuste und taumelte zurück. In diesem Augenblick holte Turnerstick aus und versetzte ihm mit seiner eisernen Faust einen Schlag vor den Kopf und der Kiang-lu stürzte rückwärts über die Felskante hinunter in den Abgrund. Ein dumpfer Ton drang herauf: der Körper des gefürchteten Strompiraten war unten aufgeschlagen und zerschellt. Wir holten die Frau herauf und brachten sie zu dem Landhaus. Dort hatte sich ihre Tochter Kuing mit dem Sohn des Bürgermeisters heimlich getroffen. Ihm sagten wir, dass Kuing und ihrer Mutter vielleicht Gefahr drohe, aber er meinte, sein Vater sei mächtig genug, sie zu beschützen. In den Räumen des Kiang-lu fanden wir unsere Waffen und alles, was man uns abgenommen hatte. Dann mussten wir fliehen. Wir eilten nach der Hofseite des Gebäudes und sprangen hinunter. Ich öffnete den Stall und zog zwei Pferde heraus und wir entkamen in die Nacht.
Montag, 5. Februar 1866:
Bereits am Nachmittag ritten wir in Kanton ein und am anderen Abend, also heute, befanden wir uns mit unseren zwei Pferden an Bord des ‚The Wind‘.
Donnerstag, 15. Februar 1866:
Wir besuchten nach unserer Rückkehr aus Kanton darauf in Makao das ‚tapfere Meisje‘, deren Herrschaft uns davon überzeugte, von einer Anzeige gegen die chinesischen Flusspiraten abzusehen. Der Konsul, an den wir uns dann wendeten, war derselben Ansicht. Wir verzichteten also darauf, über Kong-ni etwas Näheres zu erfahren, und lichteten die Anker, sobald ‚The Wind‘ ausgebessert worden war und neue Ladung genommen hatte.
Mittwoch, 21. Februar 1866:
Turnerstick segelte als sein eigener Reeder nordwärts in die den Ausländern offenen Hafenplätze an, bis wir in der Bai von I-mo-tung Anker warfen. Von hier aus wollte Turnerstick hinüber nach den Riu-kiu-Inseln und Japan, wozu ich keine Lust hatte, denn ich gedachte ein wenig landeinwärts zu gehen. Bis über den Chingan hinauf nach der Gobi war es nicht sehr weit, und da ich im Besitz von Papieren war, mit deren Hilfe ich für einen Chinesen gelten konnte, so entschied ich mich am Ende doch, mich von dem alten, wackeren Freund zu trennen, um wenigstens für einige Tage Wüstenluft zu atmen. Ich brachte also meine wenigen Habseligkeiten in Tien-tsin unter. Dann begab ich mich nach einer Herberge, wo ich zwei Männer traf. Einer von ihnen, er hieß Schangü, erbot sich, mein Führer ins Landesinnere zu sein. Ich versorgte mich noch mit Verschiedenem, was mir fehlte, suchte mir dann eins der Pferde aus und war nun zum Aufbruch bereit.
Sonntag, 25. Februar 1866:
Ich hatte bereits in meinen Knabenjahren von dem ‚Wunderwerk‘ der chinesischen Mauer Schilderungen gelesen. Leider aber sah ich mich enttäuscht, als wir sie nach einigen Tagen erreichten, denn was ich von ihr erblickte, war nur ein wüster Schutthaufen, von dem aus einzelne Seitenstreifen noch hier und dort in der Ferne verliefen. Ich lernte sie gerade an einer Stelle kennen, wo sie aufgehört hat, als Mauer zu dienen. Gegen Abend machten wir bei einer Herde Halt, die aus Pferden, Ochsen, Eseln und Schafen bestand und von Hirten getrieben wurde, die unter dem Befehl eines Lamas standen. Wir erzählten, dass wir nach Bogdy-ola wollten, wo ein ‚Heiliger‘ in einer Höhle wohnte. Der Lama, der ein Schabi, also Schüler eines buddhistischen Klosters war, wollte dem ‚Heiligen‘ den Erlös aus dem Verkauf der Herde bringen, damit dieser dort ein Kloster bauen konnte.
Montag, 26. Februar 1866:
Wir kamen dadurch ins Erzählen über unsere Religionen und die Sterne stiegen höher und höher; das Feuer verlöschte, es wurde kalt, endlich graute der Morgen und wir verabschiedeten uns von dem Schabi. Je mehr wir uns dem Wohnort des großen Heiligen näherten, desto reger wurde der Verkehr. Reiter auf Pferden, zuweilen auch bereits auf baktrischen3 Kamelen, begegneten uns oder eilten von rechts und links derselben Richtung entgegen. Der Schabi hatte uns erzählt, dass acht Russen bereits seit langer Zeit Schüler des großen Heiligen seien, und ich muss sagen, dass ich begierig auf die Bekanntschaft dieser Russen war. Es war mir nicht möglich, zu glauben, dass acht Christen eines solchen geistigen Rückschritts fähig sein könnten. Endlich erreichten wir Bogdy-ola. Es war nichts als ein großes und sehr weitläufiges Zeltlager. Schon von Weitem konnte ich die ‚Padma‘ des Heiligen erkennen. Der Berg stieg nach der Ebene zu fast senkrecht empor und trug hoch oben in der Nähe des Gipfels eine Höhle. Von der Höhle hingen zwei Seile herab, die den einzigen Weg bildeten, zum Heiligen zu gelangen. Übrigens war das Leben und Treiben des Ortes kein rein religiöses. Es hatten sich chinesische Krämer und Geldwechsler eingefunden.
Nachdem wir uns von dem Ritt ein wenig ausgeruht hatten, traten wir in ein Teezelt, das so überfüllt von Menschen war, wie man es auf deutschen Jahrmärkten zu sehen bekommt. Hinter uns saßen zwei Russen, die Polnisch sprachen. Wie ich hörte, mussten sie entsprungene Häftlinge sein, die sich als angebliche Schüler des Heiligen ausgaben, ihn jedoch berauben wollten. Da fiel auch der Name Mieloslaw, der mir so bekannt vorkam. Als wir außerhalb des Zeltes waren, sah ich ihn, es war der Schriftsetzer und Assessor Max Lannerfeld, der Falschspieler aus dem Ruhrgebiet, der Passfälscher aus Dresden und Juwelenräuber aus Moskau, der nach Sibirien verbannt worden war.4 Auch er erkannte mich und tauchte in der Menge der umherstehenden Menschen unter. Wir konnten ihn nicht mehr finden.
Es war längst Abend geworden. Da erscholl ein schriller Schrei, wie hoch aus der Luft, den man im ganzen Lager hören konnte. Vom heiligen Berg her ertönte ein entsetzlicher Lärm. Jetzt ging auch ich hinaus nach dem Berg. Ich konnte nicht bis an die Seile kommen, aber ich hörte, dass der Heilige einen Menschen aus der Höhle gestürzt habe, der ihn berauben wollte. Ein anderer wusste bereits, dass der Herabgestürzte einer der Russen sei. Der Sturz aus solcher Höhe hatte seinen Leib vollständig zerschmettert. Kaum eine Minute später kam eine neue Kunde. Es waren sieben Pferde gestohlen, und es fehlten die sieben anderen Russen. Im Nu zerteilte sich die Menge. Alles eilte daher nach den Gäulen, und ich nahm mir die Zeit, den Toten zu betrachten. Ich erkannte ihn beim Schein der kleinen Argolflamme, die angezündet wurde. Es war der Assessor.
Dienstag, 27. Februar 1866:
Am anderen Tag kehrten nach und nach die Reiter zurück. Hier und da brachte einer eins der geraubten Pferde; von den Räubern aber sprach keiner ein Wort; ich wenigstens konnte nicht erfahren, was mit ihnen geschehen war.
Sonntag, 1. April 1866:
Ich wartete noch einige Tage und setzte dann meine Reise zur Gobi, die von den Chinesen Schamo (Sandmeer) genannt wird, fort. Die Gobi ist das östliche Becken des Hanhai in der südlichen Mongolei, eine meist gewellte Wüstensteppe zwischen dem Altai-, Tien-schan- und dem Chinganggebirge. Bergzüge bis zu 2.100 Meter durchkreuzen die Wüstensteppe, hier im Osten sind sie teilweise bis zu 1.200 Meter hoch und die kesselartigen Vertiefungen zwischen den Gebirgszügen sinken bis zu 600 Meter Meereshöhe. Die meiste Fauna bildet die auch bei uns bekannte Erika und die drahtartige Dirissu der Mongolen, während Hasen, Füchse und Wölfe, kleine Nagetiere, wilde Bullen und Antilopen anzutreffen sind. Die Bevölkerung des Südens und des Ostens sind sesshafte Chinesen, die von Jahr zu Jahr die Steppe immer mehr einengen. Die Gobi wird im Osten von der Karawanenstraße Kichata-Kalgan durchschnitten. Die ersten Nachrichten über dieses Gebiet brachte der Jesuit Gerbillon, der zwischen 1688 und 1698 acht Missionsreisen in der Gobi unternahm. Nun hatte ich drei Wüsten auf drei verschiedenen Erdteilen kennengelernt: die Sahara in Afrika, den Llano Estacado in Amerika und die Gobi in Asien. Drei Wochen später befand ich mich wieder in Tien-tsin und gelangte von da nach Taku am Golf von Tschili. Ich musste einige Tage warten, bis ein Schiff in südlichere Gefilde abging, und war vor einigen Tagen in Kalkutta gelandet.
Dienstag, 3. April 1866:
Da ich kein Schiff fand, das in absehbarer Zeit nach Europa ging, fahre ich seit heute Morgen mit einem Dampfer nach New York.