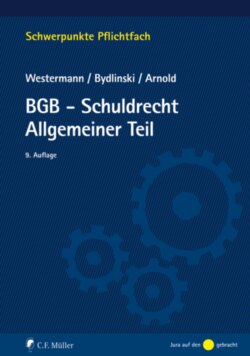Читать книгу BGB-Schuldrecht Allgemeiner Teil - Harm Peter Westermann - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Formale und materielle Aspekte der Vertragsfreiheit
Оглавление11
Vertragsfreiheit hat – wie die Freiheit im Allgemeinen – formale („Freiheit von“[17]) und materielle („Freiheit zu“[18]) Facetten. Im Liberalismus des 19. Jahrhunderts wurden Privatautonomie und Vertragsfreiheit weitgehend formal konzipiert, also als Institute der Sicherung formaler Freiheit verstanden.[19] Es ging vor allem darum, „Freiheit von staatlicher Einmischung“ zu garantieren. Diese Konzeption wirkt bis heute fort: Vertragsfreiheit wird oft als Selbstgesetzgebung Privater verstanden. Vertragsinhalte gelten danach nicht etwa deshalb, weil sie aus einer überindividuellen Perspektive zweckmäßig oder gerecht sind, sondern schlicht, weil sie privatautonom gesetzt sind.[20] Freiheit ersetzt danach Gerechtigkeit.[21] Die als „frei“ und „gleich“ gedachten Menschen selbst, nicht aber der Staat, definieren den Inhalt privatautonom begründeter Rechtssätze. Dem Staat kommt lediglich eine „Nachtwächterfunktion“ zu: Er sichert vor allem die Geltung und die Vollstreckung frei verhandelter Vertragsinhalte.[22] Das Hauptanliegen dieser Konzeption besteht darin, die Verkehrssicherheit und den Wettbewerb zu fördern. Ein wichtiges Kennzeichen des formalen Verständnisses von Vertragsfreiheit ist die Abstraktion, die Ausklammerung individueller Besonderheiten und sozialer, ökonomischer und historischer Kontexte.[23] Vielen Normen des allgemeinen Schuldrechts liegt noch heute eine formale Konzeption zugrunde. Gerade das allgemeine Schuldrecht abstrahiert häufig von den individuellen Merkmalen der Personen und reduziert sie auf ihre grundlegenden Eigenschaften als „Schuldner“ bzw „Gläubiger“. Das zeigt sich fast durchgängig an allgemein gehaltenen Schuldrechtsnormen, beispielsweise gleich bei § 241: Für diese Norm scheinen wirtschaftliche Machtrelationen, Informationsgefälle und ähnliches irrelevant zu bleiben.
12
Dem allgemeinen Schuldrecht liegt oft aber auch die Konzeption material verstandener Vertragsfreiheit zugrunde.[24] Materielle Elemente gehen über die formale Freiheit hinaus: Vertragsfreiheit wird vielmehr mit verschiedenen Inhalten aufgefüllt: Danach dient die Vertragsfreiheit verschiedenen Zwecken wie der Erzielung eines gerechten Austausches zwischen den Beteiligten, die in Solidarität kooperieren. Material verstandene Vertragsfreiheit berücksichtigt auch die ökonomischen, sozialen und politischen Kontexte. Das zeigt sich etwa dann, wenn Aufklärungspflichten zum Schutz unterlegener Bevölkerungsschichten angenommen werden[25] und natürlich deutlich im Verbraucherrecht: Die Vertragsinhalte – jenseits der Hauptleistungspflichten („Ware gegen Geld“) – werden dort weitgehend von Regeln bestimmt, die zugunsten der Verbraucher zwingend sind.[26] Die materiellen Elemente des Schuldrechts sind nach Inkrafttreten des BGB zunächst vor allem in der Rechtsprechung entwickelt worden.[27] Im Laufe der Zeit kamen sie immer klarer auch in gesetzlichen Regeln zum Ausdruck. Seit den 1970er Jahren steht diese Entwicklung im Zeichen des europäischen Rechts: Der europäische Gerichtshof und der europäische Gesetzgeber treiben die Materialisierung des Schuldrechts immer weiter voran.[28] Viele schuldrechtliche Normen berücksichtigen Ungleichgewichtslagen und soziale, ökonomische und gesellschaftliche Kontexte, in denen Verträge geschlossen werden.[29] Das entspricht der Gerechtigkeitsperspektive der Verteilungsgerechtigkeit.[30] Materiell verstandene Vertragsfreiheit ist ein Funktionselement der Gerechtigkeit. Die Grenzen der Vertragsfreiheit sichern in diesem Verständnis nicht bloß die Bedingungen der Möglichkeit von Vertragsfreiheit. Vielmehr verfolgen sie eigenständige Gerechtigkeitsanliegen.