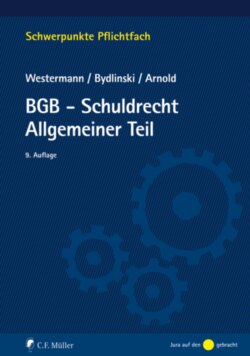Читать книгу BGB-Schuldrecht Allgemeiner Teil - Harm Peter Westermann - Страница 239
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Das Zurückbehaltungsrecht als Einrede
Оглавление344
Das allgemeine Zurückbehaltungsrecht des § 273 begründet eine Einrede, so wie beispielsweise auch § 214 für die Verjährung oder § 275 Abs. 2 und Abs. 3 für die Unzumutbarkeit der Leistungserbringung. Der Einredecharakter des § 273 ergibt sich schon aus der Rechtsfolgenanordnung des § 273 Abs. 1: Der Schuldner „kann die geschuldete Leistung verweigern, bis die ihm gebührende Leistung bewirkt wird.“ Anders als Einwendungen werden Einreden vor Gericht nicht etwa schon dann berücksichtigt, wenn ihre Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen. Das bedeutet: Selbst, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen des § 273 erfüllt sind, wird der Schuldner ohne Einschränkung zur Leistung verurteilt, wenn er das allgemeine Leistungsverweigerungsrecht nicht geltend macht. Sein eigener Anspruch – auf den er das Zurückbehaltungsrecht hätte stützen können – wird ihm dadurch freilich nicht genommen; er kann ihn gegebenenfalls in einem eigenen Prozess durchsetzen. Die Wirkungen des Zurückbehaltungsrechts treten aber nur ein, wenn die Einrede auch geltend gemacht wird; der Schuldner muss sich auf das Zurückbehaltungsrecht also berufen. Die Geltendmachung der Einrede kann im Prozess erfolgen, sie muss es aber nicht: Die Einrede kann auch außerhalb des Prozesses oder in seinem Vorfeld wirksam erhoben werden.
345
Auch im Rahmen anderer Regelungen kommt es für § 273 auf die Erhebung der Einrede an: So kann der Schuldner den Schuldnerverzug dadurch vermeiden, dass er ein Zurückbehaltungsrecht geltend macht.[7] Solange der Schuldner das Zurückbehaltungsrecht allerdings nicht geltend macht, bleibt er in Verzug bzw. gerät er in Verzug:[8] Leistet also der Schuldner trotz Fälligkeit und Mahnung nicht, so tritt Verzug selbst dann ein, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen des § 273 zwar vorliegen, der Schuldner das Leistungsverweigerungsrecht aber nicht geltend macht. Der Schuldner muss also sein Leistungsverweigerungsrecht aus § 273 geltend machen, um zu verhindern, dass er in Schuldnerverzug gerät. Darin liegt ein wesentlicher Unterschied zum Zurückbehaltungsrecht nach § 320: Wegen der besonders engen Verbindung synallagmatischer Ansprüche werden die Verzugsfolgen dort – im Gegensatz zu § 273 – auch schon dann vermieden, wenn lediglich die Tatbestandsvoraussetzungen des § 320 vorliegen, also ohne, dass der Schuldner die Einrede auch geltend gemacht hat.
Zur Beendigung des Schuldnerverzugs genügt die Erhebung der Einrede aus § 273 nicht mehr: Vielmehr muss der Schuldner dann die seinerseits geschuldete Leistung erbringen oder in Annahmeverzug begründender Weise anbieten.[9]