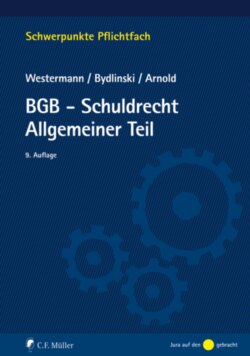Читать книгу BGB-Schuldrecht Allgemeiner Teil - Harm Peter Westermann - Страница 56
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Zielschuldverhältnis und Dauerschuldverhältnis
Оглавление89
Schuldverhältnisse lassen sich auch in Zielschuldverhältnisse und Dauerschuldverhältnisse unterteilen. Die Begriffe sind im BGB nicht definiert. Allerdings gibt es eine Reihe von Sonderbestimmungen für Dauerschuldverhältnisse, beispielsweise §§ 308 Nr 3, 309 Nr 1 und 9 oder § 314.
90
Zielschuldverhältnisse sind auf einen regelmäßig von Anfang an bekannten konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet, etwa von Ware und Geld beim Kaufvertrag (§ 433). Wenn die Kaufsache bezahlt und die Sache (mangelfrei) übergeben und übereignet wurde, erlöschen die Primärleistungspflichten (§ 362 Abs. 1). Fortwirkende Schutzpflichten aus § 241 Abs. 2 bestehen zwar, machen aber nicht das Wesen des Zielschuldverhältnisses aus.
91
Dauerschuldverhältnisse sind dagegen auf ein Bündel von Rechten und Pflichten ausgerichtet, die über einen längeren Zeitraum fortdauern bzw ständig neu entstehen. Sie erschöpfen sich nicht in einem einzelnen Leistungsaustausch, sondern führen zu langfristigen Bindungen mit immer wieder neu konkretisierten Rechten und Pflichten zwischen den Vertragsparteien. Typische Beispiele sind Mietverträge, Arbeitsverträge oder auch Darlehensverträge. Bei Dauerschuldverhältnissen kennen die Parteien den konkret geschuldeten Leistungsumfang regelmäßig nicht von Anfang an, auch besteht oft ein größeres Näheverhältnis zwischen den Vertragsparteien.[50] Daher können bei Dauerschuldverhältnissen beispielsweise weitergehende und umfangreichere Nebenpflichten iSd § 241 Abs. 2 bestehen als bei Zielschuldverhältnissen.[51]
92
Auch Rahmenverträge sind Dauerschuldverhältnisse. Sie bestimmen gewisse Grundlagen und Modalitäten innerhalb derer dann fortlaufend neue Verträge – beispielsweise über die Lieferung von Waren – geschlossen werden. Auf die Beendigung des Rahmenvertrags ist § 314 anwendbar.[52] Der Rahmenvertrag ist von den einzelnen Austauschverträgen zu unterscheiden. Wenn bei einer einzelnen Lieferung etwas „schief läuft“ – also etwa der Verkäufer mangelhafte Ware liefert, ist der einzelne Kaufvertrag der maßgebliche Anknüpfungspunkt für die Käuferrechte.[53] Der Käufer kann dann etwa wegen mangelhafter Leistung gem. §§ 437 Nr 1, 439 Nacherfüllung vom Verkäufer verlangen.
93
Bei Sukzessivlieferungsverträgen zieht sich die Lieferung über längere Zeit hinweg. Möglich ist zum einen, dass die Lieferung ratenweise durch Teilleistungen erbracht wird.[54] So liegt es beispielsweise bei einem Kaufvertrag über 60 Weinkisten, von denen 20 am 1.1., 20 am 1.3. und weitere 20 am 1.5. geliefert werden sollen. Solche Verträge nennt man auch Ratenlieferungsverträge. Zum anderen liegt ein Sukzessivlieferungsvertrag vor, wenn die Parteien vereinbaren, dass einzelne Lieferungen je nach Bedarf auf Abruf bis zu einer bestimmten Höchstmenge erfolgen sollen. § 266 ist bei ihnen ausdrücklich oder konkludent abbedungen, so dass der Schuldner ausnahmsweise zu Teilleistungen berechtigt (und sogar verpflichtet!) ist. Sukzessivlieferungsverträge sind nach hM keine Dauerschuldverhältnisse iSd § 314.[55]
94
Bei Bezugsverträgen vereinbaren die Parteien, dass die konkrete Liefermenge erst später bestimmt wird. Dazu gehören Versorgungsverträge über Energie oder Wasser. Auch in der Gastronomie sind solche Bezugsverträge etwa bei Bier üblich (Bierlieferungsvertrag):[56] Die Wirtin ist zum Bezug des Biers bei einer bestimmten Brauerei (die oft den Betrieb der Gaststätte durch Darlehen oder Sachleistungen mitfinanziert) verpflichtet; die konkrete Abnahmemenge steht aber noch nicht fest, vielmehr ruft die Wirtin die jeweils benötigte Menge Bier nach Bedarf ab. Bezugsverträge werden nach hM als Dauerschuldverhältnisse von § 314 erfasst.[57] Das lässt sich damit begründen, dass im Gegensatz zu Ratenlieferungsverträgen bei Bezugsverträgen der konkrete Leistungsumfang noch nicht von Anfang an feststeht.[58]