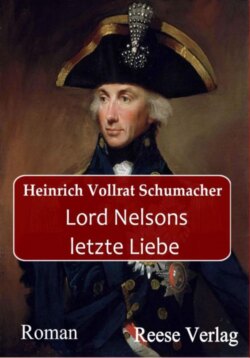Читать книгу Lord Nelsons letzte Liebe - Heinrich Vollrat Schumacher - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Neuntes Kapitel
ОглавлениеAm sechsten Oktober meldete Nelson Sir William die Erfolglosigkeit seiner Jagd auf die französischen Schiffe und seine Rückkehr zu Lord Hood nach Toulon. Er legte einen Brief für Emma bei, in dem Josiah ihr seine kleinen Erlebnisse während der Fahrt schilderte. Emma antwortete mit ein paar freundlichen Zeilen, und es entwickelte sich zwischen ihr und den fernen Freunden ein reger Briefwechsel, besonders seitdem Sir William, mit Geschäften überbürdet, ihr auch die politischen Mitteilungen an die Flotte übertrug. Schnellsegler verkehrten fast wöchentlich zwischen ihnen und verschafften Emma mit dem heimlich Geliebten eine Verbindung von wehmütigem Reiz. Wie aus einem Spiegel leuchtete aus seinen oft mit flüchtiger Feder hingeworfenen Briefen sein ganzes Wesen hervor, sein feuriger, siegreich gegen das Elend seines Körpers ankämpfender Geist, sein hohes Streben, seine Frömmigkeit und Liebe zum Vaterlande. Und das alles gehörte einer anderen ...
Zorn gegen das Schicksal beschlich sie, das ihr Nelson zu spät zugeführt hatte. Freude, daß er sie der Teilnahme an seinen hochfliegenden Ideen wert hielt. Schmerz, daß sie nichts zu tun vermochte, ihn auf seinem Wege vorwärtszubringen. Fest glaubte sie an seine Kraft, an seine Zukunft. Von einem fernen Tage träumte sie, da sie ihm den verweigerten Lorbeer um die Stirne schlingen würde. Mochte das Glück seines Herzens bei der anderen sein, wenn sein Geist nur einmal, nur ein einziges Mal, Hand in Hand mit Emmas Geiste über die Höhen des Lebens schwebte! Zwei weiße Flammen, in inniger Umschlingung sich vermählend, für einen Augenblick das Dunkel der Nacht erleuchtend, in der Emma dahinwandelte ...
Nun begriff sie die stille Seligkeit jener Maria Magdalena, die dem Heiland der Welt die Füße waschen durfte. Wunschlos, in Demut dienend. Um lieben zu dürfen. Um wie die Priesterinnen der Vesta anbetend vor dem heiligen Feuer des eigenen Herzens zu knien ...
Wonnevolle Ekstasen hatte sie in ihren einsamen Nächten, wenn sie des Fernen gedachte. Körperlos nahte er ihr, losgelöst von der niederen Hülle des Fleisches. Seine Stimme hörte sie, sah den Blick seiner Augen. Aus ihnen sprach seine Seele zu ihr, tauchte sie in ein tönendes Meer von Musik, durchschauerte sie mit sanfter, rieselnder Wärme. Auf singenden Strahlenwellen schwebte sie empor, höher und höher. Bis sich ihr ganzes Wesen auflöste. In einen einzigen, weichen, zitternden Akkord. Der in goldenen Sonnenwölkchen flüsternd zerrann ...
Während ihre Tage angefüllt waren mit den schmutzigen Geschäften des Lebens. Unaufhörlich galt es, neue Intrigen spinnen, neue Händel abschließen, neue Lügen ersinnen. In einem Meer von Blut watete die Zeit und durch die Mauern des Palazzo Sessa drang der Brandgeruch der geopferten Hekatomben.
***
Seit Emma als Gesandtin zum ersten Male das Parkett des Hofes betreten hatte, war sie Maria Carolinas Vertraute geworden. Aus den Ursachen machte die Königin vor Emma selbst kein Hehl. Emmas Schönheit hatte sie bezaubert, und ihre offene, schlichte, natürliche Art, die Maria Carolina an ihre Jugend unter Maria Theresias mütterlicher Obhut, an das ungekünstelte, von munterer Fröhlichkeit bewegte Leben am Wiener Hofe erinnerte. Während in Neapel alles Mißtrauen, List und Intrige war, mühsam verhüllt durch die starren Formen der spanischen Etikette. Von allen Seiten belauert konnte Maria Carolina nichts tun, kein harmloses Wort aussprechen, das nicht verdreht und entstellt von ihren Gegnern benutzt wurde, das Ansehen der ,Österreicherin‘ im Volke zu untergraben. Beim Könige keinen Schutz gegen die Verleumdungen, keine Hilfe in den schwierigen Fragen der Regierung findend, die der Geistesträge ihr allein überließ, hatte sich Maria Carolinas Gemüt in den fünfundzwanzig Jahren einer freudelosen Ehe verbittert. Einsam stand sie inmitten eines fremden Volkes, mit Mißtrauen und Verachtung den Haß erwidernd, den man ihr offen und versteckt entgegentrug.
Emmas Erscheinen war für sie gewesen, wie ein Sonnenstrahl nach langer Nacht. Sir William war reich, gewährte seinem kostbaren Kleinod jeden Wunsch. Emmas vollkommene Schönheit bildete eher einen Schmuck des Hofes, als daß sie von diesem Glanz empfing. Wenn sie politischen Ehrgeiz besaß, so nutzte sie ihn nur zum Vorteil der Königin. Allezeit war England Neapels opferbereiter Freund, Maria Carolinas zuverlässigste Stütze in ihrem Kampfe gegen die Revolution gewesen, die sich näher und näher heranwälzte, ihren Thron und das Erbe ihrer Kinder bedrohend.
Auch war Emma verschwiegen, voll Takt. Vorsichtig angestellte Proben hatten es bewiesen. Niemals hatte sie Anvertrautes weitergetragen, niemals in Gegenwart anderer die Ehrerbietung verletzt, die sie der Majestät schuldete. Und endlich — diese schöne, uneigennützige, verschwiegene Frau hatte Schweres erlebt, besaß eine zärtliche, schmerzerfahrene Seele. In sie konnte Maria Carolina alle ihre Sorgen, all ihr Leid ergießen, ohne Mißdeutung oder Verrat fürchten zu müssen. Was für Marie Antoinette in ihren glücklichen Tagen Luise Lamballe gewesen war, das war Emma für Marie Carolina: eine Freundin ohne Eigennutz, ohne Arglist, wie Königinnen sie nur ganz selten einmal auf ihrem Dornenwege fanden ...
Wenn Maria Carolina so sprach, in jenen stillen Abendstunden, die sie allein mit Emma verbrachte, war sie ganz Frau, ganz Offenheit und zärtliche Hingebung. Voll mütterlicher Sorge machte sie Pläne für die Zukunft ihrer sieben Kinder, die ihr von achtzehn geblieben waren und deren Erbe bei dem bescheidenen Vermögen der Familie nur gering sein konnte; beklagte sich voll zorniger Scham über die niederen Leidenschaften des Königs, die das Gefühl der gebildeten Frau und die Würde der Königin verletzten; erinnerte sich voll Wehmut an die spärlichen Stunden des Glücks, die ihr das Elend einer kalten Vernunftehe gelassen. Sie hatte den jungen Fürsten Caramanico geliebt. Mit jener Königinnenliebe, deren Los früher Untergang war. Den ehernen Forderungen der Staatsräson hatte sie den Geliebten geopfert. Wie sie selbst sich täglich, stündlich opferte.
Wenn Maria Carolina von diesem kurzen Frühling ihres Herzens sprach, lag ein blasser Schein auf ihrem kraftvollen Gesicht, die starke Unterlippe der Habsburgerin zitterte, ihre Stimme klang verschleiert. Und Emma war es, als steige aus den müden Worten etwas empor, wie der herbe Duft verwelkter Rosen ...
***
Am sechzehnten Oktober fiel das Haupt der Marie Antoinette unter dem Messer der Guillotine. Fünf Tage später erhielt Sir William durch einen Kurier die Nachricht.
Niemand wagte der Königin das Schicksal der vergötterten Schwester mitzuteilen. Ferdinand floh feige auf eines seiner Jagdschlösser, alles dem Premierminister überlassend; Sir John Acton schob Sir William als den Empfänger der Botschaft vor; Sir William aber zitterte vor den unberechenbaren Zornesausbrüchen Maria Carolinas. Fast flehend wandte er sich um Hilfe an Emma.
Mit einem Blick des Spottes auf den ‚lächelnden Philosophen‘ willigte sie ein.
Aber als sie dann am Abend der Ahnungslosen gegenübersaß, als Maria Carolina ihrer Neigung zu kleinen Liebesdiensten folgend für sie die schönsten Früchte aus einer vor ihr stehenden Schale wählte und selbst zu schälen begann, fiel ihr das Traurige ihrer Aufgabe schwer aufs Herz. Aus ihrem Munde sollte die unter das Leid ihres eigenen Lebens Gebeugte diesen neuen Schlag erfahren, der sie bis ins Innerste erschüttern mußte ...
Zaghaft begann sie. Näherte sich auf weiten Umwegen zwei-, dreimal ihrem Ziele. Um dann doch jedesmal vor dem entscheidenden Worte zurückzubeben.
Endlich schien Maria Carolina aufmerksam zu werden. Das Schälmesser fortlegend, richtete sie ihre Augen ungeduldig forschend auf Emmas Gesicht.
„Sie scheinen mit anderen Dingen, beschäftigt, Mylady!“ sagte sie, ihr den Titel gebend, mit leichter Schärfe im Ton. „Was ist es? Haben Sie Nachrichten aus Paris? Schon zweimal haben Sie den Namen der Königin erwähnt!“
Bei dem ersten strengen Worte war Emma aufgestanden.
„Die Zukunft Euerer Majestät erlauchter Schwester ängstigt mich,“ erwiderte sie ehrerbietig. „Ich weiß nicht, warum, aber in den letzten Tagen ... fortwährend mußte ich an die Blutgier denken, mit der die Jakobiner sich an der geheiligten Person ihres Königs vergriffen haben ...“
Maria Carolina blickte verwundert auf.
„Und Ludwigs Schicksal bringen Sie in Verbindung mit dem meiner Schwester? Ich verstehe nicht, weshalb. Glauben Sie, die Schänder der Menschenwürde werden vergessen, daß. Marie Antoinette Österreicherin ist? Man hat ihr das Wort als Beschimpfung ins Gesicht geschleudert. Trotzdem ist es jetzt ihr Schutz. Man wird sich hüten, es mit dem Kaiser zu verderben. Wenn sich der Blutrausch des Pöbels gelegt hat, wird man froh sein, sie und ihre Kinder nach Wien ausliefern zu dürfen. Sie schütteln den Kopf? Sprechen Sie, Mylady! Was denken Sie?“
Traurig sah Emma auf.
„Blutrausch, Majestät? Der Pöbel mag ja darin befangen sein. Die Führer aber ... Ich habe Robespierres Reden gelesen. Mir aus ihnen ein Bild des Menschen zu machen gesucht. Er spricht ohne Leidenschaft, ohne Haß. Aber das Königtum scheint ihm ein Prinzip, das seinem Prinzip, Herrschaft des Volkes, feindlich gegenübersteht.
Darum strebt er, den Thron zu stürzen, den König und alles zu vernichten, was zu diesem gehört. Glauben Majestät, daß dieser kalte Rechner Österreich fürchtet? Er, der bereit ist, sich und sein ganzes Volk seinen Ideen zu opfern?“
Erregt stand Maria Carolina auf.
„Mylady! Sie sprechen, als ob Sie diese Ideen billigten!“
„Ich verabscheue sie, wie alle Menschen von Herz und Gefühl es tun. Aber trotzdem, wenn ich mich in die Lage jener Leute versetze ... dieses Volk, das so weit ging, seinen schuldlosen König aufs Schafott zu schleppen, kann es noch zurück? Wenn es die Königin freigibt, muß es nicht fürchten, daß sie an der Spitze eines Heeres zurückkehrt, um Vergeltung zu üben?“
Aus Maria Carolinas Augen brach eine Flamme.
„Eine wehrlose Frau! Unschuldige Kinder! Wenn sie es wagen! Wenn sie es wagen!“ Heftig ging sie hin und her. Plötzlich blieb sie vor Emma stehen. Mit gerunzelter Stirn, mißtrauischem Blick. „Warum sagen Sie mir das alles, Lady Hamilton? Sie sprechen wie Acton, Sir William, Fürst Castelcicala, Marchese Vanni, der Prokurator Guidobaldi. Die jakobinischen Ideen nennen sie eine Seuche, von Paris über ganz Europa verbreitet. Auch Neapel soll angesteckt sein. Durch Admiral Latouche-Trevilles Offiziere, die heimlich an Land gegangen seien, um unsere Jugend zu vergiften. Schon soll ich mich auf meinen eigenen Hof nicht mehr verlassen können. Adel, Beamte, Bürger, Heer, Flotte — das ganze Volk habe sich gegen den Thron verschworen. So redet man ohne Unterlaß auf mich ein. Und nun auch Sie, Mylady! Die paar Augenblicke der Erholung, die man mir gönnt, benutzen Sie, um mir Ludwigs blutiges Gespenst an die Wand zu malen. Was bezweckt man damit? Soll ich die Besinnung verlieren? Zu etwas gedrängt werden, das man offen nicht von mir zu verlangen wagt?“
Ihre Stimme klang scharf und drohend, ihr Auge wich nicht von Emma. Erriet sie die stille Arbeit Actons und Sir Williams, aus dem Mißtrauen zwischen der Königin und ihrem Volke für England Nutzen zu ziehen?
Mit Mühe verbarg Emma ihre Unruhe. Zu der in Sir Williams Schule geübten Kunst der Verstellung greifend, richtete sie sich auf und maß die Königin mit sprühendem Blick.
„Majestät befahlen mir zu sagen, was ich denke. Wenn meine Worte mißfallen ... Ich bin die Gesandtin Englands. Majestät wollen mir allergnädigst gestatten, mich zurückzuziehen.“
Maria Carolina biß die Zähne zusammen, wandte sich schroff ab.
„Wie es Ihnen beliebt, Mylady!“
Emma verneigte sich tief und ging. Aber als sie an der Tür war, eilte die Königin ihr nach, hielt sie am Kleide zurück.
„Du gehst wirklich? Siehst du denn nicht, daß ich krank bin, am Ende meiner Kräfte?“
„Majestät ...“
„Ach, laß doch die Majestät! Wenn wir unter uns sind ... Nun ja, ich habe dich beleidigt. Mein heißes Blut ... Ich bitte dich um Verzeihung. Bist du nun zufrieden?“
Emma mit ihren Armen umschlingend ging sie mit ihr zum Tisch zurück, drückte sie auf den Diwan nieder, streichelte ihr die Wangen, lächelte ihr zu, küßte sie. Ein großes Kind war sie, spielte mit Emma wie mit einer Puppe. Dann nahm sie das Messer wieder auf, fuhr fort, die Frucht zu schälen. Schob Emma die süßen Stücke lachend zwischen die Lippen.
Emma ließ es geschehen. Lächelte zu den Scherzen, erwiderte dir kleinen Zärtlichkeiten. Aber etwas wie Bitterkeit stieg in ihr auf. Für die Ausführung ihrer Aufgabe sah sie keinen Weg. Immer wieder entschlüpfte ihr die Königin. In der Politik von fast eigensinniger Beharrlichkeit, war sie im persönlichen Verkehr nervös, sprunghaft, fiel von einem Extrem ins andere. Als ruhe sie bei dem tändelnden Spiel aus, und als schöpfe aus ihm ihr Wille neue Kraft.
Wie Marie Antoinette war sie, unbesonnen, zu Überschwenglichkeiten geneigt. Überlegte nie, ob sie zu Mißdeutungen Anlaß gab. Wurde durch trübe Erfahrungen nicht vorsichtiger. Selbst die Schmähschrift schien sie schon wieder vergessen zu haben, die der Conte Gorani, ein französierter Mailänder, erst vor zwei Monaten in Paris gegen sie veröffentlicht hatte. Obwohl sie das Schimpflichste enthielt, was man einer Fürstin, Frau, Mutter nachsagen konnte.
Weil ihr von ihren achtzehn Kindern elf gestorben waren, hieß es, sie habe den Plan gefaßt, ihre Söhne durch schlechte Behandlung absichtlich zu töten, um den Besitz von Neapel Österreich in die Hände zu spielen. Während sie doch die zärtlichste Mutter war, und beim Fehlen eines Thronerben die übrigen Zweige des Hauses Bourbon zur Regierung gekommen wären, niemals aber Habsburg-Lothringen. Auch ihre Freundschaft zu Emma hatte man mit Schmutz beworfen, schmähliche Neigungen angedeutet, Stunden harmloser Zwiesprache milesische Nächte genannt. Als wäre es unnatürlich, daß eine einsame, von Sorgen bedrückte Fürstin Trost und Aussprache bei einer gleichgestimmten Freundin suchte!
Aber das Volk glaubte den Verleumdungen. Wie auch das Volk von Paris den Gerüchten über Marie Antoinette und Luise Lamballe geglaubt hatte. Wenn diese Lazzaroni zur Macht kamen, die im Quälen unschuldiger Tiere ihren größten Genuß fanden, würden sie Emma dasselbe tun, wie die Pariser der Lamballe. Würden johlend Emmas Haupt auf einer Pike durch die Straßen tragen ...
Wortlos, mit einer Gebärde der Verachtung hatte Maria Carolina das Buch des Lügners beiseite geschoben. Eine Königin war sie, eine Tochter Maria Theresias. Erhaben über die Meinungen des Tages. Emma dagegen — inmitten dieses Tages lebte sie, mußte ihre Stellung unaufhörlich gegen offene und versteckte Angriffe verteidigen. Daran aber schien Maria Carolina nicht zu denken ...
Es war schon später Abend, als der diensttuende Kammerherr den Kabinettskurier Ferreri meldete. Verwundert sah Maria Carolina auf.
„Ferreri? Ist er nicht mit dem Könige nach Persano?“
„Er kommt von dort und überbringt ein Handschreiben an Eure Majestät.“
Maria Carolinas Staunen wuchs. Sie überlegte einen Augenblick, dann befahl sie, Ferreri einzulassen.
Erhitzt von schnellem Ritte trat Ferreri ein. Schwankenden Schrittes ging er zu Maria Carolina, blieb in achtungsvoller Entfernung von ihr stehen, öffnete langsam seine Kuriertasche. Ein schneller, unruhiger Blick aus seinen Augen traf Emma.
Ein Gedanke fuhr ihr durch den Kopf. Ferdinand wußte nicht, daß sie Maria Carolina vorbereiten sollte. Hatte er der Königin geschrieben, was er nicht gewagt hatte, ihr zu sagen?
Angst überfiel sie. Hysterie hatte Domenico Cirillo, der Leibarzt, das sprunghafte Wesen der Königin genannt, eine Folge ihrer vielen Geburten und Kümmernisse. Unter ihren stetig wachsenden Sorgen scheine das Leiden fortzuschreiten, könne bei jähen Gemütserschütterungen leicht zu einer Katastrophe führen ...
Als Maria Carolina nach dem Schreiben griff, fiel Emma vor ihr auf die Knie. „Öffnen Sie nicht, Majestät! Lesen Sie nicht, bevor ich ...“
„Was ist Ihnen, Mylady?“ fragte die Königin betroffen. „Auch Ferreri sieht verstört aus ...“
Sie löste das Siegel, öffnete das Papier.
„Ich beschwöre Euer Majestät um einen Augenblick Gehör! Vorhin fragten Sie mich, warum ich zweimal ...
Die Königin fuhr zusammen.
„Marie Antoinette?“
Den Brief ihren kurzsichtigen Augen nähernd las sie in fliegender Hast, halblaut die Worte herausstoßend. Plötzlich stutzte sie, wurde totenblaß. Ein furchtbares Zucken erschütterte ihren ganzen Körper.
Wie von einem Peitschenhieb getroffen sprang sie auf, öffnete die Lippen, als wollte sie schreien. Wirr lief ihr Blick durch das Zimmer ...
Auf Ferreri blieb er haften. Sie sah ihn an, als erkenne sie ihn nicht. Dann ... ihre Zähne knirschten aufeinander, ihre Gestalt straffte sich, ihr Gesicht wurde starr, undurchdringlich. Den Brief fallen lassend krampfte sie ihre Hände um die Kante des Tisches.
Einen Augenblick stand sie unbeweglich. Dann zog der Schatten eines Lächelns um ihre Lippen.
„Wollen Sie die Güte haben, Mylady, die Börse dort auf meinem Schreibtisch Ferreri zu geben?“ sagte sie mit einer Stimme, die tief aus ihrer Brust zu kommen schien. „Ich danke Ihnen, Ferreri, für Ihre Sorgfalt im Dienste des Königs. Ruhen Sie nun aus und kehren Sie morgen nach Persano zurück. Sagen Sie Seiner Majestät, daß ich für die Aufmerksamkeit danke und gute Jagd wünschen lasse.“
Huldvoll nickte sie ihm zu. Aber als er das Zimmer verlassen hatte, nickte sie noch immer. Nach der Stelle hin, wo er gestanden hatte. Mit demselben leeren Lächeln. Dem Lächeln der geborenen Königinnen.
Nun lösten sich die Hände. Mit einem würgenden Schrei fiel Maria Carolina über den Tisch. Hart schlug ihre Stirn gegen das Holz.
Lange lag sie so, immer dasselbe schreckliche Wimmern hervorstoßend. Das sie doch mit aller Kraft zu unterdrücken suchte. Draußen horchten wohl die Schranzen ...
Der wehe Ton zerriß Emma das Herz. Ihre Arme um Maria Carolina schlingend beugte sie sich über sie. Rief sie mit dem Namen, den ihre Lieben in der Heimat ihr gegeben hatten.
„Charlotte! ... Charlotte! ... Lottchen!
Maria Carolina hob den Kopf. Als lausche sie auf eine ferne Stimme.
„Tonerl?“ murmelte sie, plötzlich deutsch sprechend. „Mein Tonerl! Mein liebes Tonerl!“ Ihre Hände fuhren über den Tisch. Als suchten sie dort andere Hände, die sich ihr liebend entgegenstreckten. Dabei berührte sie das Fruchtmesser. Jäh schnellte sie empor, Entsetzen in den weitaufgerissenen Augen. „Sie ist tot! Sie haben sie gemordet! Schändlich gemordet!“
Sie griff nach dem Messer; mit einer wilden Bewegung, als wolle sie es sich in die Brust stoßen. Emma fiel ihr in den Arm. Ein lautloses Ringen entstand. Plötzlich glitt Emmas aufhaltende Hand ab, das Messer fuhr nieder, schnitt einen Riß in ihr Kleid und fiel zu Boden. Und als sei damit Maria Carolinas Kraft erschöpft, brach sie ohnmächtig zusammen.
Emma bettete sie auf den Diwan, stürzte ins Vorzimmer, befahl Doktor Cirillo zu holen. Dann kehrte sie zur Königin zurück, die Tür vor neugierigen Augen verschließend. Nun erst merkte sie, daß sie verwundet war. Ein langer, blutender Schnitt zog sich über ihre Brust. Notdürftig verband sie ihn, schloß das Kleid und ging dem eintretenden Cirillo entgegen.
Cirillo behandelte die Königin seit Jahren, kannte die Natur ihres Leidens und sprach mit ihr als strenger Arzt, ohne Rücksicht auf die Majestät.
Er brachte sie zum Bewußtsein zurück, schaffte sie mit Emmas Hilfe zu Bett, verordnete ihr einen langen, ungestörten Schlaf. Und da sie, zusammengekrümmt in den Kissen liegend, mit einem bitteren Lachen den Kopf schüttelte, gab er ihr Morphium.
Er wollte während der Nacht bei ihr bleiben; sie aber sträubte sich dagegen. Sein kühles Gesicht erregte sie. Nur Emma sollte bei ihr sein. Eigensinnig bestand sie auf ihrem Willen, drohte aufzustehen, wenn er nicht ginge. So gehorchte er endlich.
Alle Türen mußte Emma verriegeln. Überall sah Maria Carolina bleiche, drohende Gesichter, erschrak vor dem leisesten Geräusch. Trotz des Morphiums wollte der Schlaf nicht kommen. Unaufhörlich wälzte sie sich in den Kissen. Fiel in halbwache Träume, die ihr Marie Antoinettes abgeschnittenes Haupt vorspiegelten. Erwachte im nächsten Augenblick mit einem grausigen Schrei der Todesangst.
Bis Emma ihren flehenden Bitten nachgab, zu ihr ins Bett kam und ihre Arme um sie schlang. Da wurde sie ruhiger. Schloß die Augen. Schlief endlich ein.
Lange lag Emma wach. Horchte auf die Atemzüge der Schlummernden; grübelte über die seltsamen Wege des Lebens.
Ein Matrosenliebchen stieg aus den Gassen Londons empor, damit eine Königin ruhig schlafen konnte ...
Sie erwachte von einem leichten Schmerz, der ihr die Brust durchzuckte. Die Augen öffnend sah sie Maria Carolina, wie sie am Bette stehend sich über die Wunde beugte. Errötend wollte Emma sich bedecken, aber Maria Carolina wehrte es ihr.
„Ich erinnere mich!“ sagte sie langsam, mit starrer Miene. „Du rangest mit mir um das Messer. Da vergoß ich dein Blut. Laß es mich sehen, damit ich daran denke, wenn ich undankbar gegen dich werden will. Könige vergessen schnell. Es ist gut, wenn sie etwas haben, das ihnen das Gedächtnis schärft. Denn ich will vor dir nicht mehr Königin, sondern nur Mensch sein. Beim Haupte der Gemordeten! Wie ich dies Mal an deinem Leibe küsse, so will ich dir dienen, wie und wann du es forderst.“ Sie beugte sich tief, drückte seltsam kalte Lippen auf die Wunde. „Du aber — dieses Blut hat dich zu meinem Soldaten gemacht. Und die Mörder sollen erfahren, daß auch Frauen das Schwert zu führen verstehen, wenn die Könige versagen. Steh auf, Soldat, die Gerechtigkeit wartet!“
Hatte sich ihr Geist unter den Schrecknissen dieser Nacht verwirrt?
Sie stand in der Mitte des Zimmers, die Hand erhebend, wie zu einem feierlichen Schwur. In ihrem bleichen Gesicht flackerten unheimliche Augen; ein schreckliches Lächeln entblößte ihre scharfen, spitzen Zähne ...
***
An demselben Tage ließ sie durch Acton einen besonderen Staatsgerichtshof berufen, dem Fürst Castelcicala, Marchese Vanni, der Prokurator Guidobaldi angehörten. Ein Heer von Spähern, Angebern, Sbirren verfolgte alle, die sich ,Patrioten‘ nannten und in geheimen Gesellschaften zusammenkamen, um die in Paris verkündeten Menschenrechte auch in Neapel einzuführen.
Als Emma zum ersten Male Vannis fanatisches Gesicht sah, überlief sie ein Schauder. Würde das Schwert der Königin in der Hand dieses Mannes ein Schwert der Gerechtigkeit sein?