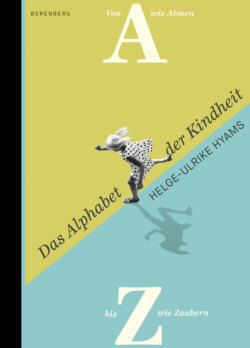Читать книгу Das Alphabet der Kindheit - Helge-Ulrike Hyams - Страница 12
Adoption
Оглавление»Ein Kind zu adoptieren ist – ich kann es bezeugen – eine gefühlsmäßig reiche Erfahrung, die an Intensität der Erfahrung biologischer Elternschaft durchaus gleicht.«
Olivier Poivre d’Arvor
Es gibt sie nicht: die Adoption. Adoption hat viele Gesichter. Eigentlich bräuchten wir mindestens drei Begriffe, um die extrem unterschiedlichen Wirklichkeiten und Wahrnehmungsweisen ein und desselben Vorgangs zu begreifen. Da ist die Geschichte der Frau, die ihr Kind – unter welchen Umständen auch immer – abgibt. Da ist die Geschichte des Elternpaares oder der Einzelperson14, das sich sehnlichst ein Kind wünscht. Und schließlich ist da das Kind selbst, Objekt des Begehrens und zugleich des Verlassenwerdens. Drei eigene Realitäten, drei zutiefst unterschiedliche Geschichten. Und sofort wird auch spürbar, dass wir damit nur die Hauptakteure erfassen. Um jeden dieser drei ranken sich wieder andere Personen (Partner, Eltern und andere Familienangehörige) oder Institutionen (Sozialämter, Kirchen, Adoptionsvermittler) sowie unendlich viele Möglichkeiten, Sehnsüchte, womöglich auch Abgründe.
Betrachten wir deshalb diese Geschichten einzeln, rücken wir je einen der Akteure ins Licht.
Erstens: Da erscheint das Gesicht der meist jungen Frau, die ungewollt ein Kind empfängt, austrägt, zur Welt bringt und zur Adoption abgibt. Kaum ist dieser Satz ausgesprochen, so schaltet sich Widerspruch ein: Was heißt ungewollt? Welcher Wille war da am Wirken? War es der Eigenwille der Frau, ihr Begehren, ihr Sehnen und ihre körperliche Bereitschaft, schwanger zu werden? War es ihr eigener Wille, das Kind abzugeben? Oder war es vielleicht ein fremder Wille? Etwa der der Eltern, die die Schande von der Tochter abwenden wollten? Oder der Widerspruch des Partners, der sich durch diese Schwangerschaft gestört fühlte? Oder der einer wohlmeinenden Lehrerin, die dem jungen Mädchen riet, erst einmal ordentlich die Schule zu absolvieren? (»Später kannst du noch viele Kinder kriegen!«) Oder war es die Dorfgemeinschaft oder die Kirche, die, zumindest in der Vergangenheit, außereheliche Schwangerschaften als Vergehen ahndete und die Frau häufig drängte, die sündige Tat durch eine Adoption ungeschehen zu machen?15 Im Nachhinein ist es extrem schwer, den authentischen Willen einer Frau zu ergründen, die das Kind zur Adoption freigibt. Häufig ist die junge Frau innerlich extrem zerrissen, hat also Schwierigkeiten, ihren wirklichen Willen zu erkennen und zu benennen.
Manche Frauen, die ihr Kind abgeben, tun dies mit einem hohen Maß an Konsequenz. Vielleicht wollten sie ursprünglich abtreiben, ließen jedoch Termine verstreichen und sehen nun die Lösung in der Freigabe des Kindes zur Adoption. Andere dagegen haben sich eindeutig entschieden, das ungewünschte Kind nicht abtreiben, sondern leben zu lassen, aber sie fühlen sich nicht in der Lage, es anzunehmen und aufzuziehen. Sie glauben, dass das Kind in einer Adoptivfamilie besser aufgehoben ist und gute Entwicklungschancen erhält. Deshalb planen sie gezielt die Adoption und lassen sich selten in ihrem Entschluss irritieren.
Aber das ist doch eher eine Minderheit. Die große Mehrheit der Frauen, die ihre Kinder zur Adoption freigibt, handelt aus dem Gefühl einer seelischen Überforderung heraus. Sie fühlen sich übermäßig beansprucht durch die Schwangerschaft und allein gelassen von Partnern, Eltern, Geschwistern und Freunden. Nicht zu unterschätzen ist auch die Zahl derer, die schon ein oder zwei Kinder haben und plötzlich spüren, dass die Kraft für ein weiteres Kind nicht mehr ausreicht. Die Geburt des Kindes und die damit verbundenen Ängste überwältigen manche Frauen, und sie sind außerstande, die mütterliche Rolle zu übernehmen.
Alle Frauen, die ein Kind zur Welt bringen, brauchen im Moment der Geburt selbst Bemutterung, das heißt liebevolle, umfassende Versorgung und Zusprache. Einfühlsame Partner, die Mütter der Gebärenden, Freundinnen und vor allem Hebammen wissen dies und bauen im Idealfall um die schwangere und gebärende Frau eine Art Schutzwall. Bei der jungen Frau aber, die ihr Kind zur Adoption freigibt, fehlt dieser Schutzwall meistens ganz. Sie ist nur selten umgeben von liebenden und aufbauenden Personen, sondern – wenn überhaupt – von professionellen Helfern, die sie bei den notwendigen juristischen Schritten begleiten.
Nach der erfolgten Adoption fühlt die Frau, selbst dann, wenn sie ihre Emotionen beiseite schiebt, meist eine Leere, die man sich in ihrer Intensität nur schwer vorstellen kann. Wir lassen uns leicht täuschen: Auch wenn die biologische Mutter ihre Entscheidung aus vermeintlichen Vernunftgründen fällt, so durchlebt die Seele die Trennungsqual doch unvermindert stark. Tiermütter klagen oft tagelang nach ihren Jungen, die man ihnen wegnimmt. Menschenmütter schreien selten laut, doch ihr Schmerz ist nicht minder groß.
Seit Sigmund Freud wissen wir, dass die Menschen in unserer Gesellschaft gut lernen, zu verdrängen. Aber er verweist uns gleichzeitig darauf, dass diese Verdrängung ihren Preis fordert und dass sie auf Dauer meistens nicht trägt.16 Ich kenne eine Frau, die als fünfzehnjähriges Mädchen ein Kind aus einer Verbindung mit einem Oxford-Studenten aus Indien zur Adoption gegeben hatte. Lebenslang reiste sie später nach Indien, in der unbewussten Hoffnung, dem Kind eines Tages womöglich dort zu begegnen. Und der Film Philomena (2013) zeigt eine andere Frau, die fünfzig Jahre nach der Geburt ihres unehelichen Sohnes geschwiegen hat und plötzlich verzweifelt nach ihm zu suchen beginnt. So lange hat die Verdrängung ihr Werk getan – dann aber glaubt die Frau nicht weiterleben zu können, ohne ihren Sohn gefunden zu haben.17 »Der Mensch vergisst niemals wirklich. Alle kleinen Einzelheiten leben versteckt irgendwo in den Erinnerungen unseres Geistes«18, schreibt der Koreaner Jung in seinem berührenden Comic über seine eigene Adoption, und in seinen Bildern bezeugt er, dass diese nicht nur im Geist, sondern auch im Körper selbst bewahrt und erinnert werden.
Zweitens: Die Geschichte der Adoptiveltern – so gut wie immer ist dies eine lange Geschichte. Meistens verstreichen Jahre mit vergeblichem Warten auf das eigene (biologische) Kind.19 Oftmals hat das Paar bereits mehrere Fertilitätsuntersuchungen und auch -behandlungen über sich ergehen lassen, bis es sich zur Adoption entscheidet, bisweilen wohl auch durchringt, aus der Einsicht, dass der eigene Kinderwunsch nicht realisierbar ist. Manchmal war es eine qualvolle Wartezeit. Oder, diese Variante existiert heute in zunehmendem Maße, homosexuelle Partner, Männer oder Frauen, ersehnen ein gemeinsames Kind und entscheiden sich für die Adoption.
Der Kinderwunsch entspringt eben nicht, wie manche behaupten, einem narzisstischen Impuls, im Kind ein Stück eigenes Ich zu schaffen. Das wäre psychologisch zu kurz gegriffen. Vielmehr ist es das Begehren, dass der Fluss des Lebens mit mir nicht abbricht, dass er weiterfließe, fleischlich-lebendig. Der Wunsch nach Kindern entspringt der Bejahung des Lebens, der Akzeptanz des Zyklus von Sterben und Werden, so wie Goethe es formulierte: »Und so lang du das nicht hast, dieses: Stirb und werde! Bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.«20 Die meisten Menschen fühlen das – bewusst oder unbewusst. Sie spüren den Impuls, dass das Leben weitergehen soll durch sie. Sie wollen Kinder, und zwar Männer und Frauen gleichermaßen.21 Viele Adoptiveltern, die keine Kinder bekommen können, wählen zur Befriedigung dieses Begehrens ein fremdes Kind. Mit der Kraft ihres Willens und ihrer Liebe nehmen sie ein ihnen unbekanntes Wesen an Kindes statt an, geben ihm Namen, Nahrung, Haus und Zukunft. Das erfordert Mut und eine tragfähige Motivation und Durchhaltekraft. Ganz so wie jedes Elterndasein.
Und schließlich – drittens – ist da das Adoptivkind selbst. Die allermeisten Kinder haben das Glück, in eine liebende Familie aufgenommen zu werden, die schon lange sehnsüchtig auf sie gewartet hat. Auf jeden Fall gelangen sie in Familien, die amtlich geprüft und für gut befunden wurden, die Kinder aufzunehmen. Sie haben das Glück, eine Familie zu bekommen, Wohnung, Nahrung und Wachstumschancen. Ganz besonders trifft dies für Kinder aus dem Ausland zu – inzwischen die große Mehrheit der Adoptivkinder –, wo sie oftmals wenig gute bis gar keine Entwicklungschancen haben.
So war es bei Anna, dem jungen Mädchen aus Rumänien. Die Adoptiveltern, ein kinderloses Arztehepaar aus England, holten sie und ihre zwei Brüder aus einem jener unvorstellbar lieblosen Kinderheime des Rumäniens der Neunzigerjahre. Anna war damals fast zwei Jahre alt, sie konnte noch nicht laufen, weil sie bis dahin meist an Gurten angekettet im Kinderbett gehalten wurde. Heute ist Anna eine junge Frau, auffallend zugewandt, fröhlich und selbstbewusst. Und dennoch erzählt die Adoptivmutter, dass die Tochter bisweilen in kaum zügelbare Zornattacken verfällt, so als wolle sie alles, ihre Vergangenheit und ihre jetzige Wirklichkeit, zerstören. So als wäre das Leben in England und in dieser liebevollen Familie das falsche Leben. So als sei sie selbst falsch.
Jedes Adoptivkind drängt irgendwann einmal danach, Auskunft über seine biologischen Eltern zu bekommen. Das Kind möchte wissen, wer es zur Welt gebracht hat, wer es gezeugt hat, und vor allem will es erfahren, warum die eigene Mutter es weggegeben hat. Wenn diese Frage nicht beantwortet wird, gibt es sich die Erklärung selbst: »Sie hat mich abgelehnt. Sie wollte mich nicht. Sie hat mich nicht geliebt.«
Das sind die im Adoptivkind kreisenden Gedanken. Es spricht sie selten aus. Wie Anna sind die meisten Adoptivkinder voller Dankbarkeit. Sie wissen sehr wohl, was sie den Adoptiveltern verdanken. Dennoch nagen diese Fragen in ihnen. Sie tragen das Trauma in sich, von ihrer eigenen Mutter für immer weggeschickt, ausgesetzt worden zu sein. Wie bei so vielen anderen Lebenskränkungen, die jeder von uns in sich trägt, gibt es Wege, damit zu leben und eine Balance herzustellen. Gegenüber dem Schmerz als Schattenseite der Adoption wiegt die andere Waagschale, in welcher das Glück, der Lebenswille und die Hingabe vereint sind. Und Letzteres wiegt, wenn man das Bild der Waage ernst nimmt, spürbar schwerer. Wie sagt der Koreaner Jung, der als Fünfjähriger zwischen Mülleimern aufgegriffen und zur Adoption nach Europa verschickt wurde? »Schließlich haben sie mir doch die Hauptsache gegeben: eine Familie.«22