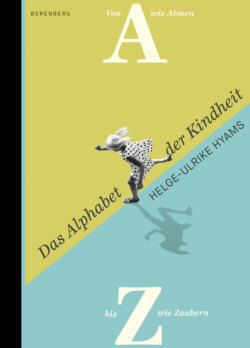Читать книгу Das Alphabet der Kindheit - Helge-Ulrike Hyams - Страница 17
Autismus
Оглавление»Der Schlüssel zum Autismus ist der Schlüssel zum Wesen des Menschen.«
L. Wing
Dieses Kapitel ist das einzige innerhalb des Alphabets der Kindheit, das sich mit einem psychiatrischen Krankheitsbild befasst. Dabei ist meine Wahl keineswegs zufällig. Wir müssen manchmal, um die sogenannte normale, gesunde Entwicklung des Kindes besser zu verstehen, Umwege machen, und zwar Umwege über Abweichungen, über Extreme, über Krankheit gar. Dem Normalen gegenüber sind wir hin und wieder betriebsblind. Wir sehen es einfach nicht. Wir öffnen die Augen erst für die Abweichung. Hier horchen wir auf, hier reagieren wir. Und aus dieser Perspektive begreifen wir bisweilen das Wesen dessen, was wir gemeinhin als normal wahrnehmen. Thomas Mann bezeichnet die Pathologie als ein anthropologisches Erkenntnismittel ersten Ranges.34 Nehmen wir hier den Autismus als Pathologie, so gibt er uns tatsächlich eine besondere Möglichkeit, zu verstehen – und zwar in vielerlei Hinsicht:
Erstens: Wir können erkennen, wie unendlich nahe Gesundheit und Krankheit liegen. In Wirklichkeit sind die Grenzen überaus fließend. Schauen wir zunächst auf die Merkmale, die dem autistischen Kind allgemein zugeordnet werden. Wichtigstes Leitmotiv ist das schwach ausgeprägte Ich-Gefühl und entsprechend keine wirkliche Vorstellung von einem Du. In der Sprache haben autistische Kinder unterschiedlich ausgeprägte Defizite (Umkehrung von Worten, Echolalie oder auch völliger Sprachausfall). Ihr Schlaf ist häufig gestört und ebenso ihr Essverhalten. Viele der Kinder leiden an körperlichen Ticks, bizarren oder auch stereotypen Gebärden mit den Händen, den Armen und Beinen und/oder dem gesamten Körper. Fast alle schwanken extrem in den Stimmungen. Es fällt ihnen schwer, symbolisch wahrzunehmen, und gleichzeitig fallen einige durch außergewöhnliche, meist einseitige intellektuelle, zeichnerische oder musische Begabungen auf. Ganz generell sind sie »einfach anders in die Welt gestellt«.35
Wenn wir uns diese Merkmale im Einzelnen anschauen, sind all diese Erscheinungen in abgeschwächter Form bei einer Vielzahl von Kindern zu beobachten. Welches Kind hat nicht, zumindest temporär, Essstörungen oder Schlafprobleme? Welches Kind schwankt nicht in seinen Stimmungen und ist zeitweise ganz auf sich selbst zurückgeworfen – ohne Beziehung und ohne Einfühlung in das Du? So gut wie alle diese autistischen Züge gehören zum Bild und ebenso zum schwankenden Selbstbild der allermeisten Kinder.
Damit Autismus Krankheitswert erhält, müssen diese Merkmale so stark ausgeprägt sein, dass sie das betroffene Kind in seinem Wachstum ernstlich behindern und stören und dadurch auch seine Umgebung in Mitleidenschaft gezogen wird. Selten ist es das Kind selbst, das an seinem Sosein leidet, es sind die anderen, die es als autistisch wahrnehmen und es sein Anderssein spüren lassen, und oftmals schafft erst dies das eigentliche Leiden des autistischen Kindes. Auf die Frage »Ray, bist du autistisch?« antwortete der Rain Man im gleichnamigen Film: »Ich glaube nicht. Nein. Definitiv nicht.«36
Zweitens: Wir können erkennen, wie irritierend und zugleich fragwürdig
Diagnosen und Krankheitszuweisungen sind.
Es versteht sich, dass im Fall einer gravierenden Einschränkung des Kindes – dann nämlich, wenn es nicht wirklich sein Ich entwickelt, wenn es gar nicht in die Sprache hineinfindet und wenn es nicht in der Lage ist, soziale Kontakte mit anderen aufzubauen – Psychologen und Psychiater zu Hilfe geholt werden. Sobald die Eltern Anzeichen von Autismus bei ihrem Kind spüren, verlangen sie nach Diagnose und Rat.
Genau hier beginnt das Dilemma. Da das Spektrum der Syndrome so extrem breit gestreut ist und sich häufig mit anderen Entwicklungsstörungen oder psychiatrischen Krankheitsbildern kreuzt beziehungsweise überlagert, fallen die Diagnosen für kindlichen Autismus extrem unterschiedlich und bisweilen willkürlich aus. Unterschiedlich sind sowohl die Instrumente der Diagnostik37 als auch die theoretischen Standpunkte der Diagnostizierenden.
Die wissenschaftliche Forschung ist seit der fast zeitgleichen Entdeckung des Autismus als eigenes Krankheitsbild durch den Amerikaner Leo Kanner (1943) und den Österreicher Hans Asperger (1938) bis heute systematisch fortgeschritten und wird auffallend kontrovers diskutiert.38 Verschiedene Disziplinen konkurrieren mehr oder weniger unerbittlich um ein tieferes Verständnis der Krankheit – Genetik und Epigenetik, neurobiologische und neurochemische sowie psychologische Theorieansätze39 –, teilweise unter Einbeziehung, teils unter strikter Ausblendung psychoanalytischer Befunde und Erfahrungen.40 Und seit einigen Jahren registriert man überdies einen »rätselhaften Anstieg«41 der Diagnosestellung Autismus (beispielsweise eine Verdoppelung der Fälle zwischen 2000 und 2010). Rätselhaft ist allerdings die Frage, ob die Krankheit mit ihrer ganzen Schwere wirklich derart um sich gegriffen hat, oder ob nicht die Theorien und Methoden zur Erfassung der Störung derart inflationär missbraucht werden, dass die Statistiken kaum mehr aussagekräftig sind.
Und drittens: Wir können erkennen, dass Krankheit (auch) ein Spiegel der Gesellschaft ist.
Rätselhaft bleibt weiterhin, ob tatsächlich – wie oben vermutet – nur die Diagnosestellung Autismus extrem zugenommen hat oder ob nicht doch die Kinder derzeit wesentlich leichter und häufiger autistisch krank werden. Man muss nicht kulturpessimistisch sein, um unter den Menschen Phänomene und Verhaltensweisen zu entdecken, die man deutlich als autistisch gefärbt erkennen kann: Elternpaare, die aneinander vorbeischauen; stillende Mütter am Notebook; Familien, die nicht zusammen essen; Menschengruppen, in denen wenig oder gar nicht gesprochen wird; Techniksucht; Fühllosigkeit und Mangel an Empathie; Zahlenfetischismus; roboterhafte Bewegungen. Die Liste autistisch gefärbten Verhaltens ließe sich mühelos erweitern. All dies sind Botschaften einer Gesellschaft, die sich, in tausend Gewändern verkleidet und chronisch verabreicht, in der unendlich porösen und plastizierbaren kindlichen Seele niederschlagen und diese nachhaltig prägen.
Eine Gesellschaft produziert nicht nur körperliche Krankheiten wie Krebs, Diabetes und Herzleiden, sondern auch seelische Leiden, Depressionen, Süchte, und womöglich auch die verschiedenen Ausformungen von Autismus. In vielen Verhaltensweisen autistischer Kinder kann man, gleichsam wie in einem Spiegel, Zerrbilder des typischen Habitus unserer (westlichen) Gesellschaft entdecken.
Nein, Krankheiten, auch Kinderkrankheiten, fallen nicht vom Himmel. Die wissenschaftliche Forschung soll durchaus weitergehen. Die eigentliche Forschung steht aber da an, wo wir uns als gesellschaftliche Subjekte immer wieder neu fragen müssen, in welche Welt wir unsere Kinder eigentlich entlassen. Welchen Nährboden bereiten wir ihnen, damit sie gut wachsen können? Welches Immunsystem schenken wir ihnen von Anfang an? Wo liegt unser aller Beitrag – jenseits der Gene –, dass so viele unserer Kinder autistisch erkranken?