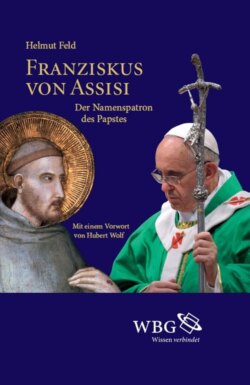Читать книгу Franziskus von Assisi - Helmut Feld - Страница 48
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. Die Drei-Gefährten-Legende (3 Soc)
ОглавлениеDie sogenannte Legenda trium sociorum war schon LUCAS WADDING bekannt, doch wurde sie, ebenso wie I Cel, zum ersten Mal 1768 in den Acta Sanctorum der Bollandisten gedruckt.98 Die zur Zeit maßgebliche Edition ist die von THÉOPHILE DESBONNETS. Sie beruht auf 22 Handschriften, deren älteste auf den Anfang des 15. Jahrhunderts datiert werden.99
An 3 Soc entzündet sich ein Teil des Komplexes der wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, die unter dem Namen »Franziskanische Frage« in die Geschichte der Forschung eingegangen sind. Generell geht es bei der Franziskanischen Frage um das Alter, die gegenseitige Abhängigkeit und die historische Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit der einzelnen Lebensbeschreibungen.100
Zunächst stellt sich die Frage, ob der Brief aus Greccio vom 11. August 1246, den die drei Gefährten Leo, Angelus und Rufinus an den Generalminister Crescentius von Jesi richteten, ursprünglich zu dem Text von 3 Soc oder zu einer anderen Sammlung von Erinnerungen an Franziskus gehörte. Für letzteres können im Brief selbst Argumente gefunden werden. Es heißt nämlich dort, daß die Verfasser nicht in Form einer Legende schreiben wollen, da es bereits genügend Franziskus-Legenden gebe. Sie wollen vielmehr nur einige »schönere Blumen« zu deren Ergänzung beitragen. Außerdem hielten sich ihre Aufzeichnungen nicht an die historische Reihenfolge der Ereignisse. Diese Merkmale treffen für 3 Soc nicht zu.
VAN ORTROY zog hieraus den Schluß, daß die echte Drei-Gefährten-Legende verloren gegangen und Thomas von Celano ihr Material in der Vita secunda verarbeitet habe. SABATIER dagegen folgerte aus dem Brief von Greccio, die ursprüngliche Drei-Gefährten-Legende sei um wesentliche Teile verkürzt worden. (Diese unterdrückten Teile glaubte er dann in dem Speculum perfectionis wiedergefunden zu haben, welches ja nicht in Form einer Legende geordnet ist und auf das somit die Charakterisierung des Briefes von Greccio zutrifft).101
Der Herausgeber TH. DESBONNETS hält an der Zusammengehörigkeit von Brief und Legende fest mit der Begründung, daß der Brief in allen Handschriften der 3 Soc enthalten sei. Er erscheine zudem nur dort, sonst nirgendwo, weder allein noch in Verbindung mit einem anderen Dokument. »Deshalb meinen wir, daß der Brief von der Legende nicht getrennt werden darf, deren Los er folgen muß: mit ihr authentisch oder mit ihr falsch.«102 Aus einem Vergleich der Erzählung des Traums vom waffengefüllten Palast bei I Cel, 3 Soc und dem »Anonymus von Perugia« schließt DESBONNETS, daß 3 Soc jünger sei als I Cel, jünger auch als der »Anonymus von Perugia«, den sie als Quelle benutze. Dagegen sei 3 Soc älter als II Cel. Die Entstehungszeit grenzt er so auf die Jahre 1235–1248 ein. Warum also nicht das durch den Brief von Greccio angegebene Datum 1246 annehmen?103
Dagegen bestreitet LORENZO DI FONZO die Zusammengehörigkeit von Brief und Legende: der Brief stehe im Widerspruch zum Inhalt der 3 Soc; er bezeuge eindeutig, daß die drei Gefährten an Crescentius von Jesi nicht eine fortlaufende Legende sandten, sondern unzusammenhängende Berichte über noch nicht allgemein bekannte Ereignisse, die den bereits in den Legenden enthaltenen hinzugefügt werden sollten. DI FONZO nimmt als Entstehungszeit für 3 Soc die Jahre 1305–1312 an: später als die Legenda maior des heiligen Bonaventura, später auch als der »Anonymus von Perugia«, der auch nach DI FONZO Quelle für 3 Soc ist. Weder Salimbene de Adam in seiner Chronik (1284–1288), noch Ubertino von Casale in der »Arbor vitae crucifixae Iesu« und den späteren Schriften (1305–1312) erwähnen 3 Soc.104
Für die Spätdatierung der 3 Soc tritt auch STANISLAO DA CAMPAGNOLA ein: In der 3 Soc zeige sich, wie auch im »Anonymus von Perugia« (s.u. 7), bereits die Entfernung von der historischen Konkretheit und die Veränderung der geschichtlichen Fakten unter dem Einfluß einer längeren mündlichen Überlieferung. Geprägt von hoher Religiosität gebe sie eine Darstellung der frühesten Phase der franziskanischen Bewegung und des Weges des Franziskus hin zur Gleichförmigkeit mit Christus, so wie es den Vorstellungen mancher Kreise im Orden nach Bonaventura entsprach. Damit ist der historische Wert der 3 Soc für die Erforschung des Franziskuslebens ungefähr auf Null reduziert.105
Demgegenüber halten wir die Argumente, die SOPHRONIUS CLASEN für eine Frühdatierung der 3 Soc vorgebracht hat, nach wie vor für sehr gewichtig.106 Wie aus zahlreichen Einzelvergleichen hervorgeht, hat Thomas von Celano in seiner zweiten Legende die 3 Soc als Vorlage benutzt. Sodann finden sich in 3 Soc Aussagen, die nur auf einer genauen Kenntnis der Verhältnisse der frühen franziskanischen Bewegung basieren können: die Auskunft der ersten (mit Franziskus) sieben Brüder gegenüber Leuten, die sie nach ihrem Orden fragten, sie seien Büßer aus der Stadt Assisi, »denn ihre religiöse Gemeinschaft wurde noch nicht als ›Orden‹ bezeichnet« (3 Soc 37); die Unterscheidung zwischen dem Amt des procurator (Kardinal Johannes de Sancto Paulo) und dem des protector (Kardinal Hugolino von Ostia nach dem Tod des Johannes von St. Paul: 3 Soc 61); die zweimalige jährliche Zusammenkunft aller Brüder bei der Portiuncula zum Kapitel, nämlich an Pfingsten und am Michaelstag (3 Soc 57).
Noch weiter geht JOHN MOORMAN, der annimmt, daß die Erzählungen über die Jugend des Franziskus in 3 Soc eine ursprünglichere Version sind als diejenigen in I Cel. Er zeigt dies am Beispiel der Erzählung vom Traum über den waffengefüllten Palast, den Franziskus auf seiner Reise nach Apulien hatte. Um eine genaue Textanalyse zu ermöglichen, hat MOORMAN die Versionen von 3 Soc 5 und I Cel 4f. in parallelen Kolumnen abgedruckt.107 In 3 Soc fragt Franziskus den Mann, der ihm erschienen ist, wem die Waffen und der Palast gehörten. Er erhält die Antwort (responsum est illi), das alles werde doch geht dem keine Frage des Franziskus voraus. Daraus ergibt sich nach MOORMAN klar, daß 3 Soc die frühere Version der Erzählung enthält, I Cel aber, im Bestreben seine Quelle abzukürzen, sowohl die Erscheinung des Mannes wie auch die direkte Frage an Franziskus wegläßt, so daß die Antwort gewissermaßen im Leeren hängt. MOORMAN schließt daraus nicht, daß 3 Soc in ihrer gegenwärtigen Form Thomas von Celano als Quelle diente,108 aber daß sie doch auf denselben schriftlichen Quellen basiert, die auch von Celano für seine Vita prima benutzt wurden und die möglicherweise in der Bibliothek der Brüder in Assisi aufbewahrt wurden. MOORMAN ist der Ansicht, daß der Verfasser der Drei-Gefährten-Legende dieses Material geschickter und zuverlässiger genutzt hat als Thomas von Celano.109
Auch andere Erzählungen aus der Zeit der Bekehrung des Franziskus lassen, bei Vergleich der Texte von I Cel und 3 Soc, den gleichen Befund erkennen. Um nur noch ein Beispiel anzuführen: Nachdem sich Franziskus von dem Priester in der Portiuncula-Kirche das Evangelium von der Aussendung der Jünger hat erklären lassen, zieht er für sein zukünftiges Leben die Folgerung daraus. I Cel kleidet den Satz in die kunstvolle rhetorische Form der Klimax: »Das ist’s, was ich will, das ist’s, was ich suche, dies begehre ich mit allen Kräften der Seele zu tun« (I Cel 22). In der 3 Soc heißt es schlichter: »Das ist es, sagte er, was ich mit allen Kräften erfüllen möchte« (3 Soc 25). Es kann wohl kein Zweifel sein, daß die letztere Form die literarisch ältere und der geschichtlichen Wirklichkeit nähere ist.
Wir halten die Argumente für eine Frühdatierung der in 3 Soc enthaltenen Traditionen im ganzen für zutreffend. Doch kann der Brief der drei Brüder aus Greccio unmöglich zu der jetzt vorliegenden »Drei-Gefährten-Legende« gehören. Er würde jedoch zu den nicht in chronologischer Reihenfolge gegebenen Episoden und Berichten, wie sie in den Sammlungen des Speculum perfectionis und der Legenda Perusina enthalten sind, hervorragend passen.
Die 3 Soc liegt in deutscher Übersetzung vor unter dem (irreführenden) Titel: Die Dreigefährtenlegende des heiligen Franziskus. Die Brüder Leo, Rufin und Angelus erzählen vom Anfang seines Ordens. Übersetzung und Anmerkungen von Engelbert GRAU (Franziskanische Quellenschriften, Bd. 8), Werl 1972. Der Band enthält (S. 25–168) eine ausführliche Einführung in die literaturgeschichtliche Problematik von SOPHRONIUS CLASEN.